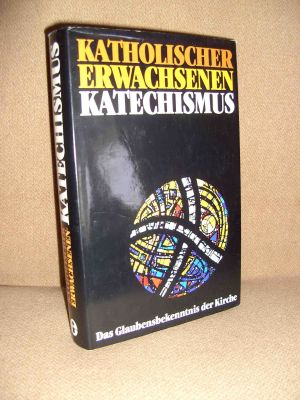Katholischer Erwachsenen-Katechismus
Deutsche Bischofskonferenz / Österreichische Bischofskonferenz
Der Katholische Erwachsenen-Katechismus besteht aus zwei Bänden. Der erste Band mit dem Titel: "Das Glaubensbekenntnis der Kirche" kam 1985 heraus. Der zweite Band wurde überschrieben: "Leben aus dem Glauben" und erschien 1995. Dieser Katechismus ist in Deutschland und Österreich verbreitet. Die Entwicklung des ersten Bandes wurde von Walter Kasper, des zweiten Bandes von Friedrich Wetter geleitet. Er wurde in verschiedenen Verlagen (in der Verlagsgruppe Engagement) editiert. Die Österreichische Bischofskonferenz beschloss am 3. Juli 1985, den Erwachsenen-Katechismus für Österreich zu übernehmen.
| Allgemeiner Hinweis: Was bei der Lektüre von Wortlautartikeln der Lehramtstexte zu beachten ist |
Inhaltsverzeichnis
- 1 Erster Band: Das Glaubensbekenntnis der Kirche
- 1.1 Vorwort
- 1.2 Erster Teil: Gott der Vater
- 1.2.1 I. Ich glaube - Hilf meinem Unglauben
- 1.2.2 II. Gott, der Vater, der Allmächtige - Der Vater Jesu Christi
- 1.2.3 III. Gott - Der Schöpfer des Himmels und der Erde
- 1.3 Zweiter Teil: Jesus Christus
- 1.3.1 I. Jesus Christus - Unser Herr und Gott
- 1.3.2 II. Geboren von der Jungfrau Maria
- 1.3.3 III. Für uns gekreuzigt
- 1.3.4 IV. Auferstanden - Aufgefahren in den Himmel
- 1.4 Dritter Teil: Das Werk des Heiligen Geistes
- 1.4.1 I. Das neue Leben im Heiligen Geist
- 1.4.2 II. Die Kirche als Sakrament des Geistes
- 1.4.3 III. Gemeinschaft der Heiligen - durch Wort und Sakrament
- 1.4.4 IV. Die sieben Sakramente
- 1.4.4.1 1. Die Taufe
- 1.4.4.2 2. Die Firmung
- 1.4.4.3 3. Die Eucharistie
- 1.4.4.3.1 3.1 Die Eucharistie - Danksagung an den Vater
- 1.4.4.3.2 3.2 Die eucharistische Gegenwart Jesu Christi
- 1.4.4.3.3 3.3 Die Eucharistie - Gedächtnis des Opfers Jesu Christi
- 1.4.4.3.4 3.4 Die Eucharistie - Sakrament der Einheit und der Liebe
- 1.4.4.3.5 3.5 Struktur, Elemente und Teile der Eucharistiefeier
- 1.4.4.4 4. Das Sakrament der Buße
- 1.4.4.5 S. Die Krankensalbung
- 1.4.4.6 6. Das Sakrament der Weihe
- 1.4.4.7 7. Das Sakrament der Ehe
- 1.4.5 V. Das Leben der kommenden Welt
- 2 Zweiter Band: Leben aus dem Glauben
- 2.1 Vorwort
- 2.2 Erster Teil: Ruf Gottes - Antwort des Menschen
- 2.2.1 I. Der Mensch vor dem Ruf Gottes
- 2.2.2 II. Die Antwort in der Bibel
- 2.2.2.1 1. Ruf Gottes und Antwort des Menschen im Alten Bund
- 2.2.2.1.1 1.1. Gottes Ruf und des Menschen Verweigerung
- 2.2.2.1.2 1.2. Der Bund Gottes mit Israel
- 2.2.2.1.3 1.3. Glaubensverkündigung und sittliche Botschaft bei den Propheten
- 2.2.2.1.4 1.4. Die messianischen Verheißungen von Recht und Gerechtigkeit in der kommenden Königsherrschaft
- 2.2.2.1.5 1.5. Die Mahnung der Weisheitslehre des Alten Bundes zu einem guten Leben.
- 2.2.2.2 2. Heilsverkündigung und sittliche Botschaft im Neuen Bund
- 2.2.2.2.1 2.1. Der Ruf Jesu und die Antwort des Menschen
- 2.2.2.2.2 2.2. Umkehr, Glaube und Nachfolge
- 2.2.2.2.3 2.3. Die Seligpreisungen und die "radikalen" Forderungen Jesu
- 2.2.2.2.4 2.4. Die Aufnahme des Ethos Jesu in der Kirche
- 2.2.2.2.5 2.5. Die Verwirklichung der Forderung Jesu als bleibender Anspruch
- 2.2.2.3 3. Die Grundstruktur des biblischen Ethos
- 2.2.2.1 1. Ruf Gottes und Antwort des Menschen im Alten Bund
- 2.2.3 III. Grundvollzüge des Lebens aus dem Glauben
- 2.2.4 IV. Maßstäbe christlichen Handelns
- 2.2.5 V. Das Gewissen
- 2.3 Zweiter Teil: Die Gebote Gottes
- 2.3.1 Einführung: Die Gebote Gottes als Wegweisung zum Leben
- 2.3.2 I. Erstes Gebot: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben
- 2.3.3 II. Zweites Gebot: Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren
- 2.3.4 III. Drittes Gebot: Gedenke, daß du den Sabbat heiligst
- 2.3.4.1 1. Der Sabbat als Geschenk Gottes an das Volk des Alten Bundes
- 2.3.4.1.1 1.1. Der Wortlaut des Gebotes
- 2.3.4.1.2 1.2. Der Sabbat als Innehalten in der Arbeit
- 2.3.4.1.3 1.3. Der Sabbat als Zeichen des Bundes
- 2.3.4.1.4 1.4. Der Sabbat als Hinweis auf die Schöpfung und den Schöpfer
- 2.3.4.1.5 1.5. Der Sabbat als Erinnerung an die Befreiung
- 2.3.4.1.6 1.6. Der Sabbat als Zeichen der Erneuerung des Bundes und der kommenden Herrlichkeit
- 2.3.4.2 2. Der christliche Sonntag als Geschenk Gottes an das Volk des Neuen Bundes
- 2.3.4.3 3. Der Sonntag des Christen heute
- 2.3.4.4 4. Die Sonntagsfeier und die getrennten Christen
- 2.3.4.1 1. Der Sabbat als Geschenk Gottes an das Volk des Alten Bundes
- 2.3.5 IV. Viertes Gebot: Du sollst Vater und Mutter ehren
- 2.3.5.1 1. Verantwortung in den Grundformen des Gemeinschaftslebens
- 2.3.5.2 2. Als Christen leben in der Familie
- 2.3.5.3 3. Die Christen und die politische Gemeinschaft
- 2.3.5.3.1 3.1. Das christliche Evangelium und die politische Autorität
- 2.3.5.3.2 3.2. Grundlagen und Ziele der modernen politischen Gemeinschaft
- 2.3.5.3.3 3.3. Glaube und Politik, Kirche und Staat
- 2.3.5.3.4 3.4. Protest und Widerspruch im freiheitlich demokratischen Staatm
- 2.3.5.3.5 3.5. Widerstand gegen ungerechte Gewalt
- 2.3.5.4 4. Die Christen und ihre Kirche
- 2.3.6 V. Fünftes Gebot: Du sollst nicht töten
- 2.3.6.1 1. Wert und Würde des menschlichen Lebens
- 2.3.6.2 2. Entfaltung und Gestaltung des Lebens
- 2.3.6.3 3. Gefährdung von Gesundheit und Leben
- 2.3.6.4 4. Schutz des menschlichen Lebens an seinem Anfang
- 2.3.6.4.1 4.1. Fragen und Probleme um den Beginn des menschlichen Lebens
- 2.3.6.4.2 4.2. Bewahrung des menschlichen Lebens in Konfliktsituationen
- 2.3.6.4.3 4.3. Genetische Beratung und vorgeburtliche Untersuchung
- 2.3.6.4.4 4.4. Das Gesetz des Staates und der Schutz des ungeborenen Lebens
- 2.3.6.4.5 4.5. Genforschung und Gentechnologie
- 2.3.6.5 5. Sorge um kranke und sterbende Menschen
- 2.3.6.6 6. Verantwortung für den Frieden
- 2.3.6.6.1 6.1. Das "Evangelium vom Frieden" (Eph 6,15)
- 2.3.6.6.2 6.2. Friedensförderung: Wahrung der Gerechtigkeit und Achtung der Rechte
- 2.3.6.6.3 6.3. Friedenssicherung: Sicherheit für alle
- 2.3.6.6.4 6.4. Friedenshoffnung: Gewaltverzicht und Nächstenliebe
- 2.3.6.6.5 6.5. Erziehung zum Frieden, Dienst am Frieden
- 2.3.6.7 7. Verantwortung für die Schöpfung
- 2.3.7 VI. Sechstes und neuntes Gebot: Du sollst nicht ehebrechen, Du sollst nicht begehren, deines Nächsten Frau
- 2.3.8 VII. Siebtes und zehntes Gebot: Du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut
- 2.3.8.1 1. Das siebte und zehnte Gebot als Wegweisung zu Freiheit und Gerechtigkeit
- 2.3.8.2 2. Arbeit als sittliche Aufgabe
- 2.3.8.3 3. Gestaltungsaufgaben in der Arbeitswelt
- 2.3.8.3.1 3.1. Aufbau einer Ordnung der Arbeit
- 2.3.8.3.2 3.2. Recht auf Arbeit
- 2.3.8.3.3 3.3. Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit
- 2.3.8.3.4 3.4. Schaffung humaner Arbeitsbedingungen und betrieblicher Strukturen
- 2.3.8.3.5 3.5. Koalitionsrecht, Streik und Aussperrung
- 2.3.8.3.6 3.6. Recht auf unternehmerische Initiative
- 2.3.8.4 4. Sinn und Ordnung des Eigentums
- 2.3.8.5 5. Sittliche Einzelaufgaben wirtschaftlichen Verhaltens
- 2.3.8.5.1 5.1. Der rechte Umgang mit Konsumgütern
- 2.3.8.5.2 5.2. Schutz wirtschaftlicher Rechte anderer
- 2.3.8.5.3 5.3 Achtung des geistigen Eigentums
- 2.3.8.5.4 5.4. Verpflichtung gegenüber gesellschaftlichem Eigentum
- 2.3.8.5.5 5.5. Beachtung der ökologischen Verträglichkeit
- 2.3.8.5.6 5.6. Aufbau einer weltweiten sozialen Gerechtigkeit
- 2.3.8.5.7 5.7. Begrenzung des Wachstums der Weltbevölkerung
- 2.3.8.6 6. Christlich verantwortete Wirtschaftsordnung
- 2.3.9 VIII. Achtes Gebot: Du sollst kein falsches Zeugnis geben wider deinen Nächsten
- 2.3.9.1 1. Wahrheit und Wahrhaftigkeit in der Weisung des achten Gebotes
- 2.3.9.2 2. Die Dimensionen der Wahrheit und Wahrhaftigkeit
- 2.3.9.3 3. Wahrhaftigkeit und Treue zum gegebenen Wort
- 2.3.9.4 4. Wahrhaftigkeit im zwischenmenschlichen Bereich
- 2.3.9.5 5. Wahrheit in der Öffentlichkeit
- 2.3.9.5.1 5.1. Meinungsbildung in der Öffentlichkeit
- 2.3.9.5.2 5.2. Wahrheitserkenntnis durch Wissen und Bildung
- 2.3.9.5.3 5.3. Dienst an der Wahrheit in Wissenschaft und Technik
- 2.3.9.5.4 5.4. Wahrhaftigkeit im politischen Leben
- 2.3.9.5.5 5.5. Rede- und Pressefreiheit, Freiheit der Kunst
- 2.3.9.5.6 5.6. Reklame und Werbung
- 2.3.9.5.7 5.7. Datenerfassung und Datenschutz
- 2.4 Abkürzungsverzeichnis
- 2.5 Weblinks
Erster Band: Das Glaubensbekenntnis der Kirche
Vorwort
"Die Katechese wurde von der Kirche immer als eine ihrer wichtigsten Aufgaben betrachtet." Mit diesen Worten beginnt Papst Johannes Paul II. sein Apostolisches Schreiben. "Catechesi tradendae", das er als Frucht der Bischofssynode von 1977 veröffentlicht hat. Die große Bedeutung der katechetischen Unterweisung gründet im Auftrag des auferstandenen Herrn: "Geht zu allen Völkern, und macht alle Menschen zu meinen Jüngern: tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe" (Mt 28,19-20).
Die Kirche erfüllt den Auftrag des Herrn in der Evangelisierung, durch welche die Menschen zum Glauben geführt werden, und in der Katechese, durch die der anfanghafte Glaube gestärkt wird und reift, indem die Jünger Christi zu einer vertieften Einsicht in das Geheimnis der Person Jesu Christi und seiner Botschaft geführt werden.
In der Nachfolge der Apostel tragen wir Bischöfe eine besondere Verantwortung für die Verkündigung des Wortes Gottes. Unsere Zeit, in der mancher in seinem Gluauben verunsichert wurde oder ihn nicht mehr richtig kennt, fordert zu verstärkten Anstrengungen in der Glaubensunterweisung heraus. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, gibt die Deutsche Bischofskonferenz den vorliegenden Katechismus heraus, der den katholischen Gluauben verläßlich darstellt und von ihrer Autorität getragen ist.
Auf der Grundlage des Großen Glaubensbekenntnisses, das den Christen des Ostens und des Westens gemeinsam ist, entfaltet der Katechismus das Christusgeheimnis, um es den Menschen unserer Zeit tiefer zu erschließen. Dadurch soll der Glaube in unseren Diözesen gestärkt, die lebendige Verbundenheit der Gläubigen mit Jesus Christus vertieft und diesen eine Hilfe gegeben werden, als Christen in der Welt zu leben.
Die Deutsche Bischofskonferenz hat auf ihrer Frühjahrs-Vollversammlung vom 12.-15. März 1984 in Altötting beschlossen, den vorliegenden Text, der die Glaubenslehre der Kirche darlegt, gemäß can. 775 § 2 CIC als Katholischen Erwachsenen-Katechismus (Teil I) herauszugeben. In einem zweiten Teil soll die kirchliche Sittenlehre dargestellt werden. Der Apostolische Stuhl hat mit Schreiben der Kleruskongregation vom 22. Dezember 1984 die Herausgabe und Verbreitung des Katechismus "Das Glaubensbekenntnis der Kirche" durch die Deutsche Bischofskonferenz gemäß can. 775 § 2 CIC genehmigt.
Ich danke der Katechismuskommission, die den Text erarbeitet hat. Mein besonderer Dank gilt Herrn Professor Dr. Walter Kasper, der bei der Erstellung des Textes die Hauptlast getragen hat.
Die deutschen Bischöfe übergeben diesen Katechismus der Öffentlichkeit, insbesondere denen, die im Diest der Kirche mit der Verkündigung des Wortes Gottes und der Glaubensunterweisung beauftagt sind. Möge der neue Katechismus eine Erneuerung der Katechese bewirken und dadurch zur Erneuerung der Kirche, zu einer neuen Blüte des Glaubens in unseren Diözesen beitragen.
Köln, am Hochfest der Auferstehung Jesu Christi 1985
Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz
Das Große Glaubensbekenntnis der Kirche
Wir glauben an den einen Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
der alles geschaffen hat, Himmel und Erde,
die sichtbare und die unsichtbare Welt.
Und an den einen Herrn Jesus Christus,
Gottes eingeborenen Sohn,
aus dem Vater geboren vor aller Zeit:
Gott von Gott, Licht vom Licht,
wahrer Gott vom wahren Gott,
gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater;
durch ihn ist alles geschaffen.
Für uns Menschen und zu unserem Heil
ist er vom Himmel gekommen,
hat Fleisch angenommen
durch den Heiligen Geist
von der Jungfrau Maria
und ist Mensch geworden.
Er wurde für uns gekreuzigt
unter Pontius Pilatus,
hat gelitten und ist begraben worden,
ist am dritten Tage auferstanden
nach der Schrift
und aufgefahren in den Himmel.
Er sitzt zur Rechten des Vaters
und wird wiederkommen in Herrlichkeit,
zu richten die Lebenden und die Toten;
seiner Herrschaft wird kein Ende sein.
Wir glauben an den Heiligen Geist,
der Herr ist und lebendig macht,
der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht,
der mit dem Vater und dem Sohn
angebetet und verherrlicht wird,
der gesprochen hat durch die Propheten,
und die eine, heilige, katholische
und apostolische Kirche.
Wir bekennen die Taufe
zur Vergebung der Sünden.
Wir erwarten die Auferstehung der Toten
und das Leben der kommenden Welt. Amen.
Erster Teil: Gott der Vater
I. Ich glaube - Hilf meinem Unglauben
1. Der Mensch - ein Geheimnis
Das Glaubensbekenntnis der Kirche beginnt mit den beiden Wörtchen "Ich glaube". Zwei kurze Wörter nur und doch überaus inhaltsschwer. Die beiden Wörter "Ich glaube" entscheiden über unser ganzes Leben. Denn wer bin ich? Woher, warum, wozu bin ich? Kann ich wirklich glauben, d. h. Vertrauen haben? Was soll ich glauben, und wem darf ich glauben und vertrauen? Vielleicht möchte ich gerne glauben, aber ist nicht eher Grund zu Mißtrauen? Überkommt uns nicht oft genug die Angst? Haben wir nicht Anlaß zu skeptischer Zurückhaltung? Kann man sich in seinem Glauben auf eine bestimmte Religion oder Konfession festlegen? Darf ich mit dem Großen Glaubensbekenntnis der Kirche auch sagen: "Wir glauben"?
Unser Leben fließt dahin, Tag für Tag, Woche für Woche. Normalerweise hat alles seinen Platz und seine Ordnung. Bis eines Tages die Frage aufbricht: Wozu eigentlich das Ganze? Adam, wo bist du?"
Schon ein kleines Kind, das zum Bewußtsein erwacht, stellt den Erwachsenen Fragen über Fragen. Was ist? Warum ist? Wozu ist? Die Eltern wissen oft selbst keine rechte Antwort und spüren, daß vieles, was ihnen bisher selbstverständlich vorkam, es in Wirklichkeit gar nicht ist. Im Jugendalter beginnen Menschen ihr eigenes Ich zu entdecken. Sie wollen ihr Leben nunmehr selbst gestalten. Unter Protest stellen sie die Welt der Erwachsenen in Frage. Viele Eltern fühlen sich durch die Kritik ihrer heranwachsenden Kinder selbst in Frage gestellt. So kommt es zum Wechsel der Generationen. Jede Generation und erst recht jede geschichtliche Epoche hat ihre Art, die Dinge zu sehen und entwickelt ihren Stil des Lebens. Wir erleben diesen Umbruch heute besonders deutlich. Was bleibt? Was können wir weitergeben? Woran können wir uns orientieren? Wo finden wir Halt, wo einen endgültigen Sinn für unser Leben?
Die Frage nach dem Sinn unseres Lebens stellt sich für jeden Menschen anders. Sie kann auftauchen als Frage nach dem Glück. Wir erfahren Glück auf unterschiedlichste Weise: wenn uns unsere Arbeit gelingt, wenn wir Erfolg haben, im Zusammensein mit einem geliebten Menschen, in der guten Tat und im Einsatz für andere, in Sport und Spiel, Kunst und Wissenschaft. Wir wissen, daß wir das Glück nicht machen können. Es kann sehr schnell wieder verfliegen. Herbe Enttäuschungen können sich einstellen. Was dann? Welchen Sinn hat dann das Leben? Was ist überhaupt echtes menschliches Glück? Noch intensiver stellt sich die Frage nach dem Sinn des Daseins in der Erfahrung von Leid, sei es eigenes oder fremdes Leid: unheilbare Krankheit, Kummer, Einsamkeit, Not. Welchen Sinn hat es, daß so viele Menschen unverschuldet leiden? Warum ist so viel Hunger, Elend, Ungerechtigkeit in der Welt? Warum so viel Haß, Neid, Lüge und Gewalt? Schließlich die Erfahrung des Todes, etwa wenn ein Freund, ein Bekannter oder Verwandter auf einmal nicht mehr unter uns ist oder wenn wir mit dem Gedanken an den eigenen Tod konfrontiert werden. Was ist nach dem Tod? Woher komme ich, wohin gehe ich? Was bleibt von dem, wofür ich mich eingesetzt habe?
Unsere Antworten auf diese Fragen gehen nie ganz auf. Der Mensch bleibt sich letztlich eine Frage und ein tiefes Geheimnis. Das ist seine Größe und sein Elend. Seine Größe, weil die Frage nach sich selbst den Menschen von den toten Dingen unterscheidet, die einfach vorhanden sind, wie auch von den Tieren, die durch ihre Instinkte fest in ihre Umwelt eingepaßt sind. Es macht die Würde des Menschen aus, daß er sich seiner selbst bewußt und daß er frei ist, seinem Leben selbst eine Richtung zu geben. Diese Größe ist zugleich die Last des Menschseins. Dem Menschen ist sein Leben nicht nur gegeben, sondern auch aufgegeben; er muß es selbst gestalten, selbst in die Hand nehmen. Dem Sein des Menschen ist der Sinn seines Seins nicht unmittelbar mitgegeben. Das Menschsein ist deshalb ein Gang ins Offene und ins Unabsehbare hinein. ?
Wir können die Frage nach dem Sinn verdrängen, vor ihr davonlaufen oder sie als unbeantwortbar abtun. Dazu gibt es viele Möglichkeiten: Flucht in die Arbeit, in den Betrieb, in den Konsum, in die Sexualität, ins Vergnügen, in den Alkohol und in den Gebrauch von Drogen. Doch damit betrügen wir uns nur selbst. Mit solchen Fluchtversuchen laufen wir uns selbst davon. Das Menschsein ist eine Frage, sie gehört zu unserer Würde als Menschen. Würden wir die Frage nach uns selbst nicht mehr stellen, hätten wir uns zurückentwickelt zu einem findigen Tier. So stellt sich unausweichlich die Frage: Was ist der Mensch? Wer bin ich? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Es ist die alte Katechismusfrage, alt und doch immer wieder neu: Wozu sind wir auf Erden?
2. Vorläufige Antworten
2.1 Wissenschaft
Viele erwarten die Antwort auf ihre Fragen von den modernen Wissenschaften. Die Fortschritte, die durch die modernen Wissenschaften erzielt wurden, sind unbestreitbar. Sie bieten ein durch Begründungen abgesichertes, methodisch nachgewiesenes, logisch zusammenhängendes Wissen. Sie konnten viele Fragen lösen, auf die frühere Jahrhunderte nur unvollkommene oder gar keine Antworten hatten. Wir wissen heute unendlich viel mehr, etwa über das Werden der Welt, das Entstehen des Lebens, über die Gesetzmäßigkeiten, welche die Wirklichkeit der Natur und des Menschen bestimmen und die Beziehungen der Menschen untereinander regeln. Dieses Wissen war die Voraussetzung, um mit Hilfe der modernen Technik das menschliche Leben in vielfacher Weise angenehmer zu gestalten als in früheren Zeiten. Es gelang durch Maschinen, dem Menschen die Arbeit zu erleichtern, viele Krankheiten auszurotten oder heilbar zu machen, die durchschnittliche Lebenserwartung erheblich zu erhöhen und vieles andere mehr. In den letzten 200 Jahren hat die Menschheit durch Wissenschaft und Technik mehr Veränderungen erlebt als in Jahrtausenden zuvor.
Die Vorteile und Fortschritte sind unbestreitbar. Immer mehr geht uns aber auch die Kehrseite des Fortschritts auf. Wissenschaft und Technik helfen uns nicht nur, Probleme zu lösen, sie schaffen zugleich neue Probleme: Zerstörung unserer Umwelt, Verkümmerung und Entpersönlichung der zwischenmenschlichen Beziehungen, immer atemberaubenderes Tempo und damit wachsende körperliche und seelische Überforderung Der Fortschritt ist ambivalent. Er erweitert nicht nur die Möglichkeiten zum Guten, er gibt auch neue Möglichkeiten zur Zerstörung, bis hin zu der Möglichkeit, alles Leben auf der Erde auszulöschen. Unsere modernen Möglichkeiten, die Natur zu beherrschen, geben uns auch die Mittel in die Hand, Menschen zu beherrschen und zu manipulieren, sei es durch nackte Gewalt, sei es durch sublime Methoden der Propaganda oder durch einseitige Auswahl der Informationen. Immer deutlicher stellt sich uns deshalb die Frage: Dürfen wir alles tun, was wir tun können? Offensichtlich ist das nicht der Fall. Wir müssen unsere wissenschaftlichen und technischen Mittel für humane Ziele einsetzen. Doch was sind humane Ziele? Wissen wir bei dem vielen, das wir heute wissen, auch das menschlich wirklich Wissenswerte, oder ist die Vielfalt des Wissens und der Wissensgebiete nicht auch verwirrend?
Damit kommen wir auf unsere Ausgangsfrage zurück: Was ist der Mensch? Auf diese Frage können uns vor allem die auf den Menschen bezogenen modernen Wissenschaften (Humanwissenschaften) im einzelnen viel Hilfreiches sagen. Die moderne Psychologie und Soziologie können helfen, zahlreiche Störungen im Leben des einzelnen und im menschlichen Zusammenleben abzubauen und das Leben menschlich sinnvoller und erfüllter zu gestalten. Aber die Antwort auf die Frage nach dem letzten Sinn des Menschen übersteigt die Möglichkeiten auch dieser Wissenschaften. ?
Die modernen Wissenschaften können ganz allgemein mit Hilfe ihrer exakten Methoden zwar viele Einzelaspekte klären; durch ihre Methoden sind ihnen aber auch Grenzen gesetzt. Es gibt Bereiche der Wirklichkeit, die sich dem Zugriff dieser Methoden entziehen. Sie können vor allem nichts über den letzten Sinn und Grund der Wirklichkeit im ganzen sagen. So stellt sich uns heute angesichts der positiven Möglichkeiten wie auch der Grenzen und Gefahren, die uns die modernen Wissenschaften gebracht haben, die Frage: Was ist der Mensch? dringlicher als je zuvor.
2.2 Weltanschauungen
Im Unterschied zu den modernen Wissenschaften suchen die Weltanschauungen, dem Menschen ein umfassendes Bild und eine Gesamtdeutung der Wirklichkeit zu vermitteln. Sie beanspruchen meist, daß ihre Zusammenschau dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis entspricht und "überholte" christliche Glaubensvorstellungen überbietet. Sie entsprechen damit dem Bedürfnis des Menschen, sich selbst und die Welt zu verstehen. Deshalb leiten sie alles aus einem einzigen Prinzip ab. Entweder aus der Materie (materialistische Weltanschauung) oder aus dem Geist, der alles durchdringt und sich in allem versinnbildlicht (Spiritualismus, etwa in der Anthroposophie). Ihr Anspruch, eine Gesamtschau zu leisten, führt sie dazu, meist unterschiedlichste Elemente der Religionen, auch christliche Elemente, aufzugreifen und miteinander zu vermischen (Synkretismus = Religionsmischung).
Eine solche Einheitsschau wird freilich weder der Vielfalt der Phänomene, noch der Abgründigkeit des Geheimnisses des Menschen und der Welt gerecht. Wer alles aus einem Prinzip ableiten möchte, wird leicht totalitär und intolerant. Der Anspruch solcher Weltanschauungen auf Wissenschaftlichkeit muß verneint werden, da die Wissenschaft immer nur Einzelfragen beantworten und einzelne Wissensgebiete systematisch behandeln kann. Sie gelangt nie zu einem fertigen Weltbild, sondern muß sich stets offen halten für neue Einsichten und Fragen. Der christliche Glaube enthält zwar wesentliche Elemente einer Weltanschauung, aber er ist keine Weltanschauung im strengen Sinn. Er weiß, daß wir in diesem Leben nur stückweise und umrißhaft erkennen können (vgl. 1 Kor 13,12). Die Weltanschauungen wollen im Grunde zuviel leisten und leisten damit zuwenig.
Von besonderer Bedeutung sind heute die politischen Weltanschauungen. Es geht ja in allen genannten Fragen nach dem Sinn nicht nur um den Sinn unseres persönlichen Lebens, sondern auch um unser gemeinschaftliches Leben. Keiner lebt für sich allein, sondern mit anderen, für andere und von anderen. Jeder ist auf jeden angewiesen, jeder ist auch von jedem abhängig. Die Antwort auf die Frage nach dem Sinn unseres persönlichen Lebens steht deshalb in engem Zusammenhang mit der Verwirklichung einer freiheitlichen, gerechten politischen Ordnung für alle. Rückzug ins private Glück wäre eine Illusion. Politische Verantwortung und politischer Einsatz sind von jedem gefordert. Die Frage ist deshalb: Wie können wir unser gemeinschaftliches Leben menschlich organisieren und gestalten? Wie können wir erreichen, daß in unserer Gesellschaft nicht die Macht des Stärkeren, nackte Gewalt, Neid und Haß, sondern Menschenwürde, Wahrheit, Freiheit, Gerechtigkeit, Friede herrschen? Wie ist eine Versöhnung zwischen den unterschiedlichen Interessen der Menschen, der Völker, der Rassen und Klassen möglich?
Das Anliegen der politischen Weltanschauungen und die Bedeutung des politischen Einsatzes für die Verbesserung der menschlichen Lebensbedingungen sind unbestreitbar. Sie versagen freilich, wenn sie eine Letztantwort zu geben beanspruchen. Sowenig wie die Materie oder den Geist kann man die Gesellschaft zum ein und alles machen. Die Frage nach dem persönlichen Glück, dem persönlichen Tod läßt sich nicht verschieben, bis einmal eine vollkommene und gerechte Ordnung bestehen wird. In dieser Welt läßt sich ohnedies keine vollkommene Gerechtigkeit verwirklichen, lediglich Versuche sind möglich, sich ihr mehr oder weniger anzunähern. Solange nämlich der einzelne nicht im Heil ist, kann es keine vollkommene Gesellschaft geben. Solange werden auch in der Gesellschaft Haß, Neid und Widerstreit der Interessen bestehen. Selbst wenn alle politischen Probleme gelöst wären, bliebe noch die Frage nach dem Sinn des eigenen Lebens, der persönlichen Schuld, dem Tod, den jeder einzeln zu bestehen hat. Es wird also immer eine Spannung zwischen dem einzelnen und dem Ganzen bleiben. Der einzelne Mensch mit seinen Bedürfnissen, Sorgen, Freuden und Nöten geht nie im gesellschaftlichen Prozeß auf. Im Gegenteil, die Person des einzelnen ist nicht Ergebnis, sondern Wurzel und Ziel des gesellschaftlichen Prozesses. Das gesellschaftliche Leben muß sich also am Menschen orientieren. So entsteht auch im politischen Bereich erneut die Frage: Was ist der Mensch?
Wir stellen fest: Die Wissenschaften und die politischen Weltanschauungen geben uns je in ihrem Bereich wichtige Antworten auf unsere Frage. Die Frage nach dem Sinn des menschlichen Lebens selbst können sie nicht beantworten. Ohne eine solche Antwort werden sie aber selbst orientierungslos. In dieser Orientierungslosigkeit besteht die Krise unserer Epoche. Die gemeinsamen Wert- und Zielvorstellungen, aus denen vergangene Jahrhunderte gelebt haben, sind für viele fragwürdig geworden. Es fehlt an zündenden Ideen, großen Zukunftsperspektiven, letzten Werten, für die man sich begeistern und für die man Opfer bringen kann. Skepsis und Resignation breiten sich aus. Besonders junge Menschen spüren eine entsetzliche Leere. Produktion, Konsum, Wohlstand allein lösen längst nicht alle Probleme. Der Mensch braucht zwar Brot zum Leben, und es ist ein Ärgernis, daß viele kein oder nicht genügend Brot zum Leben haben, während andere Probleme mit den Folgen ihres Überflusses haben. Aber der Mensch lebt nicht vom Brot allein, auch nicht allein von der Arbeit, vom Vergnügen oder vom Protest. Der Mensch ist mehr. Er braucht Liebe, Sinn und Hoffnung. Er will nicht nur mehr haben, sondern auch mehr sein. So zwingt uns unsere Situation, neu, ursprünglicher und tiefer über Grund und Ziel des Menschseins nachzudenken.ü
3. Religionen und Religionskritik
3.1 Die Antwort der Religionen
Jahrtausendelang gaben die Religionen den Menschen eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn ihres Lebens. Diese Antwort ist nicht primär eine Theorie. Sie drückt sich aus im gesamten Leben, in Riten und Gebräuchen, in Gebeten und Liedern, in Erzählungen, Symbolen, Bildern, Festen, Kunstwerken und Ämtern. Sie wirkt sich aus in der gesamten Lebensgestaltung, in Sittlichkeit und Recht eines Volkes und begleitet das gesamte Leben des einzelnen von der Geburt bis zum Tod. Im einzelnen gibt es sehr verschiedene Religionen. Neben den archaischen Stammesreligionen, wie wir sie bis heute etwa in Afrika finden, gibt es Hochreligionen, die hohe Kulturen hervorgebracht haben (Hinduismus, Buddhismus, Konfuzianismus). Sie sind etwa gleichzeitig mit dem Alten Testament vor allem in Asien entstanden und dort bis heute lebendig. Andere Hochreligionen, wie die der Inka in Amerika, wurden zerstört. Die einzige große nachchristliche Religion ist der Islam, dem wir vor allem in Nordafrika und Vorderasien begegnen. Durch Gastarbeiter, ausländische Studenten u. a. sind diese Religionen heute auch in unserem Bereich vertreten.
So unterschiedlich die Religionen auch sind, sie kommen in einem gemeinsamen Anliegen überein: Sie machen Ernst damit, daß sich der Mensch eine Frage ist, auf die er selber keine Antwort geben kann. In der Religion erfährt sich der Mensch vielmehr ergriffen und getragen von einer höheren und umfassenderen Wirklichkeit, der Wirklichkeit des Heiligen und des Göttlichen. Ihr begegnet er mit Scheu und Ehrfurcht, aber auch mit Vertrauen und Hinneigung. Ihr verdankt er alles. Das gibt ihm Geborgenheit, läßt ihn festen und feiern. Für die Religionen ist also der Mensch und die sichtbare Welt nicht die einzige Wirklichkeit. Welt und Mensch gehören hinein in einen umfassenderen Lebens- und Wirklichkeitszusammenhang. Die sichtbare Welt ist nur wirklich durch Teilhabe an der unsichtbaren Welt des Heiligen und Göttlichen. Die religiösen Erzählungen und Symbolhandlungen sollen diesen bergenden Grund allen Daseins vergegenwärtigen. Oft haben die Religionen freilich auch das Bild Gottes verfälscht und ihm die Fratze des Dämonischen gegeben. Statt Freude und Hoffnung haben sie oft den Menschen Angst eingejagt und sie unfrei gemacht. Dennoch fanden die Menschen in den religiösen Riten über Jahrtausende hinweg die Kraft, um Freud und Leid, Gutes und Böses, Leben und Sterben zu bewältigen, und noch heute geben die Religionen Millionen von Menschen Sinn und Halt, Grund und Ziel für ihr Leben.
3.2 Moderne Religionskritik
Schon in der Vergangenheit hat es immer wieder Menschen gegeben, die den Götterglauben in Frage stellten und die religiöse Praxis kritisierten. Seit der Aufklärung im 18. Jahrhundert hat sich die Religionskritik zunehmend verschärft. Zum Atheismus als Massenphänomen und zu dem Versuch, das gesellschaftliche Leben auf einer religiös neutralen oder gar atheistischen Grundlage aufzubauen, ist es erst seit dem Ende des letzten Jahrhunderts gekommen. Dieser Atheismus der Massen gehört heute zu den ernstesten Gegebenheiten. Dabei geht es nicht nur um den Atheismus der anderen, sondern auch um den Atheismus im eigenen Herzen. Wenn wir ehrlich sind, müssen auch wir Christen zugeben, daß uns die Erfahrung der Abwesenheit Gottes bedrückt, daß wir oft nur noch sein Schweigen vernehmen, daß uns Gott in der Profanität unserer alltäglichen Wirklichkeit kaum mehr erfahrbar ist. Auch wir leben weithin, als ob Gott nicht wäre. Ist er nicht auch oft für uns praktisch tot?
Es waren vielfältige Ursachen, die zu dieser Situation geführt haben. An erster Stelle ist der Zusammenbruch des Weltbildes der Antike und des Mittelalters, das auch in der Bibel vorausgesetzt wird, zu nennen. Seit Kopernikus und Kepler wissen wir: Die Erde ist nicht der kosmische Mittelpunkt der Welt, um den sich alles dreht. Darwin entwickelte im letzten Jahrhundert die Lehre von der Evolution des Lebens, auch des menschlichen Lebens. Damit war die bisherige Vorstellung von der unmittelbaren Erschaffung des Menschen durch Gott für viele erschüttert. Freud entdeckte das Tiefenbewußtsein des Menschen. Die Frage nach der Freiheit und Verantwortlichkeit des Menschen war damit neu gestellt. Immer mehr glaubten die modernen Wissenschaften, die Welt ohne Gott erklären zu können. Gott schien entbehrlich geworden zu sein, die Religion eine inzwischen überholte Bewußtseinsstufe der Menschheit. So glaubte der Mensch, mündig geworden zu sein, um die Welt aus sich selbst erklären und gestalten zu können.
In der Religionskritik meinte der mündig gewordene Mensch auch den Gottesglauben erklären zu können: als Wunschbild und Wunscherfüllung des Menschen (L. Feuerbach, S. Freud), als Ausdruck und Rechtfertigung einer schlechten Welt, als Vertröstung und als Opium des Volkes (K. Marx), als Zeichen des Ressentiments gegen das Leben (F. Nietzsche). Wird Gott so verstanden, dann ist er nicht nur entbehrlich, er ist auch hinderlich für die freie Selbstverwirklichung des Menschen und für die Wahrnehmung seiner Verantwortung in der Welt. So wurde Gott als tot erklärt (F. Nietzsche), nicht nur im Namen der Wissenschaften, sondern auch im Namen des Menschen und seiner Freiheit.
Der moderne Atheismus hat viele Gesichter. Es gibt nach wie vor den kämpferischen Atheismus, der die Religion ausrotten möchte und sich dabei oft nicht nur der geistigen Auseinandersetzung, sondern auch der Mittel der Unterdrückung, Diskriminierung und Verfolgung bedient. In unseren westlichen Gesellschaften dagegen begegnet uns der indifferente Atheismus. Er ist selbst müde und weithin gleichgültig geworden und bekämpft die Religion zumindest nicht mehr offen. Der Gottesglaube ist für ihn überholt; er meint, die letzten Überreste der Religion würden von selbst absterben. Es gibt den platten Atheismus, der nur das annimmt, was man mit den Sinnen wahrnehmen oder mit dem Verstand beweisen kann. Daneben gibt es den Atheismus der Freiheit und Befreiung des Menschen von Abhängigkeiten aller Art, auch der Befreiung von einem allmächtigen und uns übermächtigenden Gott und von einem religiösen "System", das die Freiheit beengt und das Leben unterdrückt. Am wichtigsten ist der Atheismus, der von der Erfahrung des Bösen in der Welt betroffen ist und gegen einen Gott protestiert, der allwissend, allmächtig und gütig sein soll und doch all dieses sinnlose Leiden zuläßt. Die Frage "Warum leide ich?" gilt für viele als der Fels des Atheismus (G. Büchner). Schließlich gibt es den skeptischen und kritischen Atheismus, der gegenüber allen Letztantworten zurückhaltend ist. Für ihn sind religiöse Fragen unbeantwortbar und darum sinn los. Über Gott kann man nach ihm nur schweigen. (Zur Frage des modernen Atheismus vgl. GS 19-20.)
3.3 Religiöse Erneuerung
Was sollen wir zu alledem sagen? Zunächst: Der moderne Atheismus muß für die Religionen, besonders für das Christentum, in dessen Bereich der Atheismus entstanden ist, Anlaß für eine eingehende Gewissenserforschung sein. Der Atheismus ist ja auch eine kritische Reaktion auf ein mißverständliches Gottesbild und auf mangelhafte Verwirklichung des Gottesglaubens im sittlichen und gesellschaftlichen Leben. Oft hat man im Namen Gottes gegen Erkenntnisse der Wissenschaft gekämpft, Kriege geführt, ungerechte Zustände verteidigt, durch Zwangsmaßnahmen die Freiheit mißachtet oder die Religion mißbraucht, um Menschen gefügig zu machen. Der Atheismus kann für die Religionen also auch eine reinigende Funktion haben. Es wird sehr viel davon abhängen, ob sie in Zukunft glaubwürdig machen können, daß Religion und wissenschaftlicher Fortschritt, Gottesglaube und menschliche Freiheit keine Gegensätze darstellen, sondern zusammen bestehen können.
Auf der anderen Seite muß aber auch die durch die modernen Wissenschaften und durch die politischen Weltanschauungen entstandene Krise für die modernen Atheisten zur Gewissensfrage werden. Oft haben sie nur gegen zeitbedingte und heute überholte Formen der Religion, teilweise gar gegen Mißverständnisse und Mißbräuche der Religion protestiert, aber nicht gegen diese selbst. Aber wurden und werden Wissenschaft und Politik nicht ebenfalls oft in grauenhafter Weise mißbraucht? Waren sie in der Lage, die Sinnfrage im persönlichen und im gesellschaftlichen Bereich hinreichend zu beantworten, und sind sie nicht grundsätzlich orientierungslos, wenn sie sich nicht in einen umfassenderen Sinnzusammenhang, wie ihn allein die Religionen zum Ausdruck bringen, einordnen? Gibt es denn eine realistische Alternative?
Gegenwärtig zeigt sich in allen Teilen der Welt ein Wiedererwachen religiöser Fragen. In Situationen der Unterdrückung und der Verfolgung ist die Religion oft der letzte Hort der Freiheit. Wo keine Religion ist, da schaffen sich die Menschen oft Ersatzreligionen. Das zeigt, daß die Religionen heute alles andere als am Absterben sind. Religion gehört offenbar zum Menschen, der sich eine Frage ist, auf die er selbst keine Antwort geben kann. Die Antwort der Religionen sollte darum nicht zu schnell abgetan werden. Sie gibt nach wie vor zu denken. Sie könnte - hindurchgegangen durch das läuternde Feuer des Atheismus - in der gegenwärtigen Krise der Menschheit das eine und im Letzten einzig Notwendige und das die Not Wendende sein.
4. Wege der Gotteserkenntnis
4.1 Der Weg ist der Mensch
Die Religionen haben das Bild Gottes wie das Bild des Menschen oft verstellt und verfälscht. In den Religionen der Menschheitsgeschichte steckt aber auch eine tiefe Wahrheit. Sie sagen uns etwas bleibend Gültiges über unser Menschsein. Sie machen Ernst mit der Endlichkeit des Menschen. Diese zeigt sich darin, daß wir als Menschen mit all unseren Fragen nie an ein Ende kommen können. Jede Antwort löst neue Fragen aus. Wir müssen immer wieder umlernen. Unser Nichtwissen ist jeweils größer als unser Wissen. Auch bei unserer Suche nach dem Glück können wir nie ganz erfüllt werden. Es gibt zwar Augenblicke, in denen wir uns ganz erfüllt fühlen. Wir möchten sprechen: "Verweile doch, du bist so schön". Aber bald stellt sich heraus, daß auch solche Augenblicke nur ein Versprechen sind, das nie voll eingelöst werden kann. Nichts in dieser Welt kann mein Alles sein. Denn alles, was uns begegnet, ist endlich und begrenzt, unvollkommen und vergänglich. Auch die Bibel kennt diese Erfahrung. Im Buch Kohelet (Prediger) im Alten Testament lesen wir:
- "Windhauch, Windhauch, das ist alles Windhauch. Welchen Vorteil hat der Mensch von all seinem Besitz, für den er sich anstrengt unter der Sonne?
- Eine Generation geht, eine andere kommt..." (1,2-4)
- "Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit: eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben, eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Abernten der Pflanzen..., eine Zeit zum Weinen, eine Zeit für die Klage und eine Zeit für den Tanz..." (3,1-2.4)
- "Denn jeder Mensch unterliegt dem Geschick, und auch die Tiere unterliegen dem Geschick. Sie haben ein und dasselbe Geschick. Wie diese sterben, so sterben jene ... Beide sind aus Staub entstanden, beide kehren zum Staub zurück." (3,19-20)
Im Menschen meldet sich neben der Erfahrung seiner Endlichkeit auch die Erfahrung von etwas Unbedingtem. Trotz der Erfahrung unserer Endlichkeit hören wir Menschen nämlich nicht auf zu arbeiten, zu streben und dem Glück nachzujagen. Offenbar meinen wir dabei mehr als die vergänglichen Erfahrungen irdischen Glücks. Unser Streben geht weiter, es zielt auf etwas, was unser Alles sein kann. Es geht auf das Ganze. So streben wir über alles Erfahrbare und Erreichbare hinaus, sind ständig unterwegs, nie fertig, haben immer Hunger und Durst nach mehr Wahrheit, mehr "Gerechtigkeit und mehr Glück. Die Erfüllung dieser unstillbaren Sehnsucht nach einer letzten Erfüllung, nach vollendeter Gerechtigkeit und untrüglicher Wahrheit kann sich der Mensch nicht selbst geben. Wollte er es versuchen, dann wäre dies eitel. Er würde dann verkennen, daß er selbst endlich, schwach, unvollkommen ist. So übersteigt der Mensch den Menschen um ein Unendliches (B. Pascal).
Das Leben des Menschen ist ein Weg, ein Weg in ein Geheimnis hinein. Es ist die Grundüberzeugung aller Religionen wie der Bibel: Das Geheimnis des Menschen grenzt an ein noch tieferes und noch größeres Geheimnis, das wir in der Sprache der Religionen wie der Bibel Gott nennen. Doch wie können wir Gott erfahren und erkennen?
4.2 Wege der Gotteserkenntnis in der Menschheitsgeschichte
Die religiösen Menschen aller Jahrtausende glaubten in der Wirklichkeit der Welt Zeichen und Spuren des Göttlichen zu entdecken. In außerordentlichen, schauer- und staunenerregenden Naturphänomenen, etwa in Blitz und Donner, in der unversieglichen Fruchtbarkeit der Natur, aber auch in der Faszination bei der Begegnung zwischen Mann und Frau, in der Stimme des Gewissens erkannten sie ein göttliches Geheimnis. Später waren es nicht mehr so sehr die außerordentlichen Erfahrungen, die Ver-wunderung erregten, sondern die durchge
hende und beständige Ordnung der Natur, ihre Schönheit und Pracht, ihre Regelmäßigkeit und Harmonie. Wie sollte man sie anders erklären als durch einen alles ordnenden göttlichen Geist? So war die religiöse Überlieferung für große Denker schon sehr früh ein Anlaß, um tiefer über die Wirklichkeit nachzudenken, nach Ursprung und Grund der Welt zu fragen und dabei auf Gott zu stoßen.
Etwa vom 6. vorchristlichen Jahrhundert an begegnen uns in unserer abendländischen Kultur Denker, welche die religiöse Erfahrung und Überlieferung kritisch reflektierten und auf dem Weg des Denkens Gott zu erkennen suchten. Platon sprach von der Idee des Guten, Aristoteles vom unbewegten Beweger, Plotin vom Einen und Übereinen. Etwa gleichzeitig entstanden im asiatischen Kulturraum große religiös-philosophische Denksysteme. Auch viele neuzeitliche Philosophen suchten Gott denkend zu begreifen.
Der Gott der Philosophen ist freilich nicht unmittelbar der lebendige und persönliche Gott, den uns die Bibel bezeugt, sondern ein Weltgrund, ein Unbedingtes und Absolutes, das man nicht mit einem persönlichen Namen, sondern nur mit abstrakten Begriffen benennen kann. Zum Gott der Philosophen kann man nicht beten. Dennoch kommt dem philosophischen Bedenken Gottes als letztem Grund der Wirklichkeit eine wichtige Funktion zu. Es kann Verstehenszugänge zum Glauben erschließen und aufzeigen, daß der Glaube an Gott, so sehr er das reine Denken übersteigt, doch nicht unvernünftig ist.
4.3 Gotteserkenntnis in der Bibel
Die Bibel führt nirgends einen Gottesbeweis. Sie erkennt Gott aus seinen geschichtlichen Offenbarungen an Abraham, Isaak und Jakob, aus seinem Handeln durch Mose beim Auszug aus Ägypten und beim Zug durch die Wüste, aus seinem Sprechen bei den Propheten, abschließend und zusammenfassend in Jesus Christus, der das Bild Gottes für die Menschen ist. Die Bibel spricht also vom lebendigen und persönlichen Gott, der den Menschen hilfreich nahe ist, zu dem wir rufen und schreien können in jeder Not, der aber auch uns ruft und beruft. Im Glauben an den Gott der Menschen entdeckt aber auch die Bibel Spuren Gottes in der Welt. Sie erkennt in der ganzen Welt einen Abglanz der Herrlichkeit Gottes: "Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde; über den Himmel breitest du deine Hoheit aus." (Ps 8,2)
"Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes, vom Werk seiner Hände kündet das Firmament." (Ps 19,2) In besonderer Weise ist für die Bibel der Mensch nach dem Abbild Gottes geschaffen (vgl. Gen 1,27). Schon äußerlich zeichnet er sich aus durch seine aufrechte, über alle anderen Wesen erhobene Gestalt; vor allem durch seine Freiheit und Verantwortung ist er Abglanz von Gottes Herrlichkeit und Herrscherlichkeit. Weil er Ebenbild Gottes ist, kommt ihm unantastbare Würde zu.
Selbstverständlich weiß auch die Bibel um die Möglichkeit, Gott zu leugnen. Sie bezeichnet diese Möglichkeit als Torheit. "Die Toren sagen in ihrem Herzen: ,Es gibt keinen Gott'." (Ps 53,2) Der Tor, von dem hier die Rede ist, ist kein dummer Mensch, sondern ein frecher und böser Mensch. Er macht sich nichts aus Gott, will ihn nicht kennen, fürchtet sich nicht vor seinem Gericht. Er spricht und handelt, als ob es Gott nicht gäbe, als ob er selbst Gott wäre. Er ist hochmütig, verachtet die Wahrheit und tritt die Gerechtigkeit mit Füßen. Er handelt ganz so, wie es ihm gefällt. Ein solcher praktischer Atheismus ist töricht. Denn kein Mensch kann Gott entfliehen; Gott kann niemand entgehen.
- "Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir.
Von fern erkennst du meine Gedanken ... Du umschließt mich von allen Seiten und legst deine Hand auf mich ... Wohin könnte ich fliehen vor deinem Geist, wohin mich vor deinem Angesicht flüchten?" (Ps 139,1-2.5.7)
Diesen Gott, der alles in allem wirkt, zu leugnen und zu tun, als ob er nicht wäre, kann die Bibel nur als furchtbare Selbstverschließung und als Ausdruck eines verkehrten Herzens verstehen. Daß Menschen so "töricht" sein können, vermag die Bibel nur als Zeichen von Verblendung zu sehen.
In den späteren Schriften des Alten Testaments finden sich bereits ausführliche Überlegungen über die Möglichkeit, Gott Zu erkennen, und über das Törichte, ihn zu leugnen:
"Töricht waren von Natur alle Menschen, denen die Gotteserkenntnis fehlte. Sie hatten die Welt in ihrer Vollkommenheit vor Augen, ohne den wahrhaft Seienden erkennen zu können. Beim Anblick der Werke erkannten sie den Meister nicht... Und wenn sie über ihre Macht und ihre Kraft in Staunen gerieten, dann hätten sie auch erkennen sollen, wieviel mächtiger jener ist, der sie geschaffen hat; denn von der Größe und Schönheit der Geschöpfe läßt sich auf ihren Schöpfer schließen." (Weish 13,1.4-5)
Das Neue Testament nimmt diese Gedanken auf. Es geht ihm um ein missionarisches Anliegen. Als nämlich die junge Kirche den Schritt von den Juden zu den Heiden wagte, konnte sie nicht mehr ohne weiteres bei der geschichtlichen Offenbarung im Alten Bund ansetzen, sie mußte vielmehr anknüpfen bei der Gotteserkenntnis der Heiden aus der Natur, der Geschichte und dem Gewissen. So heißt es in der Rede des Paulus zu den Weisen auf dem Areopag in Athen:
- Die Menschen "sollten Gott suchen, ob sie ihn ertasten und finden könnten; denn keinem von uns ist er fern. Denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir..." (Apg 17,27-28; vgl. 14,17)
Paulus ist im Römerbrief gegenüber der Gotteserkenntnis der Heiden kritisch, ja, er klagt sie sogar an. Wie in der Weisheitsliteratur spricht er allen Menschen die Fähigkeit zu, Gott aus den Werken der Schöpfung zu erkennen; aber weil sie die erkannte Wahrheit niederhielten und trotz ihrer Gotteserkenntnis Gott nicht, wie es ihm gebührt, verehrten, zieht er sie zur Rechenschaft und hält sie für unentschuldbar.
"Denn was man von Gott erkennen kann, ist ihnen offenbar; Gott hat es ihnen offenbart. Seit Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht und Gottheit. Daher sind sie unentschuldbar." (Röm 1,19-20)
Paulus denkt nicht nur an die äußere Natur, sondern auch an die innere Stimme des Gewissens (vgl. Röm 2,14-15). Könnten die Heiden in keiner Weise etwas von Gott wissen, und gäben sie nicht auch noch in ihren Verkehrungen Zeugnis von Gott, müßte ihnen die christliche Verkündigung gänzlich unverständlich sein; die Predigt von Gottes Handeln in Jesus Christus wäre dann ein Schwall von Worten ohne verständlichen Sinn, der christliche Glaube etwas dem Menschen völlig Fremdes und Unvollziehbares. Nur weil der Mensch auf Gott hin erschaffen ist, kann er durch das christliche Zeugnis auf Gott hin angesprochen werden.
4.4 Die Lehre der Kirche von der natürlichen Gotteserkenntnis
Das I. Vatikanische Konzil (1869/70) hat das biblische Zeugnis von der Erkennbarkeit Gottes folgendermaßen zusammengefaßt:
- "Gott, aller Dinge Grund und Ziel, kann mit dem natürlichen Licht der menschlichen Vernunft aus den geschaffenen Dingen mit Gewißheit erkannt werden." (DS 3004; NR 27)
Auch das Konzil wußte um die Schwierigkeiten, in der gegenwärtigen Lage des Menschengeschlechts Gott zu erkennen. Deshalb lehrt es nicht, daß alle Menschen Gott mit Sicherheit erkennen, ja, es sagt nicht einmal, daß es jemals Menschen gegeben hat, die Gott ganz ohne die Hilfe von Offenbarung mit letzter Gewißheit erkannt haben. Es erklärt nur, daß man Gott mit Hilfe der Vernunft aus der Welt erkennen kann. Das Konzil wollte damit festhalten, daß man jeden Menschen auf Gott hin ansprechen kann, so daß der christliche Glaube nichts Unvernünftiges oder gar Widervernünftiges ist. Glauben und Denken bilden keinen Gegensatz, weil wir im Glauben an die Offenbarung demselben Gott begegnen, auf den wir im Bedenken der Wirklichkeit als Schöpfer der Welt stoßen. Der Glaubende darf also darauf vertrauen, daß sich sein Glaube in der menschlichen Erfahrung und im Denken immer wieder neu bewährt.
Das II. Vatikanische Konzil (1962-1965) hat die Lehre des I. Vatikanischen Konzils aufgegriffen und in Auseinandersetzung mit dem modernen Atheismus konkretisiert und weitergeführt. Das Konzil geht davon aus, daß man den Menschen nur von seinem Ursprung und Ziel in Gott her verstehen kann:
- "Die Kirche hält daran fest, daß die Anerkennung Gottes der Würde des Menschen keineswegs widerstreitet, da diese Würde eben in Gott selbst gründet und vollendet wird ... Wenn dagegen das göttliche Fundament und die Hoffnung auf das ewige Leben schwinden, wird die Würde des Menschen aufs schwerste verletzt, wie sich heute oft bestätigt, und die Rätsel von Leben und Tod, Schuld und Schmerz bleiben ohne Lösung, so daß die Menschen nicht selten in Verzweiflung stürzen." (GS 21)
Atheismus verfehlt letztlich nicht nur die Wahrheit Gottes, sondern auch die des Menschen. Deshalb wird er vom Konzil mit Entschiedenheit verurteilt. Nur durch das Geheimnis Gottes erhält das Geheimnis unseres Menschseins eine Antwort, die das Geheimnis nicht auflöst, sondern annimmt und vertieft. Nur wer Gott kennt, kennt auch den Menschen (R. Guardini).
4.5 Gottesbeweise?
Um die Vernunftgemäßheit des Glaubens an Gott aufzuweisen, entwickelte die Theologie sogenannte Gottesbeweise. Selbstverständlich handelt es sich dabei nicht um Beweise, wie sie uns aus der Naturwissenschaft oder aus der Mathematik geläufig sind. Gott ist kein Sachverhalt, der allgemeiner Nachprüfung offensteht. Man kann aber einladen, einen Weg des Denkens mitzugehen. Thomas von Aquin, einer der größten Theologen des Mittelalters, der diese Gottesbeweise besonders ausgebildet hat, spricht nicht umsonst von "Wegen". Einen Weg muß man gehen, damit sich eine Landschaft erschließt. So muß man auch auf den Wegen der Gotteserkenntnis bereit sein, seine Vorurteile abzulegen und sich dem Geheimnis Gottes zu öffnen. Dann kann deutlich werden, daß der Glaube an Gott nicht unvernünftig ist, sondern durchaus dem Geheimnis, das sich in der Vernunft des Menschen andeutet, entspricht.
Wir könnten freilich nicht nach Gott fragen, wenn wir von Gott noch nie etwas gehört hätten, wenn wir von seiner Wirklichkeit nicht im Innern berührt wären, wenn uns noch keinerlei Erfahrung Gottes zuteil geworden wäre. Die Gottesbeweise sollen also den Glauben nicht durch Wissen ersetzen, sondern umgekehrt gerade zum Glauben einladen, im Glauben bestärken und Rechenschaft vom Glauben geben. Sie entsprechen der Mahnung der Schrift: "Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt" (1 Petr 3,15).
Die erste, ältere Form der Gottesbeweise verweist auf die Wirklichkeit der Welt. Sie ist in steter Bewegung und in dauerndem Wandel. Alles, was sich bewegt, wird von einem anderen bewegt. Dabei herrscht durchaus Ordnung in der Welt. Woher ist alles? Woher insbesondere diese Ordnung? Man kann immer weiter zurückfragen. Eine Ursache bewirkt die andere, alles ist durch alles bedingt. Doch dabei kann man nicht ins Unendliche gehen. Irgendwo muß eine erste Ursache, ein erster Anfang der Bewegung und Veränderung sein. Man mag auf ein Uratom oder eine Urzelle des Lebens verweisen. Doch das genügt nicht. Denn woher ist dieser Anfang, und woher hat er die ungeheure Energie, die gesamte weitere Entwicklung aus sich zu entlassen? Es geht ja nicht nur darum zu erklären, wie die Welt geworden ist. Dazu kann die heutige Wissenschaft sehr vieles sagen. Es geht auch darum zu erklären, daß überhaupt etwas ist.
Wer hier nur auf die Urmaterie verweist, erklärt gar nichts. Denn, erklärt sich die Urmaterie von selbst? Sie ist ja selbst der Veränderung unterworfen und damit höchst unvollkommen. Letzter Grund kann aber nur etwas sein, das aus sich vollkommen und vollendet ist, das aus sich existiert als die reinste Fülle des Seins und des Lebens. Das aber meinen wir, wenn wir von Gott sprechen. Allein in Gott hat die Wirklichkeit der Welt ihren Grund, ohne ihn wäre sie grundlos und damit sinnlos. Ohne ihn wäre letztlich nichts. Da nun aber Wirklichkeit ist und da sie eine sinnvolle Ordnung aufweist, ist es sinnvoll, zu glauben, daß auch Gott als der Grund ihres Seins und ihrer Ordnung existiert.
Die Entscheidung für Gott bedeutet eine Entscheidung gegen den Primat der Materie. Wer an Gott glaubt, sagt, daß der Geist nicht erst am Ende einer langen Entwicklung auftaucht, sondern schon am Anfang steht, ja, daß der Geist die Macht ist, die alles wirkt, alles trägt, alles bestimmt und alles geordnet hat nach Maß, Zahl und Gewicht (vgl. Weish 11,20). Wer sich also für Gott entscheidet, entscheidet sich für die Sinnhaftigkeit der Welt. Diesen Sinnstrukturen begegnet der Wissenschaftler auf Schritt und Tritt. Wie könnte er die Wirklichkeit verstehen, wenn sie nicht geistig verstehbar wäre? Wie aber könnte sie geistig verstehbar sein, wenn sie nicht von einem Geist gestaltet wäre und geistige Strukturen aufwiese? So ist unser Denken über die Welt letztlich nur möglich als ein Nachdenken der Gedanken Gottes. Der Gottesglaube ist also alles andere als ein Gegensatz zum Denken; er ist vielmehr die letzte Grundlage des Denkens und eine nachhaltige Ermutigung und Einladung zum Denken.
Die zweite, mehr neuzeitliche Form der Gottesbeweise verweist nicht unmittelbar auf die Welt, sondern auf die Wirklichkeit des Menschen. Er ist ein durch und durch endliches Wesen, abhängig und bedroht von der ihn umgebenden Natur, dem Tod verfallen. Im Menschen meldet sich aber auch etwas Unbedingtes und Absolutes. Etwa in der Stimme des Gewissens, die sich immer wieder mahnend, tadelnd, anerkennend in uns zu Wort meldet. Gewiß, viele moralische Normen sind geschichtlich bedingt. Unbedingt aber ist der grundsätzliche Anspruch, das Gute zu tun und das Böse zu lassen. Wir müßten uns selbst aufgeben, würden wir nicht gegen himmelschreiendes Unrecht, etwa die mutwillige Tötung eines unschuldigen Kindes, protestieren. Wir können nicht aufhören zu hoffen, daß ein Mörder am Ende nicht triumphiert über seine unschuldigen Opfer. Auch wenn wir nirgends in der Welt vollendete Gerechtigkeit vorfinden, ja gar nicht damit rechnen können, sie jemals verwirklichen zu können, so dürfen wir die Forderung danach nicht aufgeben. Unbedingtes und Absolutes begegnen uns außer in der Stimme des Gewissens auch in der zwischenmenschlichen Liebe. In dem einen geliebten Menschen kann plötzlich alles neu werden. In einem seligen Augenblick vergeht alle Zeit, wir rühren mitten in der Zeit an die Ewigkeit. Soll dies alles am Ende nichts sein?
So leben wir immer in der Spannung zwischen unserer eigenen Endlichkeit und Unvollkommenheit einerseits und der Sehnsucht nach dem Unendlichen, Absoluten und Vollkommenen andererseits. Diese Spannung macht das Rast- und Ruhelose und das Unbefriedigtsein aus, das uns immer wieder überkommt. Ist diese Sehnsucht sinnlos? Müssen wir uns bescheiden und sie vergessen? Damit hätten wir das Geheimnis unseres Menschseins aufgegeben. Soll also das Menschsein nicht letztlich sinnlos und absurd sein, dann ist das nur möglich, wenn unserer Hoffnung auf das Absolute eine Wirklichkeit des Absoluten entspricht, wenn unser Fragen und Suchen Echo und Reflex auf den Ruf Gottes ist, der sich im Gewissen des Menschen meldet. Einen absoluten Sinn ohne Gott zu retten, wäre eitel (M. Horkheimer). Gott allein ist Antwort auf die Größe und das Elend des Menschseins. Wer an ihn glaubt, kann der Größe des Menschen gerecht werden, ohne dessen Elend verleugnen zu müssen. Wer an Gott glaubt, kann ganz realistisch sein.
Die Entscheidung für Gott erweist sich so als Entscheidung für den Menschen. Denn nur wenn Gott ist und wenn Gott die absolute Freiheit ist, die alles umgreift, alles lenkt und leitet, ist für den Menschen in dieser Welt ein Spielraum der Freiheit. Die Entscheidung für Gott bedeutet so die Entscheidung für die Freiheit und für die unbedingte Würde des Menschen. Nur wenn Gott ist, lagert der Mensch nicht am Rande eines Kosmos, der unempfindlich ist für seine Fragen und Nöte. Wenn aber Gott ist, dann bedeutet dies, daß letztlich nicht abstrakte Sachgesetzlichkeiten, nicht blinder Zufall und nicht ein anonymes Schicksal die Welt regieren. Der Glaube an Gott erlaubt, ja fordert, daß wir uns selbst und alle anderen Menschen unbedingt annehmen, weil wir unbedingt angenommen sind. Er ermöglicht ein grundlegendes Vertrauen in die Wirklichkeit, ohne das niemand leben, lieben und arbeiten kann. Der Glaube an Gott unterdrückt nicht menschliche Freiheit, er begründet vielmehr die Überzeugung von ihrem unbedingten Wert und verpflichtet zur unbedingten Achtung jedes Menschen wie zum Einsatz für eine freiheitliche gerechte Ordnung unter den Menschen. Wäre Gott tot, dann wäre letztlich auch der Mensch tot. Nicht daß Gott tot ist, sondern daß er lebt, ist darum die Hoffnung des Menschen.
5. Gott - ein Geheimnis
5.1 Der verborgene Gott
Wie weit tragen alle diese Überlegungen? Es ist offensichtlich: Gott ist keine fertige Antwort auf unsere Fragen. Gott ist ein tiefes Geheimnis. Er ist kein Gegenstand, den man wie andere Gegenstände feststellen könnte. Gott gibt es nicht in der Weise, wie es die Dinge oder auch die Menschen in der Welt gibt. Er ist nicht irgendwo "da oben". Sein Geheimnis umfängt uns überall. Darum ist er auch nicht ein Lückenbüßer-Gott, der nur an den Grenzen menschlicher Erkenntnis in den Blick kommt. Die Bibel nennt ihn den verborgenen Gott (vgl. Jes 45,15), der im unzugänglichen Lichte wohnt (vgl. 1 Tim 6,16). Als endliche Wesen können wir den Unendlichen, alles Umfassenden nie begreifen.
"Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen, zu hoch, ich kann es nicht begreifen." (Ps 139,6)
Wir können dieses Geheimnis Gottes deshalb auch nicht aus dem Geheimnis unseres Wesens ableiten. Gott ist kein Machwerk des Menschen, kein selbstgemachter Götze, nicht die Wunscherfüllung unserer Sehnsüchte. Gott ist nur dann wahrhaft göttlich, wenn sein Geheimnis tiefer und größer ist als das Geheimnis des Menschen. Paulus bekennt:
"O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege! Denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm etwas gegeben, so daß Gott ihm etwas zurückgeben müßte? Denn aus ihm und durch ihn und auf ihn hin ist die ganze Schöpfung. Ihm sei Ehre in Ewigkeit! Amen." (Röm 11,33-36) Am Geheimnis Gottes müssen unsere menschlichen Vorstellungen von Gott immer wieder neu zerbrechen. Wir müssen uns deshalb immer wieder neu auf den Weg machen und unseren Glauben immer wieder vertiefen.
"Dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Verbirg nicht dein Gesicht vor mir..." (Ps 27,8-9)
Je mehr sich ein Mensch darauf einläßt, Gott zu suchen, werden sich ihm alle bisherigen Antworten als ungenügend erweisen. Das eindrucksvollste Beispiel dafür ist in der Bibel die Gestalt des Ijob. Schwerste Schicksalsschläge haben ihn getroffen, er hat alles verloren, sein Gut, seine Familie, seine eigene Gesundheit. Er kann Gott nicht mehr verstehen und hadert mit ihm. Doch am Ende muß er erkennen: Mit Gott kann man nicht rechten, Gott kann man nicht ergründen. So legt Ijob die Hand auf seinen Mund; er schweigt und bekennt. "So habe ich denn im Unverstand geredet über Dinge, die zu wunderbar für mich und unbegreiflich sind." (Ijob 42,3) Die großen Mystiker sprechen von der dunklen Nacht, in die die Erfahrung Gottes den Menschen führt. Diese Nacht ist das überhelle Licht Gottes, das uns blendet, weil unsere Augen dafür zu schwach sind.
Weil Gott ein übergroßes Geheimnis ist, kann ihn der Mensch auch leugnen. Er kann dem Geheimnis, das sich im Geheimnis seines eigenen Lebens auftut, andere Namen geben. Er kann es in der verschiedensten Weise benennen: allumfassende Natur, Materie, die erst im Werden, Gären und Gebären ist, oder namenloses und sinnloses Nichts, so daß unser Leben ins Leere und Bodenlose versinkt und in einer Wüste des Nichts endet. So ist Gott nicht nur eine Antwort, sondern auch eine Frage an uns. Er fragt uns, wie wir das Geheimnis unseres Lebens verstehen wollen: als Hoffnung auf eine durch uns selbst zu vollbringende künftige Vollendung, als Laune des Schicksals, als flüchtigen Windhauch des Nichts oder als Geschenk, das aus der Fülle des Seins kommt und in diese Fülle zurückstrebt. Der Gläubige ist davon überzeugt, daß allein das Geheimnis Gottes dem Geheimnis des Menschen entspricht, und er glaubt, dafür Gründe nennen zu können. Zumindest ist er der Überzeugung, daß alle Gründe gegen den Gottesglauben nicht stichhaltig sind und auch rational entkräftet werden können. Doch alle Gründe und Gegengründe sind angesichts des je größeren Geheimnisses Gottes nicht mehr als eine begründete Einladung zum Glauben.
Was heißt also Gott kennen und erkennen? Offensichtlich mehr als ein distanziertes Zur-Kenntnis-Nehmen, daß Gott existiert. In der Gotteserkenntnis geht es auch um uns selber, um den Sinn unseres Menschseins, um den Sinn unserer Welt. Die Gotteserkenntnis geschieht deshalb nicht nur mit dem Verstand, sondern mit dem Herzen, d. h. unter dem Einsatz unserer ganzen Person. Gott erkennen heißt deshalb auch, ihn anerkennen als Grund und Ziel des Lebens, heißt, ihn als ein und alles bejahen. Wer Gott erkennt, weiß, daß er ihm alles verdankt. Gotteserkenntnis äußert sich deshalb nicht nur im Denken, sondern auch im Danken, im Loben und Preisen. Man muß die Wahrheit tun, um sie wirklich zu erkennen (vgl. Joh 3,21). Wer Gott wirklich erkennt und an ihn glaubt, dessen Leben wird sich verändern. Er weiß sich ganz und gar angenommen; er kann und soll deshalb auch sich und die anderen annehmen. Gerade weil er um einen letzten Halt und Inhalt des Lebens weiß, kann und soll er sich gegen alle lebenszerstörenden Mächte für das Leben einsetzen.
Wer so mit seiner ganzen Person glaubt, weiß nur in dem Sinn mehr, als er um das unabschließbare Geheimnis Gottes und des Menschen weiß und deshalb alle Versuche menschlicher Letztantworten in Frage stellt. Wer an Gott glaubt, braucht also die Offenheit vieler Fragen nicht zuzudecken und die oft schrillen Dissonanzen im menschlichen Leben nicht zu harmonisieren; aber er kann sie aushalten, weil die Antwort, die er gibt, keine fertige Lösung, sondern ein noch tieferes Geheimnis ist. Der Glaube an den verborgenen Gott wird immer ein suchender, fragender und stets neu wagender Glaube sein.
5.2 Nur Bilder und Gleichnisse
Der Glaubende ist überzeugt, daß das Geheimnis Gottes die einzig mögliche Antwort auf das Geheimnis des Menschen ist. Doch alles, was wir über das Geheimnis Gottes sagen können, sind nicht mehr als Bilder und Gleichnisse. Durch sie rühren wir nur wie von ferne an das Geheimnis Gottes. Es gilt das Wort des Apostels Paulus
"Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse..." (1 Kor 13,12)
"Spiegel" und "Gleichnis" bedeuten, daß unsere Bilder und Begriffe durchaus "etwas" von Gott aussagen können. Auch Jesus spricht ja in Gleichnissen und benutzt alltägliche Vorgänge, um das Handeln Gottes den Menschen nahezubringen. Anders als in der Sprache der Welt können wir gar nicht von Gott sprechen. Aber Gott ist unendlich größer als unsere Bilder und Begriffe. Er ist das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, ja größer als alles, was gedacht werden kann (Anselm von Canterbury). Im Grunde können alle unsere Begriffe und Bilder eher sagen, was Gott nicht ist, als was er ist (Thomas von Aquin). Gott paßt in kein System und begründet keine in sich geschlossene Weltanschauung. Der Glaube an Gott sprengt vielmehr alle Gehäuse unserer Weltanschauungen, um Platz zu machen für das je größere Geheimnis Gottes und des Menschen. Das IV. Konzil im Lateran (1215) hat deshalb erklärt:
"Denn von Schöpfer und Geschöpf kann keine Ähnlichkeit ausgesagt werden, ohne daß sie eine größere Unähnlichkeit zwischen beiden einschlösse." (DS 806, NR 280)
Alles, was wir von Gott sagen und denken, gilt darum in einem ganz einmaligen, unendlich vollkommenen Sinn. Alle unsere Begriffe und Bilder, die wir für Gott bemühen, sind nur wie ein Richtungspfeil. In keinem von ihnen "haben" wir Gott. Alle schicken uns vielmehr auf den Weg zu Gott. Sie sind Einweisungen in ein Geheimnis, dem man nur in der Haltung der Anbetung gerecht wird. Sie sollen uns bereit machen, immer wieder neu hinzuhören auf das, was Gott uns durch sein Wort und durch seine Tat in der Geschichte zu sagen hat. Erst in Jesus Christus wird uns das Geheimnis Gottes und das Geheimnis des Menschen endgültig erschlossen. In Jesus Christus offenbart uns Gott sein Geheimnis als Geheimnis seiner unergründlichen Liebe. So bleibt er auch und gerade in seiner Offenbarung der verborgene Gott, dessen Liebe wir nur in menschlichen Bildern und Gleichnissen erfassen können.
6. Die Selbstoffenbarung Gottes und die Antwort des Glaubens
6.1 Offenbarung - der Weg Gottes zum Menschen
Schon im menschlichen Bereich gilt, daß uns das Innerste des Menschen, seine Gesinnung, weithin verborgen ist. Wie ein Mensch uns gesonnen ist, das muß er uns offenbaren, nicht allein durch das, was er uns sagt, sondern noch mehr durch das, was er tut. Wenn ein anderer uns sagt: "Ich liebe dich", dann können wir ein solches Wort letztlich nur in einem menschlichen Glauben als wahr und wirklich erkennen. Dies gilt noch viel mehr von Gott, der uns ein unergründliches Geheimnis ist.
Das Alte und das Neue Testament bezeugen auf jeder Seite: Gott, der den Menschen verborgen ist und der im unzugänglichen Lichte wohnt, ist aus seiner Verborgenheit herausgetreten und hat sein Geheimnis, "das seit ewigen Zeiten unausgesprochen war", geoffenbart (Röm 16,25; vgl. Eph 1,9). Der Mensch läuft deshalb bei seiner Suche nach Gott nicht ins Leere. Gott kommt ihm vielmehr entgegen. Gott thront nicht in unerreichbarer Ferne, er ist uns nahegekommen und gibt sich uns durch Wort und Tat zu erkennen. Er offenbart uns nicht nur, daß er ist, sondern daß er Jahwe (vgl. Ex 3,14), der Immanuel, der Gott mit uns ist, daß er uns in seine Gemeinschaft einlädt und aufnimmt. Er hat sich nicht gescheut, "unser Gott" zu heißen (vgl. Hebr 11,16). Er ist "der Gott der Hoffnung" (Röm 15,13).
Gott offenbart sich seit dem Ursprung der Welt durch die Schöpfung, besonders durch das Gewissen des Menschen und seine Führung in der Geschichte. Es gibt also eine allgemeine Geschichte der Offenbarung Gottes. Die Bibel berichtet an verschiedenen Stellen von "heiligen Heiden", die Zeugen des lebendigen Gottes sind: Abel, Henoch, Melchisedek, Ijob u. a. Denn Gott "will, daß alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen" (1 Tim 2,4). Deshalb lehrt das II. Vatikanische Konzil:
- "Von den ältesten Zeiten bis zu unseren Tagen findet sich bei den verschiedenen Völkern eine gewisse Wahrnehmung jener verborgenen Macht, die dem Lauf der Welt und den Ereignissen des menschlichen Lebens gegenwärtig ist, und nicht selten findet sich auch die Anerkenntnis einer höchsten Gottheit oder sogar eines Vaters ... Die katholische Kirche lehnt nichts von alledem ab, was in diesen Religionen wahr und heilig ist. Mit aufrichtigem Ernst betrachtet sie jene Handlungs- und Lebensweisen, jene Vorschriften und Lehren, die zwar in manchem von dem abweichen, was sie selber für wahr hält und lehrt, doch nicht selten einen Strahl jener Wahrheit erkennen lassen, die alle Menschen erleuchtet." (NA 2)
Doch Gott will sich den Menschen nicht nur einzeln, unabhängig von aller wechselseitigen Bindung, sondern dem Menschen als einem sozialen und geschichtlichen Wesen offenbaren. Er will die Menschen zu einem Volk sammeln und dieses zum Licht der Völker machen (vgl. Jes 42,6). So gibt es um der allgemeinen Geschichte Gottes mit den Menschen willen eine besondere Geschichte der Offenbarung Gottes. In ihr gibt sich Gott zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten bestimmten Menschen in besonderer Weise zu erkennen. Sie ergeht nicht nur privat an einzelne, sondern ist mit der Sendung verbunden, das Wort Gottes offen und öffentlich allen Menschen zu verkünden. Die besondere Offenbarung beginnt mit der Berufung Abrahams und der Erzväter (Patriarchen). Mit der Sammlung Israels und seiner Befreiung aus Ägypten tritt sie in eine neue Phase ein. Durch die Propheten wird Israel mit Gott noch tiefer vertraut gemacht und zugleich auf die endgültige Offenbarung Gottes in Jesus Christus vorbereitet.
- "Viele Male und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten; in dieser Endzeit aber hat er zu uns gesprochen durch den Sohn..." (Hehr 1,1-2)
In dieser Offenbarung geht es nicht primär um einzelne Offenbarungen, um die Mitteilung von Wahrheiten und Geboten, die der Mensch aus eigener Kraft nicht erkennen kann. Die Offenbarung ist ein Geschehen von Person zu Person. Durch sie erschließt Gott durch Wort und Tat nicht etwas, sondern sich selbst und seinen Heilswillen für den Menschen. Die Offenbarung des personalen Geheimnisses Gottes erschließt auch dem Menschen sein tiefstes Geheimnis und den Sinn seines Menschseins: die Gemeinschaft und die Freundschaft mit Gott. Indem Gott sich selbst offenbart, offenbart er auch dem Menschen den Menschen. Der Höhepunkt dieser Offenbarung ist der Gott-Mensch Jesus Christus. In ihm ist uns endgültig Gott als unser Heil und unsere Hoffnung erschlossen.
Das II. Vatikanische Konzil umschreibt die Offenbarung Gottes so:
- "Gott hat in seiner Güte und Weisheit beschlossen, sich selbst zu offenbaren und das Geheimnis seines Willens kundzutun ... In dieser Offenbarung redet der unsichtbare Gott aus überströmender Liebe die Menschen an wie Freunde und verkehrt mit ihnen, um sie in seine Gemeinschaft einzuladen und aufzunehmen. Das Offenbarungsgeschehen ereignet sich in Tat und Wort, die innerlich miteinander verknüpft sind ... Die Tiefe der durch diese Offenbarung über Gott und über das Heil des Menschen erschlossenen Wahrheit leuchtet uns auf in Jesus Christus, der zugleich der Mittler und die Fülle der ganzen Offenbarung ist." (DV 2)
Wenn wir uns also fragen oder wenn wir gefragt werden: Wer ist das eigentlich - Gott?, dann brauchen wir keine komplizierten Spekulationen anzustellen. Wir brauchen uns auch nicht auf ein unbestimmtes Gefühl zu berufen. Noch weniger ist unser Gottesglaube eine Projektion unserer Wünsche und Sehnsüchte. Er ist die Antwort auf Gottes Geschichte mit den Menschen. Wir können deshalb auf die gestellte Frage nicht anders antworten, als indem wir die Geschichte Gottes mit den Menschen erzählen und sagen: Seht da, unser Gott!, der Abraham geführt, Israel befreit, Jesus Christus von den Toten auferweckt, uns in seine Gemeinschaft berufen hat und der kommt, uns zu erlösen (vgl. Lk 21,28). Der Glaube an Gott lebt aus der Erinnerung und Vergegenwärtigung dieser Geschichte, die ein für allemal geschehen ist (vgl. Röm 6,10). Sie ist die Quelle und die Norm unseres Sprechens von Gott und der Grund unserer Hoffnung. In diese Erinnerung des geschichtlichen Sprechens und Handelns Gottes wird die von der Schöpfung her dem Menschen eingepflanzte Urerinnerung Gottes, das schöpfungsmäßige Bild Gottes im Menschen erneuert und zugleich überboten.
6.2 Der Glaube - der Weg des Menschen zu Gott
Wenn wir im Alltag sagen: "Ich glaube, daß...", dann verstehen wir darunter ein vages, unsicheres Wissen. Entsprechend meinen viele, der christliche Glaube sei ein Für-wahr-Halten von Glaubenssätzen, die man nicht beweisen kann. Vielen erscheint der Glaube deshalb als eine unmündige, kindliche Einstellung, als Autoritätshörigkeit und mangelnder Mut, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Auf der anderen Seite wissen wir, daß wir im Verhältnis zu anderen Menschen auf Treu und Glauben angewiesen sind. Daß ein anderer uns gut gesinnt ist, daß er uns gar liebt, müssen wir ihm letztlich glauben.
Was Glaube im biblischen Sinn meint, das geht uns vor allem bei Abraham auf, bei dem die besondere Geschichte Gottes mit den Menschen beginnt und den die Heilige Schrift den Vater der Glaubenden nennt (vgl. Röm 4,12). Abraham lebt in Chaldäa und verehrt die Götter seines Stammes, bis ihn eines Tages der Ruf Gottes trifft:
- "Zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen... Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen." (Gen 12,1-3)
- "Abram glaubte dem Herrn, und der Herr rechnete es ihm als Gerechtigkeit an." (Gen 15,6)
Abraham glaubt, d. h. er nimmt Stand in Gottes Wort und macht sich der göttlichen Weisung gemäß auf den Weg. Dabei setzt er alles aufs Spiel: Haus und Hof. Er wird heimatlos um Gottes willen (vgl. Hebr 11,8-14). Er läßt sich auf eine völlig ungewisse Zukunft ein. Aber er setzt auf Gott und sein Wort. Gegen alle Hoffnung ist er voller Hoffnung (vgl. Röm 4,18). So wird er zum Vater der Glaubenden.
Der Weg Abrahams vollendete sich im Weg Jesu, in dessen Nachfolge der Glaubende gerufen ist. Wie Jesus selbst heimatlos unterwegs ist und keinen Ort hat, wo er sein Haupt hinlegen kann (vgl. Mt 8,20), so sollen auch seine Jünger "alles verlassen", um ihm nachzufolgen (Mk 10,28). Jesu Gehorsam gegenüber dem Vater führt ihn ans Kreuz, wo er in der dunkelsten Nacht der Gottverlassenheit schreit: "Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" (Mk 15,34). Doch eben im Tod ist er von Gott gehalten und wird er zu neuem Leben erweckt. So ist er, der "durch Leiden Gehorsam gelernt" hat (Hehr 5,8), der "Urheber und Vollender des Glaubens" (Hehr 12,2). Glaube ist deshalb im Neuen Testament ein anderes Wort für Nachfolge.
Der Glaube ist also ein Weg. Man muß diesen Weg auf Hoffnung hin gehen, um das Ziel zu erkennen. So ist der Glaube ein Wagnis, ein Loslassen alter Sicherheiten und eine Umkehr gegenüber der gewohnten Sicht- und Handlungsweise. Dies ist nur möglich, weil der Glaube die Antwort ist auf einen vorangehenden Ruf. Der Glaubende faßt Zutrauen zu diesem Wort und schenkt Gott und seinem Wort Vertrauen. Das erste Wort des Glaubens ist deshalb nicht: Ich glaube, daß..., sondern: Ich glaube dir. In diesem vertrauenden Sich-Einlassen auf Gott geht dem Glaubenden ein Licht auf. Er erkennt in den äußeren Worten und Taten der Offenbarung den sich offenbarenden Gott. Der Glaube schenkt also neue Erkenntnis. Doch nicht weil er erkennt, glaubt er; sondern weil er glaubt, erkennt er. Er kann die erkannte Liebe Gottes nicht anders als wieder mit Liebe beantworten. Der Glaube ist gewissermaßen eine Liebeserklärung an Gott. Die Anrede durch Gott führt so zur Anrede an Gott, zum Gebet als der wichtigsten Ausdrucksgestalt des Glaubens. Weil er sich von Gott angenommen weiß, kann der Glaubende auch sich, die anderen und die Welt neu annehmen. So wird der Glaube zur Tat, die das Leben und die Welt verwandelt.
Was also ist der Glaube? Er ist ein alles umfassender Lebensentwurf und eine ganzheitliche Daseinshaltung. Der Glaubende wird in die innerste Grundhaltung Jesu einbezogen. Die hebräische Bibel gebraucht für unser Wort "glauben" vornehmlich das Wort "aman", das sich bis heute in der liturgischen Bekräftigungsformel "Amen" findet. Die Grundbedeutung von "aman" ist "fest -, beständig sein". Glauben bedeutet ein Sichfest-Machen in Gott, ein Trauen und Bauen auf ihn, ein Gründen der Existenz und ein Stand- und Bestandfinden in ihm (vgl. Jes 7,9).
Der Glaube ist das im Blick auf Jesus Christus gefaßte Vertrauen, daß Gott mir in jeder Lebenslage die Treue hält und der Halt und Inhalt meines Lebens ist. Glauben ist ein Amen-Sagen zu Gott mit allen Konsequenzen. Es bedeutet die am tiefsten greifende Umwandlung des Menschen, seines Selbstverständnisses und seines Lebens. Durch den Glauben sind wir in Christus eine neue Schöpfung (vgl. Gal 6,15; 2 Kor 5,17).
Das II. Vatikanische Konzil umschreibt den Glauben zusammenfassend folgendermaßen:
- Im Glauben "überantwortet sich der Mensch Gott als ganzer in Freiheit, indem er sich dem offenbarenden Gott mit Verstand und Willen voll unterwirft und seiner Offenbarung willig zustimmt." (DV 5)
Aus dieser Aussage ergibt sich:
1. Der Glaube ist die Antwort des Menschen auf die Selbstoffenbarung Gottes. Er ist kein vages, inhaltsloses Gefühl. Er hat einen Inhalt. Doch dieser Inhalt ist im Grunde nur einer: Gott selbst, so wie er sich in der Geschichte mit den Menschen geoffenbart hat.
2. Die Antwort des Glaubens ist nur möglich, wenn Gott dem Menschen zuvorkommt und ihm das Licht seiner Wahrheit aufstrahlen läßt, wenn er ihn sehend macht und ihm die "Augen des Herzens" erleuchtet (vgl. Eph 1,18). So ist der Glaube Geschenk der erleuchtenden Gnade Gottes. Nicht äußere Gründe oder eigene innere Einsicht, Gott selbst muß den Menschen überzeugen und seine Wahrheit einleuchtend machen.
3. Trotzdem bleibt der Glaube freier und verantwortlicher Akt des Menschen. Er wird weder allein mit dem Verstand noch allein mit dem Willen oder dem Gefühl gegeben. Im Glauben steht der ganze Mensch auf dem Spiel mit allen seinen Fragen, Hoffnungen und Enttäuschungen. Die Antwort muß darum mit der ganzen Existenz und mit dem ganzen Leben gegeben werden. Nach Augustinus gehört zum Akt des Glaubens ein Dreifaches: Die Zustimmung des Verstandes: Ich glaube, daß Gott ist und daß er sich uns geoffenbart hat. Die Zustimmung des Willens: Ich glaube Gott, d. h. ich vertraue ihm, ich verlasse mich ganz auf ihn. Aus beidem folgt: Ich glaube an Gott, d. h. ich mache mich auf den Weg zu ihm und mit ihm.
4. Da der Glaube ganz Tat Gottes und ganz Tat des Menschen ist, vollzieht sich im Glauben die Geschichte Gottes mit den Menschen hier und heute. So ist der Glaube letztlich Begegnung, Gemeinschaft und Freundschaft mit Gott. Das aber ist die Sinnerfüllung menschlichen Lebens, das Heilwerden des ganzen Menschen. So ist, wer glaubt, im Heil.
Dieses Heil hat der Glaubende freilich nicht als sicheren Besitz, sondern als eine Gewißheit auf Hoffnung hin. Der Glaube ist erst die anfanghafte Vorwegnahme der ewigen Schau Gottes von Angesicht zu Angesicht (vgl. 1 Kor 13,12). Nicht erst heute ist der Glaube fragender, suchender, angefochtener Glaube, der erst unterwegs ist. Die Wirklichkeit, in der wir leben, spricht ja oft genug eine ganz andere Sprache als das Wort Gottes. Hier gelten nicht selten ganz andere Maßstäbe, die auch dem Glaubenden immer wieder viel plausibler zu sein scheinen als die vermeintlich so weltfremd und hart anmutenden Aussagen des Evangeliums. Nicht zuletzt scheinen die Absurditäten des Lebens, das ungerechte Leiden und das oft grausame Sterben, der Botschaft von der Liebe Gottes Hohn zu sprechen. Der Glaubende soll und darf solchen Fragen nicht ausweichen; er darf vor ihnen aber auch nicht kapitulieren. Er muß angesichts solcher Infragestellung, die es in unterschiedlicher Gestalt zu allen Zeiten gegeben hat, seinen Glauben festigen und vertiefen. Immer wieder müssen wir gegen "die Welt" anglauben. Wie der Vater im Evangelium, der um Hilfe für sein krankes Kind bittet, müssen auch wir sagen: "Ich glaube; hilf meinem Unglauben" (Mk 9,24).
7. Wir glauben
7.1 Die Kirche - Gemeinschaft und Lehrerin des Glaubens
Die Formulierungen in den Glaubensbekenntnissen der alten Kirche sind unterschiedlich. Während es im "Apostolischen Glaubensbekenntnis" heißt: "Ich glaube", sagt das "Große Glaubensbekenntnis", das auf die beiden ersten allgemeinen Konzilien zurückgeht: "Wir glauben". Beide Formulierungen widersprechen sich nicht, ihr Unterschied bringt vielmehr eine im Wesen des Glaubens angelegte Spannung zum Ausdruck. "Ich glaube" heißt: Der Glaube ist die freie, verantwortliche und unübertragbare Entscheidung des einzelnen Menschen.
Zu ihr darf niemand gegen seinen Willen und gegen sein Gewissen gezwungen werden. "Wir glauben" heißt: Keiner kann für sich allein glauben. Keiner hat sich den Glauben selbst gegeben, jeder hat ihn empfangen von denen, die vor ihm glaubten. Keiner kann auch den Glauben für sich allein behalten; er muß ihn anderen weitergeben. Jeder ist also ein Glied in der großen Kette der Glaubenden. Jeder ist darauf angewiesen, in seinem Glauben durch andere, die mit ihm glauben, mitgetragen zu werden. Deshalb gilt: "Ein Christ ist kein Christ" (Tertullian). Jeder ist auf die Gemeinschaft der Glaubenden angewiesen.
"Gemeinschaft der Glaubenden" ist eine der ältesten Selbstbezeichnungen der Kirche. Viele sehen in der Kirche mehr eine Organisation, eine Institution und ein "System", in dem es um Einfluß und Macht geht, oder eine Moralpredigerin, die die Menschen zum Guten anhält, ihnen damit aber oft genug auch lästig fällt. Zweifellos sind Gestalt und Antlitz der Kirche in Vergangenheit und Gegenwart in vielem durch die Schuld ihrer Glieder, auch ihrer amtlichen Vertreter, entstellt. Das Große an der Kirche ist jedoch, daß sie den Glauben an Jesus Christus seit den Tagen der Apostel bis heute durch die Zeiten getragen und damit den Menschen immer wieder neu Halt und Inhalt für ihr Leben gegeben hat. Sie ist die die Jahrhunderte umspannende Gemeinschaft der Glaubenden. Durch sie stehen wir in Gemeinschaft mit den Blutzeugen (Märtyrern) der ersten Jahrhunderte, den großen Kirchenvätern und den bekannten wie den ungenannten Heiligen aller Zeiten. Durch sie stehen wir heute in einer weltweiten Gemeinschaft, die in der Gemeinde am Ort, zu der wir gehören, konkret wird. In dieser Zeiten und Orte übergreifenden Gemeinschaft der Glaubenden gibt es, davon wird noch ausführlich die Rede sein, unterschiedliche Dienste und Aufgaben, auch die der Hirten und Lehrer (vgl. Eph 4,11). Grundsätzlich sind aber alle Christen und jeder einzelne auf seine Weise berufen, durch Wort und Tat Zeugnis vom Glauben zu geben (vgl. Röm 12,3-8; 1 Kor 12,4-31a). Kirche, das sind nicht nur Papst und Bischöfe; Kirche, das sind wir alle, die glauben - eine große Gemeinschaft im Glauben, von der gilt: "Einer trage des anderen Last" (Gal 6,2). Die ganze Gemeinschaft der Glaubenden ist das alle einzelnen Gläubigen umgreifende Wir des Glaubens.
Man hat die Kirche oft mit einem Schiff verglichen, das von den Wogen und Stürmen der Geschichte hin- und hergeschüttelt wird, das aber, weil Jesus Christus bei ihm ist, doch den Glauben und die Gläubigen sicher ans andere Ufer des neuen Lebens bringt (vgl. Mk 4,35-41). Noch wichtiger ist das Bild von der "Mutter Kirche". Sie ist es ja, der wir das Leben des Glaubens verdanken und die uns Nahrung und Geborgenheit im Glauben gibt (vgl. Gal 4,26). Als unsere Mutter ist sie zugleich "Lehrerin des Glaubens". Wir nennen sie "Mater et magistra" (Mutter und Lehrerin), weil wir von ihr die Sprache des Glaubens lernen. Wir müssen diese Sprache gewiß an unseren eigenen Erfahrungen erproben und bewähren, aber diese müssen sich messen lassen an dem, was die ersten Zeugen und die Zeugen aller Jahrhunderte, was die ganze Gemeinschaft der Glaubenden überlieferte. Die Kirche insgesamt ist aufgrund der Verheißung Jesu Christi "die Säule und das Fundament der Wahrheit" (1 Tim 3,15).
"Ich glaube" bedeutet darum: "Ich stimme ein in das, was wir glauben." Dieses Einstimmen in den gemeinsamen Glauben nennt man das Bekenntnis des Glaubens. Es ist nicht möglich ohne eine gemeinsame, alle verbindende und für alle verbindliche Sprache des Glaubens, die Glaubensbekenntnisse. Solche Formulierungen des gemeinsamen, für alle verbindlichen Glaubens werden uns bereits an vielen Stellen des Neuen Testaments überliefert (vgl. Röm 10,9; 1 Kor 15,3-5 u. a.). Aus ihnen hat sich das Glaubensbekenntnis der Kirche herausgebildet. Es ist die Zusammenfassung des zentralen Inhalts der Heiligen Schrift und deren verbindliche Auslegung.
Das wichtigste Bekenntnis ist das "Große Glaubensbekenntnis", das aufgrund schon älterer, in den Gemeinden überlieferter Formen von den beiden ersten allgemeinen Konzilien von Nikaia (325) und Konstantinopel (381) festgelegt wurde. Bis heute ist es allen großen Kirchen des Ostens und des Westens gemeinsam. Es ist also ein im ursprünglichen Sinn des Wortes katholisches, d. h. allumfassendes, den Erdkreis umspannendes, d. i. ökumenisches Bekenntnis. Es ist auch das offizielle liturgische Bekenntnis bei der Feier der Eucharistie (Gotteslob 356). Das kürzere "Apostolische Glaubensbekenntnis" (Gotteslob 2/5) geht auf das Taufbekenntnis der römischen Kirche bis ins 3./4. Jahrhundert zurück und ist bis heute allen Kirchen der westlichen Tradition gemeinsam (römisch-katholische, altkatholische, anglikanische Kirche und die evangelischen Kirchen; anders jene Freikirchen, die kein verbindliches Glaubensbekenntnis haben). Es heißt "apostolisch", nicht weil es von den Aposteln selbst formuliert worden wäre (so eine fromme Legende, die um 400 bezeugt ist), sondern weil es den Glauben der Apostel getreu bezeugt. Fast alle seine Aussagen gehen sogar wörtlich auf Aussagen des Neuen Testaments zurück.
Die späteren Bekenntnisse und Dogmen wollen diese beiden Bekenntnisse auslegen, gegen Irrtümer und Mißverständnisse absichern und je nach den Herausforderungen der Zeit inhaltlich entfalten. Beide Bekenntnisse sind also Zusammenfassungen des ganzen Glaubens und Erkennungszeichen der Gläubigen untereinander. Deshalb legen wir sie diesem Katechismus zugrunde.
Nicht wenige Christen haben heute Schwierigkeiten mit dem gemeinsam gesprochenen Glaubensbekenntnis. Sätze wie "gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater", "geboren von der Jungfrau Maria" oder "hinabgestiegen in das Reich des Todes" sind ihnen fremd und unverständlich; sie meinen, solche Aussagen treffen nicht mehr ihre und unsere heutigen Fragen, sie seien mehr oder weniger nichtssagend. Sie wollen deshalb das gemeinsame Bekenntnis nur mitsprechen, soweit sie es verstehen und "persönlich bejahen" können; manchmal versuchen sie auch, neue "heutige" Bekenntnisse zu formulieren. Selbstverständlich muß man solche Schwierigkeiten ernst nehmen.
Man muß freilich auch darauf hinweisen, daß es heute keinen neuen Glauben und kein anderes Evangelium geben kann (vgl. Gal 1,7-8) als das, welches von allem Anfang an überliefert wurde und das die Kirche aller Jahrhunderte gemeinsam bezeugt. Diesen einen und selben Glauben muß die Kirche aber immer wieder auslegen und vertiefen; er ist uns vorgegeben und aufgegeben zugleich. Mit einer bloß mechanischen Wiederholung und geistlosen Rezitation der alten Formeln ist es also keineswegs getan. Die knappen Formulierungen des Glaubensbekenntnisses fassen ja nur die Fülle des Glaubens zusammen. Sie enthalten deshalb immer mehr, als eine bestimmte Zeit und ein einzelner Christ erfassen und verstehen kann. Sie müssen deshalb entfaltet und gedeutet werden. Sie können aber nicht aufgegeben werden, sonst würden wir die Gemeinschaft der Glaubenden mit denen, die in großer Übereinstimmung vor uns geglaubt haben, abbrechen. Die Kirche und der einzelne Christ würden dann ihre Identität verlieren.
7.2 Die Heilige Schrift als Ur-kunde und Seele der Glaubensverkündigung
Die Kirche kann keinen anderen Glauben bezeugen und bekennen als den, der ihr ein für allemal überliefert wurde (vgl. Jud 3). Sie steht auf dem Fundament der Apostel und Propheten (vgl. Eph 2,20). Die Propheten sind die in der Urkirche auftretenden, durch den Heiligen Geist erweckten Deuter der apostolischen Verkündigung, die den Gemeinden in bestimmten Situationen den Willen Gottes kundtun. Die Apostel sind die Erst- und Urzeugen des Evangeliums; sie haben es unmittelbar von Jesus Christus übernommen und sind von ihm in alle Welt ausgesandt worden (vgl. Mt 28,18-20). Deshalb steht die Kirche bleibend auf dem Fundament und unter dem Maßstab des apostolischen Glaubens (vgl. DV 7-8). Vor allem in den Pastoralbriefen werden die Apostelschüler Timotheus und Titus immer wieder gemahnt: Haltet fest an der gesunden Lehre! Bewahret das euch anvertraute Gut! Laßt euch nicht verwirren! Bleibt bei dem, was ihr gelernt habt! (vgl. 1 Tim 4,16, 6,20, 2 Tim 1,13-14; 3,14; Tit 2,2).
Das Ursprungszeugnis der Apostel ist uns konkret greifbar in den Schriften der apostolischen Zeit, die schon sehr früh im Neuen Testament gesammelt wurden. Da sich das Neue Testament als Erfüllung des Alten Testaments versteht, kann man beide Testamente nicht voneinander trennen. Sie müssen sich gegenseitig interpretieren und bilden zusammen die eine Heilige Schrift des Alten und des Neuen Bundes. Sie ist die Ur-kunde unseres Glaubens, an der sich jegliche kirchliche Verkündigung nähren und orientieren muß; sie muß gleichsam deren Seele sein (vgl. DV 21; 24). "Die Schrift nicht kennen, heißt Christus nicht kennen" (Hieronymus). Die Lesung und Auslegung der Heiligen Schrift ist deshalb ein wesentlicher Bestandteil des kirchlichen Gottesdienstes. Beides ist auch der Grundauftrag der kirchlichen Ämter und die Grundaufgabe der Theologie. Ohne regelmäßige persönliche Schriftlesung ist vor allem kein ernsthaftes christliches Leben möglich. Das ist auch der Grund, weshalb sich dieser Katechismus bei der Auslegung des kirchlichen Glaubensbekenntnisses möglichst an der Sprache und an den Aussagen der Heiligen Schrift orientiert.
Da uns die Offenbarung Gottes nur durch das Zeugnis der Boten des Alten und des Neuen Testaments und dessen schriftlichen Niederschlag in der Heiligen Schrift zugänglich ist, gehört das Entstehen der Heiligen Schrift zum Offenbarungsvorgang hinzu. In ihr und durch sie spricht Gott selbst zu uns. Sie enthält und bezeugt nicht nur das Wort Gottes, sie ist wahrhaft Wort Gottes. Unter der Einwirkung des Heiligen Geistes geschrieben (Inspiration) (vgl. 2 Tim 3,16; 2 Petr 1,19-21; 3,15-16), hat sie Gott selbst zum Urheber (vgl. DV 11; 24). "In den Heiligen Büchern kommt ja der Vater, der im Himmel ist, seinen Kindern in Liebe entgegen und nimmt mit ihnen das Gespräch auf" (DV 21). Um die Gegenwart Gottes in Jesus Christus durch das Wort der Heiligen Schrift auszudrücken, wird das Evangelienbuch bei der festlich begangenen Liturgie feierlich hereingetragen und verehrt.
Das Wort Gottes fällt nicht vom Himmel herab; es erreicht uns nur durch menschliches Wort. Daß Gott Urheber der Heiligen Schrift ist, schließt darum nicht aus, sondern schließt sogar notwendig ein, daß die einzelnen Bücher der Heiligen Schrift Menschen als Verfasser haben. Sie haben das Wort Gottes in der Sprache ihrer Zeit, den Bedingungen ihrer Zeit und Kultur entsprechend, mit Hilfe der damals üblichen literarischen Gattungen zum Ausdruck gebracht. Will man die Heilige Schrift recht auslegen, dann muß man auf die Aussageabsicht der biblischen Verfasser achten und dadurch zu verstehen suchen, was Gott uns durch sie kundtun wollte. Man muß also "genau auf die vorgegebenen umweltbedingten Denk-, Sprach- und Erzählformen achten, die zur Zeit des Verfassers herrschten, wie auf die Formen, die damals im menschlichen Alltagsverkehr üblich waren" (DV 12). Diese Menschlichkeit und Geschichtlichkeit der Heiligen Schrift gehört zur "Herablassung" Gottes, die in der Menschwerdung Jesu Christi ihren Höhepunkt erreicht hat (vgl. DV 14).
Zur Menschlichkeit und Geschichtlichkeit der Heiligen Schrift gehört auch, daß die einzelnen Schriften des Neuen Testaments in der frühen Kirche und für die frühe Kirche bzw. für die frühen Gemeinden entstanden sind. Ihren "Sitz im Leben" haben sie in der frühchristlichen Verkündigung, Liturgie, Katechese, Apologetik und in den konkreten Problemen der Gemeindeordnung. Die frühe Kirche war es auch, die die verschiedenen Schriften des Neuen Testaments gesammelt und mit dem Alten Testament zusammen zum Kanon erklärt hat. So ist die Heilige Schrift ein Buch der Kirche. Man kann sie nur dann recht verstehen, wenn man sie aus dem Leben, dem Geist und dem Glauben der Kirche, in dem sie entstanden ist, interpretiert. Im Hören auf die Heilige Schrift gilt es also, die Glaubenszeugen aller Jahrhunderte mitzuhören. Die Heilige Schrift ist nicht dem einzelnen Schriftausleger in die Hand gegeben, sondern der Kirche insgesamt geschenkt. Die Kirche als ganze ist das umgreifende Wir des Glaubens.
Über das Verhältnis von Schrift und Kirche kam es im 16. Jahrhundert zur Kontroverse mit den Reformatoren. Diese stellten die These auf, die "Schrift allein" sei "Richter, Regel und Richtschnur" (Konkordienbuch) des Glaubens. Luther war der Meinung, die Schrift sei, wenn man sie von ihrer Sinnmitte, von Jesus Christus, her liest, aus sich klar und lege sich selbst aus. Die Kirche als "Geschöpf des Wortes" stehe nicht über der Schrift. Damit meinte Luther freilich nicht den toten Buchstaben der Schrift, sondern die lebendig verkündigte Schrift, das lebendige Wort Gottes, das sich in der Kraft des Heiligen Geistes immer wieder neu Gehör schafft in der Kirche. Deshalb kann auch nach Luther das Wort Gottes nicht ohne das Volk Gottes sein.
Auch das Trienter Konzil (1545-1563) lehrte, das Evangelium in der Kirche sei die "Quelle aller heilbringenden Wahrheit und sittlichen Ordnung" (DS 1501; NR 87). Aber das Konzil lehnte es ab, die Schrift zu einer sich selbst auslegenden richterlichen Instanz in der Kirche zu machen. Die Frage ist ja, wer die Schrift jeweils gültig interpretiert. Dazu lehrte das Konzil:
- "Niemand soll es wagen, in Sachen des Glaubens und der Sitten, die zum Aufbau christlicher Lehre gehören, die Heilige Schrift im Vertrauen auf eigene Klugheit nach seinem eigenen Sinn zu drehen, gegen den Sinn, den die heilige Mutter, die Kirche, hielt und hält - ihr steht das Urteil über den wahren Sinn und die Erklärung der heiligen Schriften zu -, oder auch die Heilige Schrift gegen die einstimmige Auffassung der Väter auszulegen..." (DS 1507; NR 93)
In der Zwischenzeit ist es in dieser Frage zu einer erheblichen Annäherung gekommen. Das Vatikanische Konzil hielt zwar an der Lehre von Trient fest und lehrte: "Die Aufgabe aber, das geschriebene oder überlieferte Wort Gottes verbindlich zu erklären, ist nur dem lebendigen Lehramt der Kirche anvertraut, dessen Vollmacht im Namen Jesu Christi ausgeübt wird" (DV 10). Aber das Konzil fügte hinzu, daß die Kirche das Wort Gottes zuerst voll Ehrfurcht hören muß, bevor sie es voll Zuversicht verkünden kann (vgl. DV 1). "Das Lehramt ist nicht über dem Wort Gottes, sondern dient ihm" (DV 10). So ist die Heilige Schrift beim Dialog mit den evangelischen Christen "ein ausgezeichnetes Werkzeug in der mächtigen Hand Gottes, um jene Einheit zu erreichen, die der Erlöser allen Menschen anbietet" (UR 21).
Sowohl die katholische wie die evangelische Kirche will also grundsätzlich an der Zusammengehörigkeit von Wort Gottes und Kirche wie an der Überordnung des Wortes Gottes festhalten. Das bis heute kirchentrennende Problem liegt jedoch in der Frage, ob und inwiefern es innerhalb der Kirche lehramtliche Instanzen gibt, die das Wort Gottes verbindlich und unter Umständen unfehlbar auslegen. Das Problem ist also nicht die Schrift und ihre Stellung an sich, sondern ihre verbindliche Auslegung. Die Frage ist: Wie kommt die Autorität der Schrift konkret zur Geltung? Auf diese Frage wird später nochmals ausführlich einzugehen sein.
Neue Probleme sind durch das Aufkommen der historisch-kritischen Bibelauslegung seit dem 18./19. Jahrhundert entstanden. Sie hat uns einerseits die Reichtümer der Schrift neu erschlossen und zur Erneuerung der Kirche und ihres Glaubens mitbeigetragen. Andererseits wurden dadurch nicht nur einzelne Schriftaussagen, sondern die Schrift insgesamt in eine gegenüber der Tradition veränderte Perspektive gerückt, in der viele Gläubige nicht nur eine Infragestellung ihres Glaubens, sondern auch der Autorität der Schrift selbst sehen. Zwei Extreme stehen sich gegenüber: Die einen betrachten die Heilige Schrift ganz als Wort Gottes und wollen unter Außerachtlassung des geschichtlichen Charakters der Schrift jede Aussage rein buchstäblich verstehen (Fundamentalismus). Die anderen betrachten die Bibel als rein menschliches Buch, wie jedes andere menschliche Buch auch. Die dabei von ihnen festgestellten Unterschiede und Widersprüche zwischen den einzelnen Schriften und Schichten führen zu einer Relativierung der Schriftautorität und erst recht zu Spannungen und Widersprüchen zur überlieferten kirchlichen Auslegung.
Die heutige kirchliche Schriftauslegung geht den einzig verantwortlichen Mittelweg. Für sie ist die Heilige Schrift ganz Wort Gottes und ganz menschliches Wort. Es gilt daher, in der menschlich-geschichtlichen Gestalt und durch sie hindurch das Wort Gottes zu hören. Irrtumslose Autorität kommt der Schrift allein hinsichtlich der Wahrheit zu, "die Gott um unseres Heiles willen in heiligen Schriften aufgezeichnet haben wollte" (DV 11). Verbindlich ist dabei das Zeugnis der Schrift als ganzer in ihrer Einheit von Altem und Neuem Testament. Die einzelnen Schriftstellen müssen sich also gegenseitig interpretieren (vgl. DV 12). Es gilt, in der Vielstimmigkeit der Schrift die eine Symphonie zu hören (Irenäus von Lyon). Um diesen Gesamtsinn der Heiligen Schrift zu erfassen, müssen wir ausgehen vom heutigen Glaubensbewußtsein der Kirche, vor allem vom kirchlichen Glaubensbekenntnis, wir müssen dieses dann im Spiegel des Ursprungszeugnisses der Schrift interpretieren und dann wieder in den Kontext der gegenwärtigen Kirche übersetzen. Die Kirche interpretiert also die Schrift, aber auch von der Schrift her ergibt sich umgekehrt Wesentliches für die Interpretation der kirchlichen Lehre und Praxis. Sofern sich die historisch-kritische Schriftauslegung in diesen Gesamtprozeß der Interpretation einordnet und sich nicht zur alleinigen und obersten Richterin über den Sinn der Schrift macht, können sich ihre kritischen Anfragen und neuen Problemstellungen fruchtbar für das Glaubensverständnis der Kirche auswirken.
Die Frage, die sich nun stellt, ist: Was ist der Glaube der Kirche? Wo finden wir ihn? Die Kirche ist ja ein nicht weniger vielstimmiger Chor als die Bibel. Woran kann man sich also halten?
7.3 Tradition und Traditionen
Wer spricht "Ich glaube" und wer damit in das größere "Wir glauben" einstimmt, der tritt in einen Traditionszusammenhang ein, der von den Aposteln bis heute reicht. Doch was ist das: Tradition? Wenn wir heute von Tradition sprechen, denken wir gewöhnlich an einzelne althergebrachte Formen und Gewohnheiten, die wir - je nach Einstellung - als altehrwürdig oder als verstaubt ansehen. Oft hat die Tradition für uns nur noch nostalgischen oder folkloristischen Wert. Zwar ist die Überzeugung wieder im Wachsen, daß man ohne Bindung an Tradition in der Gegenwart und für die Zukunft orientierungslos wird. Aber was alt ist, ist deswegen noch nicht gut. Gerade gegenüber der Tradition gilt: "Prüft alles, und behaltet das Gute!" (1 Thess 5,21). Viele Traditionen waren zeitbedingt, wie vieles, was heute Mode ist, schon morgen veraltet sein wird. Auch in der Kirche gibt es vielfältige Traditionen, die sich, wie wir vor allem in unserem Jahrhundert erlebt haben, rasch wandeln können. Um so mehr die Frage: Was bleibt? Worauf kann man sich verlassen?
Jesus selbst war gegenüber der "Überlieferung der Alten" (Mk 7,3.5) kritisch, weil er sah, daß die Juden die "Überlieferung der Menschen" an die Stelle von Gottes Gebot gesetzt haben (Mk 7,8). Aber er war kein Bilderstürmer, der alles umstürzen wollte. In vielem hielt er sich an die Überlieferung seines Volkes, ja, er schöpfte reichlich aus dem Alten Testament. An die Stelle der rabbinischen Auslegung setzte er freilich seine eigene: "Ich aber sage euch" (Mt 5,22 u. a.). Er will sagen: "Was wirkliche und wahre Tradition ist, das sage ich." Mehr noch: "Tradition, lebendige und lebenweckende Weitergabe, das bin ich." Dieses Verständnis wird uns durch den Apostel Paulus bestätigt. Er überliefert, was er von den Christen und Gemeinden vor ihm selbst empfangen hat (vgl. 1 Kor 15,3). Hinter dieser Überlieferungskette steht für ihn letztlich Jesus Christus. "Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe" (1 Kor 11,23). Für Paulus ist also Jesus Christus die eine und letztlich die einzige Autorität, an der alles andere gemessen werden muß. Im theologischen Ansatz ist die Tradition Jesus Christus selbst als der in der Kirche bleibend wirksam gegenwärtige Herr. Er ist zugleich der Maßstab für alle einzelnen Traditionen.
Wir müssen also ausgehen von der einen Tradition. Sie ist vom II. Vatikanischen Konzil in der Sache gemeint, wenn es von der lebenspendenden Gegenwart dieser Überlieferung spricht.
- "So ist Gott, der einst gesprochen hat, ohne Unterlaß im Gespräch mit der Braut seines geliebten Sohnes, und der Heilige Geist, durch den die lebendige Stimme des Evangeliums in der Kirche und durch sie in der Welt widerhallt, führt die Gläubigen in alle Wahrheit ein und lässt das Wort Christi in Überfülle unter ihnen wohnen (vgl. Kol 3,16)." (DV 8)
Es ist also nicht so, daß Jesus Christus am Anfang die Kirche und die Hierarchie geschaffen hat, um dann aus dieser Welt wegzugehen, weil damit für den Glauben bis zum Weltende mehr als genug gesorgt ist. Vielmehr ist Christus in der Kirche wirkmächtig gegenwärtig, sein Wort lebt in der Kirche weiter. "Die Tradition ist das fortwährend in den Herzen der Gläubigen lebende Wort" (J. A. Möhler)
Die eine Tradition drückt sich aus und verkörpert sich in vielfältigen Traditionen.. "So führt die Kirche in Lehre, Leben und Kult durch die Zeiten weiter und übermittelt allen Geschlechtern alles, was sie selber ist, alles, was sie glaubt." (DV 8)
Tradition, Übermittlungsform des Glaubens, kann grundsätzlich alles sein in der Kirche: das Kreuzeszeichen, das eine Mutter ihrem Kind auf die Stirn macht, die Vermittlung der Grundgebete der Christenheit - besonders das "Vater unser" - in Elternhaus und Religionsunterricht, das Leben, Beten, Singen einer Gemeinde, in die der junge Mensch hineinwächst, das christliche Beispiel im Alltag und die christliche Tat bis hin zum Martyrium, Zeugnisse christlicher Musik (besonders Kirchenlieder, Choräle), von Baukunst und darstellender Kunst (vor allem die Kreuzesdarstellungen, die als bevorzugtes christliches Symbol gelten) und nicht zuletzt die Liturgie der Kirche.
Selbstverständlich gehören zu den Vermittlungsformen des Glaubens auch und in einer besonderen Weise die verschiedenen Formen, in denen sich das kirchliche Lehramt ausspricht (Ansprachen und Predigten, Hirtenschreiben, Enzykliken bis hin zu den seltenen feierlichen Lehrkundgebungen von Konzilien und unfehlbaren Entscheidungen des Papstes). Grundsätzlich kann man sagen: Tradition geschieht durch die Verkündigung, die Liturgie und die Diakonie der Kirche. Da die Kirche aller Orte und Zeiten das Wir des Glaubens ist, sind die Traditionszeugnisse der Vergangenheit von bleibendem Gewicht: die alten Liturgien, die Aussagen der Konzilien, die Schriften der Kirchenväter und der Kirchenlehrer, die Zeugnisse der Frömmigkeit, die archäologischen und künstlerischen Zeugnisse der Vergangenheit (etwa die Inschriften in den Katakomben, die geschichtlich sich wandelnden Christusdarstellungen u. a.). Nicht zuletzt sind die großen Heiligengestalten zu nennen. Wir werden uns deshalb in diesem Katechismus immer wieder bemühen, diese Glaubenszeugen der Vergangenheit zu Wort kommen zu lassen. Nicht alles unter diesen vielfältigen Gestalten und Zeugnissen der Tradition kann freilich gleich wichtig sein. Zu viele Unterschiede sind deutlich, sobald man sich eingehender damit befaßt. So stellt sich die Frage nach den Kriterien, um in der Vielfalt der Traditionen die eine Tradition zu erfassen.
Ein erstes Kriterium nannten wir bereits: Jesus Christus, vor allem wie er uns in der Heiligen Schrift, der Ur-kunde des Glaubens, bezeugt wird. Die Heilige Schrift bezeugt alles zum Heil Notwendige, vor allem die Mitte unseres Glaubens, das Heil Gottes in Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Alle anderen Glaubensaussagen sind Entfaltungen, Absicherungen und Abgrenzungen dieser einen Wahrheit in den vielen Wahrheiten. Deshalb ist das Ursprungszeugnis der Heiligen Schrift der wichtigste Maßstab zur Beurteilung der Traditionszeugnisse. Ein zweites Kriterium kommt hinzu: Ein einzelnes Traditionszeugnis ist nur insoweit beweistüchtig, als es den gemeinsamen Glauben des gesamten Wir der Kirche seiner Zeit und jeder Zeit zum Ausdruck bringt. Im 5. Jahrhundert hat Vinzenz von Lérins den Satz aufgestellt: "Desgleichen ist in der katholischen Kirche selbst entschieden dafür Sorge zu tragen, daß wir das festhalten, was überall, was immer und was von allen geglaubt wurde; denn das ist im wahren und eigentlichen Sinne katholisch." Damit ist nicht ausgeschlossen, daß die Kirche erst im Laufe der Geschichte die ganze Fülle der ursprünglich überlieferten Glaubenswahrheit erkennt. Doch dies muß geschehen, wie Vinzenz von Lérins sagte und wie es das I. Vatikanische Konzil wiederholte, "in demselben Sinn und in derselben Auffassung" (DS 3020; NR 44). Die Wahrheit des Evangeliums ist in den vielfältigen kulturellen und geschichtlichen Ausdrucksformen immer eine und dieselbe.
Auch das Verhältnis von Heiliger Schrift und Tradition war im 16. Jahrhundert Gegenstand scharfer Auseinandersetzung. Im späten Mittelalter waren manche Grundaussagen des Evangeliums durch menschliche Traditionen verdunkelt. Gegen diese Überfremdungen stellten die Reformatoren den Grundsatz auf: "allein die Schrift". "Gottes Wort soll Artikel des Glaubens stellen und sonst niemand, auch kein Engel" (Schmalkaldische Artikel).
Das Trienter Konzil (1545-1563) griff das berechtigte Anliegen der Reformatoren auf. Auch nach dem Konzil kann es keine verbindliche Überlieferung gegen die Schrift geben. Das Konzil erklärte nur die Traditionen als glaubensverbindlich, die die Apostel von Jesus Christus empfangen haben und die von den Aposteln bis auf uns gekommen sind. Alle rein menschlichen oder nur partikularen Traditionen waren damit ausgeschieden. Das setzte das Trienter Konzil instand, eine große Reform und Erneuerung der katholischen Kirche einzuleiten. Aber das Konzil setzte zugleich dem reformatorischen "allein die Schrift" ein "und" entgegen. Das eine Evangelium ist enthalten "in geschriebenen Büchern und ungeschriebenen Überlieferungen". Beide sind "mit gleicher frommer Bereitschaft und Ehrfurcht" anzuerkennen und zu verehren (DS 1501; NR 87-88). Dieses "und" braucht nicht, wie oft geschehen, in dem Sinn verstanden zu werden, als sei die Wahrheit des Evangeliums teils in der Heiligen Schrift und teils in der Überlieferung enthalten. Man kann die Konzilsaussage auch im Sinn der Kirchenväter und der großen Theologen des hohen Mittelalters so verstehen: Die Heilige Schrift enthält in der Substanz den ganzen Glauben, dieser kann aber in seiner Ganzheit und Fülle nur im Licht der Tradition erfaßt werden. So lehrt das II. Vatikanische Konzil: Die Kirche schöpft "ihre Gewißheit über alles Geoffenbarte nicht aus der Heiligen Schrift allein" (DV 9).
Aufgrund der ökumenischen Annäherung in unserem Jahrhundert hat die Kontroverse inzwischen vieles von ihrer alten Schärfe verloren. Man hat entdeckt, daß die Überlieferung älter ist als die Schrift und daß die Schrift selbst ein Produkt der urkirchlichen Überlieferung ist. Inzwischen ist es durch manche negativen Folgen der modernen historisch-kritischen Schriftauslegung auch zu einer Krise des reinen Schriftprinzips gekommen. Auf der anderen Seite setzte sich in unserem Jahrhundert in allen Kirchen die Einsicht von der Bibel als Grundlage kirchlicher Lehre und kirchlicher Praxis durch. Das hohe Maß der inzwischen erreichten Annäherung geht aus vielen ökumenischen Dokumenten hervor, besonders aus der Erklärung der Vierten Weltkonferenz für Glauben und Kirchenverfassung in Montreal (1963) über "Schrift, Tradition und Traditionen". Dennoch bleiben noch wichtige Sachfragen, vor allem die Frage eines kirchlichen Lehramtes, offen. Im wesentlichen sind heute nämlich nicht mehr die grundsätzliche Stellung der Schrift als solcher und die Bedeutung der Tradition als solcher das ökumenische Problem, sondern die Unterscheidung zwischen rechter und irriger Schriftauslegung, zwischen gemeinsam verbindlicher Tradition und den vielfältigen Traditionen, die einen legitimen Reichtum unterschiedlicher Ausdrucksformen des einen Glaubens bezeugen. Die Frage ist deshalb: Wie spricht die auf die Heilige Schrift sich berufende Kirche verbindlich? Wie tut sie dies im Konfliktfall? Damit ist die Frage nach dem kirchlichen Dogma gestellt.
7.4 Brauchen wir Dogmen?
Viele Zeitgenossen tun sich etwas darauf zugute, wenn sie Probleme, wie sie sagen, "undogmatisch" und "pragmatisch" angehen. Das Wort Dogma hat für viele eher einen negativen Klang, weil es die Vorstellung des Unbeweglichen, Engstirnigen, Unfreimachenden nahelegt und Erinnerungen an Inquisition, Glaubenskrieg, Gewissenszwang u.a. wachruft. Freiheit des Denkens, Redens, Forschens, Gewissens- und Religionsfreiheit gelten heute mit Recht als hohe Güter, auch in der Kirche. Manche meinen sogar, heute sei die Zeit eines undogmatischen, praktisch orientierten Christentums gekommen.
Doch Freiheit wird nur dann nicht zur Willkür, wenn sie an der Wahrheit orientiert bleibt. Ja, erst die Wahrheit macht wirklich frei (vgl. Joh 8,32). Heute wie zu allen Zeiten gilt Jesu Mahnung zum eindeutigen und furchtlosen Bekenntnis:
- "Wer sich nun vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen." (Mt 10,32-33)
Solch eindeutiges Bekenntnis ist allen Christen aufgetragen. Um der Eindeutigkeit des Bekenntnisses willen ist auch Einheit im Bekenntnis notwendig. Spaltungen und Parteiungen gab es in der Kirche freilich von Anfang an (vgl. Apg 6,1; 1 Kor 1,11-13 u. a.). Deshalb finden wir im Neuen Testament an vielen Stellen die Mahnung zur Einheit.
- "Seid alle einmütig, und duldet keine Spaltungen unter euch; seid ganz eines Sinnes und einer Meinung." (1 Kor 1,10)
- "Bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch den Frieden, der euch zusammenhält. Ein Leib und ein Geist, wie euch durch eure Berufung auch eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist; ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist." (Eph 4,3-6)
Die Einheit der Kirche im Glauben kann, zumal in ökumenischer Perspektive, sicherlich kein Uniformismus, sondern nur eine Einheit in der Vielfalt der Verkündigungsweisen, Gottesdienstformen, Theologien und Kirchenordnungen sein. Aber muß sie nicht auch und zuerst eine Einheit in der Wahrheit sein? Legitime Vielfalt ist zu unterscheiden von Vielheit einander widersprechender Glaubensaussagen. Ein grenzenlos wild wachsender Pluralismus würde die Frage und Suche nach der Einheit sinnlos machen. Die Christen könnten sich dann nicht mehr zum Gottesdienst versammeln und gemeinsam das Glaubensbekenntnis sprechen. Hätte die christliche Wahrheit keine Eindeutigkeit mehr, wäre es auch um die Glaubwürdigkeit des Glaubens in der Welt geschehen. So dürfen wir dankbar sein für die Wohltat, die Gott uns dadurch erweist, daß er seine Kirche durch den Heiligen Geist inmitten von verwirrenden und zerstörenden Unklarheiten immer tiefer in die Wahrheit einführt und daß er dies durch Menschen und auf menschliche Weise tut.
Was also ist ein Dogma? Kein Zusatz zum ursprünglichen Evangelium oder gar eine neue Offenbarung, sondern eine amtliche, für die ganze Kirche verbindliche Auslegung der einen ein für allemal ergangenen Offenbarung, meist in Abgrenzung gegen irrige, verkürzende und verfälschende Interpretationen. Zum Dogma gehört also ein Doppeltes: Es muß sich auf die ursprüngliche und gemeinsame Offenbarungswahrheit beziehen, und es muß amtlich, für alle verbindlich, endgültig vorgelegt werden. Wenn die Kirche dies tut, vertraut sie auf die bleibende Gegenwart Jesu Christi und den Beistand des ihr verheißenen Heiligen Geistes, der sie in alle Wahrheit einführt (vgl. Joh 16,13).
Um der Einheit und Eindeutigkeit des Glaubens willen mußte schon die Urkirche Abgrenzungen vollziehen. Die wichtigste und schmerzlichste Grenzziehung war gegenüber der jüdischen Synagoge notwendig. Das Apostelkonzil in Jerusalem verkündete gegen Christen, die ins Judentum zurückgefallen waren, die Freiheit vom jüdischen Gesetz (vgl. Apg 15). Bereits in diesem Zusammenhang fällt das Wort "Dogmen" (vgl. Apg 16,4). Im gleichen Zusammenhang formuliert Paulus das wohl erste "anathema" der Kirchengeschichte (Gal 1,8-9; vgl. 1 Kor 16,22). Auch an vielen anderen Stellen des Neuen Testaments finden wir bereits feste und verbindliche Bekenntnisformeln (vgl. Röm 10,9; 1 Kor 12,3; 15,3-5 u. a.). Sie wurden durch die ökumenischen Konzilien der alten Kirche vor allem im "Großen Glaubensbekenntnis" weiter entfaltet. Die Abgrenzungen galten jetzt nicht mehr Christen, die ins Judentum zurückfielen, sondern solchen, die heidnische Vorstellungen nicht ganz abgestreift hatten und den christlichen Glauben dadurch verfälschten. Solche Auseinandersetzungen waren auch später immer wieder nötig: im Mittelalter mit Bewegungen wie den Waldensern und Albigensern (besonders das IV. Laterankonzil 1215), im 16. Jahrhundert mit den Reformatoren (Konzil von Trient 1545-1563), in der Neuzeit mit modernen, der Aufklärung entstammenden Irrtümern (zusammenfassend das I. Vatikanische Konzil 1869/70). Anders die beiden marianischen Dogmen von 1854 ("Maria ohne Erbsünde empfangen") und von 1950 ("Maria mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen"). Sie entsprangen weniger der Abgrenzung gegenüber Irrtümern als der vertieften Einsicht in die Stellung Marias in der Heilsgeschichte.
Diese dogmatische Lehrentwicklung führte vor allem zur Präzisierung der kirchlichen Sprechweise und zur Vertiefung der Glaubenseinsicht. Bisweilen kam es im Gefolge von Dogmatisierungen freilich auch zu Verengungen, weil die Polemik oft dazu führte, nur das Gegenteil des bekämpften Irrtums festzuhalten, und weil sie verhinderte, das berechtigte Anliegen zu sehen, das hinter manchen einseitigen Formulierungen stand. Das war mit ein Grund dafür, daß das II. Vatikanische Konzil (1962-1965) zwar kein einziges Dogma der Vergangenheit zurücknahm, aber auch kein neues aufstellte, sondern sich für eine positive Darlegung der Wahrheit entschied. Diese positive, "pastorale" Sprechweise darf freilich nicht mißverstanden werden. Denn ihren richtig verstandenen pastoralen Dienst tut die Kirche den Menschen gerade dadurch, daß sie die Wahrheit verkündet.
Aus dem Gesagten geht hervor, daß die Endgültigkeit, mit der Dogmen vorgelegt werden, nicht ausschließt, daß Dogmen in der Sprache ihrer Zeit sprechen, so daß ihr Sinn von der Aussagekraft der zu einer bestimmten Zeit und unter bestimmten Umständen angewandten Sprache abhängt. Man muß also unterscheiden zwischen den Glaubenswahrheiten selbst und ihrer Aussageweise (vgl. GS 62). Zu dieser Geschichtlichkeit der Dogmen gehört auch, daß sie die Wahrheit bisweilen zwar nicht falsch, aber in der begrenzten Perspektive der Fragestellung ihrer Zeit und ihrer Aussagemöglichkeiten ausdrücken. Kein einzelner Satz, auch kein Dogma kann die Fülle des Evangeliums ausschöpfen. Jeder sagt die eine unendliche Wahrheit, das Geheimnis Gottes und seines Heils in Jesus Christus, in endlicher und damit unvollkommener, verbesserungs-, erweiterungs- und vertiefungsfähiger Weise aus. Das heißt nicht: in veränderlich approximativer, unbestimmt annäherungshafter Weise. Ein solcher dogmatischer Relativismus widerspräche dem zentralen Geheimnis des Glaubens, wonach Gott in Jesus Christus in endgültiger Weise in eine bestimmte menschliche Gestalt eingegangen ist und ihr endgültige Bedeutung gegeben hat. Auch wenn die Dogmen keine Verlängerung der Menschwerdung sind, so besteht doch eine gewisse Ähnlichkeit (Analogie). Die Dogmen sollen ja die Menschwerdung in abbildhafter (analoger) Weise vergegenwärtigen. Deshalb ist auch die dogmatische Wahrheit in einer bestimmten Gestalt endgültig verbindlich (vgl. Mysterium Ecclesiae 5).
Versteht man die Dogmen in dieser Weise, dann sind sie in ihrer konkreten Verbindlichkeit zugleich offene Formeln, offen in ein grenzenloses Geheimnis hinein. Nicht weil sie falsch sind, sondern gerade weil sie wahr sind, weisen sie über sich hinaus. Sie müssen darum immer wieder lebendig interpretiert werden. Dogmatische Tradition ist nur durch Interpretation möglich. Dogmen müssen interpretiert werden im Blick auf die Heilige Schrift und die gesamte, meist viel umfassendere Tradition, wie im Blick auf die damalige und die heutige Situation (die "Zeichen der Zeit"). Dabei muß man jedes einzelne Dogma im Zusammenhang aller übrigen Glaubenswahrheiten verstehen und auf die Hierarchie der Wahrheiten, d. h. auf das Strukturganze der Glaubensaussagen achten (vgl. UR 11). Man muß die Dogmen wägen und nicht zählen! Vor allem müssen die einzelnen Dogmen als Entfaltung oder Absicherung des einen und im Grunde einzigen - weil alles umfassenden - Inhalts des Glaubens verstanden werden: Gottes Heil in Jesus Christus. Dies ist das eine Dogma in den vielen Dogmen, das eine Wort in den vielen Worten der dogmatischen Überlieferung.
Muß also ein katholischer Christ alle Dogmen kennen, und muß er, wenn er sie kennt, auch alle glauben? Darauf ist schlicht zu antworten: Wer so glaubt wie Abraham, wer in der Nachfolge Jesu seinen Weg geht, und wer dies in und mit der ganzen Gemeinschaft der Glaubenden tut, der glaubt nicht nur einen Teil, sondern einschlußweise den ganzen Glauben, der nicht eine äußere Summe einzelner Sätze, sondern ein Ganzes darstellt, das die einzelnen Sätze nur auslegen und absichern. Wieweit der einzelne Christ diese Entfaltungen kennen muß, hängt von seiner Aufgabe in der Kirche und auch vom Grad seiner übrigen Bildung ab. In der gegenwärtigen Glaubenssituation kommt es sicherlich mehr darauf an, daß wir uns auf den einen Glauben in den vielen Glaubenssätzen konzentrieren, statt diesen immer mehr in Einzelsätze hinein auszulegen. In diesem Sinn muß unser Glaube gerade heute wieder einfacher werden! Das heißt nicht, ihn zusammenzustreichen und zu simplifizieren. Denn das Gesagte bedeutet auch, daß man kein einzelnes Dogma aus dem Ganzen herausbrechen und leugnen kann, ohne die Struktur des Ganzen zu zerstören.
So kommen wir zurück auf die frühere Aussage: Der Glaube ist ein alles umfassender Lebensentwurf und eine ganzheitliche Daseinshaltung. Dieses Ganze ist nicht ein Satz oder eine Summe von Sätzen, sondern ein Trauen und Bauen auf Gott, so wie er sich uns in Jesus Christus erschlossen hat. Deshalb glaubt man nicht an Dogmen, so wie man an Gott, Jesus Christus, den Heiligen Geist glaubt. Man glaubt die Dogmen als eine konkrete Vermittlungsgestalt dieses einen Inhalts des Glaubens. Nicht die Dogmen begründen die Wahrheit des Glaubens, die Wahrheit des Glaubens begründet die Dogmen. Sie sind nicht wahr, weil sie verkündet wurden, sie wurden vielmehr verkündet, weil sie der Wahrheit entsprechen. Wir brauchen sie, um die eine Wahrheit des Glaubens gemeinsam und eindeutig bekennen zu können. So weisen sie über sich hinaus auf die Wahrheit, daß Gott der allmächtige Vater und der Vater Jesu Christi ist. Auf diese Wahrheit kommt alles an. Ihr müssen wir uns nunmehr zuwenden.
II. Gott, der Vater, der Allmächtige - Der Vater Jesu Christi
1. Der lebendige Gott der Geschichte
1.1 Wer ist das eigentlich - Gott?
"Ich glaube an Gott." Diese erste Aussage des Glaubensbekenntnisses ist zugleich die wichtigste. Im Grunde geht es im ganzen Credo nur um Gott und um nichts anderes als um Gott, um alles andere nur, insofern es zu Gott in Beziehung steht. Doch wer ist das eigentlich - Gott?
Von Gott und zu Gott haben die Menschen im Laufe ihrer Geschichte sehr unterschiedlich gesprochen. Nach M. Buber ist "Gott" "das beladenste aller Menschenworte. Keines ist so besudelt, so zerfetzt worden ... Die Geschlechter der Menschen haben die Last ihres geängsteten Lebens auf dieses Wort gewälzt und es zu Boden gedrückt; es liegt im Staub und trägt ihrer aller Last. Die Geschlechter der Menschen mit ihren Religionsparteiungen haben das Wort zerrissen; sie haben dafür getötet und sind dafür gestorben; es trägt ihrer aller Fingerspur und ihrer aller Blut ... Sie zeichnen Fratzen und schreiben ,'Gott' darunter; sie morden einander und sagen in 'Gottes Namen'." Der Name Gottes ist freilich auch "tief eingegraben in die Hoffnungs- und Leidensgeschichte der Menschheit. In ihr begegnet uns dieser Name, aufleuchtend und verdunkelt, verehrt und verneint, mißbraucht, geschändet und doch unvergessen" (Gern. Synode, Unsere Hoffnung I,1).
Welchen Gott meinen wir also, wenn wir bekennen: "Ich glaube an Gott"; und welcher Gott ist gemeint, wenn man schreit: "Gott ist tot!"?
Wenn wir als Christen Gott bekennen, dann reden wir nicht von dem Gott, von dem die Mythen der Urzeit in Form von Göttergeschichten erzählen. Wir reden auch nicht nur von dem Gott, der in mystischer Innerlichkeit erfahren wird, oder nur vom Gott der Philosophen. Wir meinen den lebendigen Gott der Geschichte, den "Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs" (vgl. Ex 3,6; Mt 22,32), den Gott Israels (vgl. Ps 72,18; Jes 45,3; Mt 15,31) und nicht zuletzt den Gott, der "der Vater unseres Herrn Jesus Christus" ist (2 Kor 1,3 u. a.). Er ist zugleich der Gott, "der Himmel und Erde gemacht hat" (Ps 121,2). Deshalb kann er das Wahre anderer Weisen, von Gott zu sprechen, aufnehmen und zur Erfüllung bringen.
Die Frage: Wer ist Gott? wird also zunächst zur Frage: Wo zeigt sich Gott, daß wir erkennen können, wer er ist? Die Bibel spricht von Gott, indem sie die Geschichte Gottes mit den Menschen erzählt, und von den großen Taten Gottes, der die Geschichte seines Volkes lenkt, berichtet. Durch diese Geschichte wissen wir, wer Gott ist.
1.2 Der Gott des Alten Bundes
Die besondere Geschichte Gottes mit den Menschen beginnt mit einer Vorgeschichte bei den Erzvätern Abraham, Isaak und Jakob. Die Josefsgeschichte leitet bereits zur Bundesgeschichte mit Israel über. Wer ist der "Gott der Väter"? Kein ortsansässiger Kultgott, sondern ein Nomadengott, ein Gott unverdienter Erwählung, ein Gott des Weges und der Führung in einem "Land der Fremdlingschaft". Er verheißt den Besitz des Landes und zahlreiche Nachkommenschaft, aber es fehlt noch jede gesetzliche und kultische Normierung. Immer wieder droht sich die Verheißungsgeschichte in einem Dickicht recht unerbaulicher Menschlichkeiten zu verlieren; aber Gott führt durch alle menschliche Konfusion hindurch weiter. So ist die Erzvätergeschichte erst die Vorgeschichte des Bundes mit Israel. Immerhin deuten sich schon wesentliche Motive der Geschichte Gottes mit den Menschen an: Gott, der mitgeht auf dem Weg, Glaube als ein Sich-auf-den-Weg-Machen mit Gott und als ein Sich-Festmachen in Gott (aman) (vgl. Gen 15,6). Dies geschieht in der Spannung zwischen freundschaftlich vertrauter Nähe Gottes und abgründiger Verborgenheit.
Die Erzvätergeschichte hat auch insofern bleibende Bedeutung, als auch die Muslime den Gott Abrahams verehren und ihn als den alleinigen, lebendigen Gott anbeten. Wie Abraham sich im Glauben Gott unterwarf, mühen sie sich um Ergebung in den verborgenen Willen Gottes. So sind die drei geschichtlichen und monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam durch ihren gemeinsamen Ursprung bei Abraham miteinander verbunden. Deshalb gilt es, die Zwistigkeiten und Feindschaften der Vergangenheit zwischen Christen und Muslimen zu überwinden und sich neu um ein gegenseitiges Verstehen zu bemühen (vgl. NA 3).
Mit Mose und dem Bund Gottes mit dem Volk Israel setzt die Geschichte Gottes mit den Menschen voll ein. Israel lebte damals in schwerster Bedrängnis in Ägypten. Da offenbart sich dem Mose, der vor dem Pharao auf der Flucht ist:
- "Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs..." (Ex 3,6)
- "Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. Ich bin herabgestiegen, um sie der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land hinaufzuführen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen..." (Ex 3,7-8)
Beim Durchzug durch das Schilfmeer und beim Zug durch die Wüste, am Sinai, beim Einzug in das verheißene Land und bei der Errichtung des davidischen Königtums erfährt Israel immer wieder neu: Gott ist mit ihm. Sein Name ist: "Ich-bin-da" (Ex 3,14). Er trägt sein Volk "wie... auf Adlerflügeln" (Ex 19,4), um mit ihm einen Bund zu schließen und es unter allen Völkern zu seinem besonderen Eigentumsvolk zu machen, das ihm gehört "als ein Reich von Priestern und als ein heiliges Volk" (Ex 19,6). Dieser Bund ist kein Vertrag gleicher Partner zu gleichen Rechten und Pflichten; er wird vielmehr gnädig und frei von Gott gewährt. Er nimmt Israel durch die "Bundessatzung", die Zehn Gebote mit ihren ethischen und sozialethischen Weisungen, in Pflicht (vgl. Ex 20,1-17, Dtn 5,1-22); aber er verheißt dem Volk auch Leben, Land, Zukunft. Die kürzeste Zusammenfassung dieses Bundesverhältnisses lautet: "Ich, euer Gott - ihr, mein Volk" (vgl. Jer 7,23). Der Gott Israels ist also kein Gott, der in seliger Ruhe unberührt über den Geschicken der Menschen und dem Lauf der Geschichte thront. Er ist ein lebendiger Gott, der das Elend der Menschen sieht und ihr Schreien hört. Er ist ein Gott, der sich für das Leben einsetzt, ein Gott, der befreit und herausführt, ein Gott, der in die Geschichte eingreift und eine neue Geschichte eröffnet. Er ist ein Gott der Hoffnung.
Die Bundesgeschichte verläuft äußerst dramatisch. Immer wieder gerät Israel in Not und Bedrängnis, weil es von dem einen lebendigen Gott und von der Grundweisung des Gottesrechts abfällt und sich den Götzen der umgebenden Heidenvölker zuwendet. Immer wieder erweckt Gott Männer und Frauen, um seinem Volk in Stunden der Not zu helfen. Gott ruft vor allem die Propheten. Die Bibel kennt neben den älteren Propheten, die keine Schriften hinterlassen haben (Elija, Elischa, Samuel u. a.), die "Schriftpropheten": die vier "Großen Propheten": Jesaja, Jeremia, Ezechiel, Daniel, und die zwölf "Kleinen Propheten": Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggai, Sacharja, Maleachi. Die Propheten sind keine Wahrsager. Gott bestellt sie vielmehr zu seinen Boten, Sprechern und Rufern. Immer wieder heißt es: "Geh und sag diesem Volk" (Jes 6,9), "so spricht der Herr" (Am 1,3.6 u. a.). Die Propheten sollen im Auftrag Gottes das Volk zurückrufen zum Gehorsam und zur Gerechtigkeit, sie sollen ihm in der schweren Zeit des Exils Mut und Trost zusprechen. Deshalb sprechen sie von Gott, der Israel aus Ägypten befreit hat, von Gott, der Israels Vater, Hirt, König und Geliebter ist, von Gott als dem Beschützer und Befreier der Armen und Unterdrückten. Zugleich warnen die Propheten vor falscher Sicherheit. Wegen der Ungerechtigkeit und wegen des Ungehorsams des Volks schlägt die Erwählung um in das Gericht (vgl. Am 3,2). So verkündet der Prophet Amos den "Tag Jahwes" als Tag des Gerichts, der Finsternis und nicht des Lichts" (vgl. Am 5,18).
In den beiden Katastrophen von 722 (Fall des Nordreiches) und von 587 (Fall des Südreiches mit Zerstörung Jerusalems und babylonischem Exil) wird das Gericht Wirklichkeit. Israel verliert seine Selbständigkeit als Volk. Es lebt in der Fremde, in einem besetzten Land oder in der Zerstreuung (Diaspora). Doch dieser Zusammenbruch ist nicht das Ende, weil Gott nicht am Ende ist. Er ist seinem Bund treu trotz menschlicher Untreue.
- "Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen würde: ich vergesse dich nicht." (Jes 49,15)
Gott ist ein Gott, der Neues schafft und Zukunft schenkt. Die großen Taten der Vergangenheit - Auszug, Bundesschluß, Landnahme, Tempelbau - werden sich in Zukunft in gesteigerter Form wiederholen. Am Ende der Tage wird Gott Israel wieder aufrichten und einen neuen Bund schließen, der nicht wie die Zehn Gebote auf steinerne Tafeln, sondern ins Herz geschrieben sein wird (vgl. Jer 31,31-33). Dann werden alle Völker, angezogen vom Glanz des neuen Jerusalem, herbeiströmen und den Gott Israels anerkennen. Es wird ewiger Friede sein, eine Welt unter dem einen Gott (vgl. Jes 2,2-4).
Die Bundesgeschichte mit Israel, das Bekenntnis zum einen und einzigen Gott, der sich in dieser Geschichte offenbart, die Hoffnung auf den kommenden Gott und sein kommendes Reich sind Juden und Christen gemeinsam. Von dieser Wurzel des Alten Bundes kann und darf die christliche Gottesverkündigung nie abgeschnitten werden. Sie bezeugt nicht irgendeine allgemeine Gottesidee, sondern den konkreten Gott, der sich durch Abraham, Mose, die Propheten geschichtlich zu erkennen gegeben hat. Aus dieser Geschichte und ihrer Bezeugung im Alten Testament hat auch Jesus selbst gelebt. Insofern können heutige Juden Jesus als ihren Bruder erkennen. Der Glaube Jesu verbindet Juden und Christen; der Glaube an Jesus trennt sie. Im Unterschied zum Judentum glauben die Christen nämlich, daß Jesus, unser Bruder, zugleich der Sohn Gottes ist, in dessen Kreuz und Auferstehung Gott die Israel gegebenen Verheißungen erfüllt hat. Das Kreuz, an das die damaligen Führer des jüdischen Volkes Jesus ausgeliefert haben, ist für die Christen das Zeichen des Heils. Als solches ist es als Zeichen der universalen Liebe Gottes zu verkünden (vgl. NA 4). Darum ist es nach den Worten des Apostels Paulus verkehrt, die Juden als enterbt und verflucht zu bezeichnen (vgl. Röm 11,1-2). Gott liebt sein Volk noch immer um der Väter willen. "Denn unwiderruflich sind Gnade und Berufung, die Gott gewährt" (Röm 11,29). Deshalb ist aller Judenhaß und erst recht alle Judenverfolgung, die es in der Geschichte des Christentums so oft und in so schrecklichem Ausmaß gegeben hat, zu verurteilen und das in unseren Tagen neu aufgenommene Gespräch mit dem Judentum weiterzuführen und zu vertiefen.
1.3 Der Gott Jesu Christi
Die Verkündigung Jesu von Gott ist von der Sprache und von den Vorstellungen des Alten Testaments und des Judentums geprägt. Für die meisten seiner Aussagen lassen sich Parallelen in den alttestamentlichen Schriften und in der jüdischen Überlieferung finden. Wie im Alten Testament ist auch für Jesus Gott der Schöpfer, der alles schafft, alles trägt, lenkt und erhält. Für Jesus ist Gottes Vatersorge in der gesamten Schöpfung erkennbar, im Gras und in den Blumen des Feldes (vgl. Mt 6,28-30) wie in den Vögeln des Himmels (vgl. Mt 6,26, 10,29-31). "Er läßt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten, und er läßt regnen über Gerechte und Ungerechte" (Mt 5,45). Kein Haar fällt von unserem Haupt, ohne daß er es weiß und will (vgl. Mt 10,30). Vor allem die Gleichnisse zeigen, wie wir in allen Vorgängen im Leben der Menschen Spuren Gottes und seines Wirkens entdecken können. Deshalb mahnt Jesus: Sorget nicht ängstlich! (vgl. Mt 6,25.31), fürchtet euch nicht! (vgl. Mt 10,31). Wie für das Alte Testament ist auch für Jesus Gott der Herr der Geschichte, der hilft und heilt, befreit und erlöst, der hier und heute Neues wirkt und der dies alles nicht nur in der Innerlichkeit des Herzens, sondern auch am Leib des Menschen tut. Nichts zeigt dies deutlicher als die Wundertaten Jesu. Jesus versteht sie nicht als spektakuläre Krafttaten, sondern als Machttaten Gottes durch ihn (vgl. Mt 12,28; Lk 17,21), und er lehrt seine Hörer, an den Gott, dem alles möglich ist, zu glauben und ihn im Glauben zu bitten. Für den Glauben gibt es nichts Unerreichbares; "alles kann, wer glaubt" (Mk 9,23). Der Glaube setzt gleichsam Gottes gütige Allmacht in Bewegung und vermag dadurch sogar Berge zu versetzen (vgl. Mk 11,23; 1 Kor 3,2).
Trotz dieser Nähe zum Alten Testament und zum Judentum ist das Ganze der Gottesverkündigung Jesu doch auf einen neuen Ton gestimmt und insofern unverwechselbar und einmalig. Der zentrale Inhalt der Verkündigung Jesu ist, daß das vom Alten Testament erhoffte Reich Gottes jetzt nahe herangekommen (vgl. Mk 1,14-15) und in seinen Worten, Taten und in seiner ganzen Person im Anbruch ist. Aber er sieht den Anbruch der Herrschaft Gottes nicht wie Johannes der Täufer im Zeichen des Zornes, sondern der Gnade, des Erbarmens und des Vergebens Gottes. Seine Botschaft von Gott ist Freudenbotschaft, wie sie vor allem in den Seligpreisungen der Bergpredigt zum Ausdruck kommt (vgl. Mt 5,3-12). Diese Freude gilt bei Jesus nicht zuletzt den Sündern, die umkehren und seinem Ruf folgen. Sie dürfen gewiß sein, daß Gott für sie wie ein Vater ist, der auf den verlorenen Sohn wartet, ihm vergibt, ihn in alle Sohnesrechte neu einsetzt und sogar ein großes Freudenfest mit ihm veranstaltet (vgl. Lk 15,11-32). Diese Botschaft von Gott als grenzenloser Liebe ist die innerste Mitte von Jesu Sprechen von Gott.
Zusammenfassender Ausdruck von Jesu Freudenbotschaft von Gott ist die Tatsache, daß Jesus Gott in ganz einmaliger Weise als Vater anredet und uns lehrt zu sagen: "Unser Vater" (Mt 6,9; vgl. Lk 11,2). Jesus wagt im Gespräch mit Gott sogar die traut-familiäre Anrede "abba" (vgl. Mk 14,36). Wie sehr die Urgemeinde davon überzeugt war, daß hier Jesu ureigenster Sprachgebrauch vorliegt, geht aus der Tatsache hervor, daß ihr dieses Wort "abba" so heilig war, daß sie es auch in griechischen Texten im ursprünglichen aramäischen Wortlaut überliefert hat (Gal 4,6; Röm 8,15). So war man in der Kirche von Anfang an überzeugt, daß das eigentlich und spezifisch Christliche in einer intimen persönlichen Gemeinschaft mit Gott besteht und im Wissen, Kind, Sohn, Tochter Gottes zu sein. Zugleich darf der Christ wissen: Wer Gott "Vater" nennt, hat Brüder und Schwestern; er steht nie einsam und allein vor seinem Vater. Von dem einen gemeinsamen Vater her bildet sich die neue Familie, das neue Volk Gottes als Anfang der einen neuen Menschheit.
Trotz aller familiären Vertraulichkeit, die für die Vateranrede Jesu charakteristisch ist, darf sie doch nicht verniedlichend mißverstanden werden. Jesus spricht nicht einfach vom "lieben Gott". Im Gegenteil, die Vateranrede Jesu bringt Gottes Gottsein in ganz unerhört neuer Weise zum Ausdruck. Für die patriarchalisch geordnete Großfamilie Palästinas ist der Vater immer auch der Herr. Zu Jesu Botschaft von Gott gehört auch das Drohen mit dem Gericht über alles Böse, das sich Gott widersetzt und den Menschen entwürdigt. Zum "Selig ihr!" gehört auch das "Weh euch!" (vgl. Lk 6,20-26; 11,42-52). In Heil und Gericht erweist sich gleichermaßen Gottes Allmacht. Nur wenn Gott allmächtig ist, kann seine Liebe in jeder Situation wirkmächtig helfen und gegen alle Mächte und Gewalten des Bösen die Herrschaft der Liebe heraufführen. Nur wenn Gott die Allmacht der Liebe ist, bedeutet seine Liebe keine naive Verklärung der Welt, sondern deren Infragestellung und schöpferische Verwandlung. Nur eine allmächtige Liebe kann der Grund unserer Hoffnung sein.
Gottes Allmacht in der Liebe, wie Jesus sie verkündet und gelebt hat, hat sich vor allem in Tod und Auferweckung Jesu erwiesen. Im Sterben Jesu hat sich Gott in letzter Radikalität dem Verstoßenen und Ohnmächtigen zugewandt und "ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt" (Apg 2,24). Durch Jesu Tod und Auferweckung wissen wir endgültig, wer Gott ist: der Gott, der die Toten lebendig macht (vgl. Röm 4,17; 2 Kor 1,9). Jesu Tod und Auferweckung sind die abschließende und zusammenfassende Offenbarung Gottes, seiner schöpferischen Treue und seiner Allmacht in der Liebe. In Jesu Leben, Sterben und Auferstehung ist uns die Güte und Menschenliebe Gottes erschienen (vgl. Tit 3,4). Gott hat sich als die Liebe erwiesen (vgl. 1 Joh 4,8.16). So dürfen wir gewiß sein: "Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn" (Röm 8,38-39).
Die endgültige Offenbarung Gottes in Jesus Christus ist der Grund unserer Hoffnung auf das kommende Reich Gottes, in dem Gott einmal alles und in allem sein wird (vgl. 1 Kor 15,28). Das letzte Buch der Schrift bezeugt die Botschaft des Alten und des Neuen Testaments zusammenfassend:
- "Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott, der Herr, der ist und der war und der kommt, der Herrscher über die ganze Schöpfung." (Offb 1,8)
- "Er wird in ihrer Mitte wohnen, und sie werden sein Volk sein; und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen: Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal.
Denn was früher ist, ist vergangen.
Er, der auf dem Thron saß, sprach:
Seht, ich mache alles neu." (Offb 21,3-5)
2. Gott, der Vater, der Allmächtige
2.1 Einmaligkeit und Einzigartigkeit Gottes
Gott, der Vater, der Allmächtige - dieser Satz des Credo hat sich als zusammenfassender Ausdruck der Gottesbotschaft Jesu und als Grund unserer Hoffnung erwiesen. Fragen wir deshalb: Was bedeutet dieses Bekenntnis?
In vielen Religionen wird der höchste Gott als Vater bezeichnet. Die Griechen nannten Zeus den "Vater der Götter und Menschen". Später sprachen Philosophen von Gott als Vater aller Menschen; sie wollten damit zum Ausdruck bringen, daß in allen Menschen von Natur aus etwas Göttliches ist, so daß alle Menschen aufgrund ihrer gemeinsamen Menschennatur gleichsam eine Familie, ein einziges Geschlecht bilden. Solche Parallelen tun der Einmaligkeit und Einzigartigkeit des biblischen Gottesverständnisses keinen Abbruch. Denn nach der Bibel ist Gott unser gemeinsamer Vater nicht aufgrund unserer gemeinsamen Natur, sondern aufgrund der Erwählung (vgl. Hos 11,1; Jer 31,20). Jesus Christus lehrt und ermächtigt uns, Gott in dieser intimen Weise als Vater anzureden (vgl. Mt 6,9; Lk 11,2). Deshalb leiten wir bei der Feier der Eucharistie das Beten des "Vater unser" mit dem Vorspruch ein: "Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu sprechen: Vater unser...". Um die Einmaligkeit des biblischen Vater-Gottes auszudrücken, sagt das Glaubensbekenntnis-. "Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen". Mit diesem Ein-Gott-Glauben (Monotheismus) ist die alttestamentliche Auseinandersetzung mit den vielen Göttern der Heiden (Polytheismus) gültig zusammengefaßt. Schon in der Bundes-Charta, in den Zehn Geboten, heißt es lapidar:
- "Du sollst neben mir keine anderen Götter haben." (Ex 20,3)
Deshalb sprach jeder Jude zur Zeit Jesu als Zusammenfassung der ganzen Bundesgeschichte jeden Tag:
- "Höre, Israel! Jahwe, unser Gott, Jahwe ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft."(Dtn 6,4-5)
Jesus hat diesen Ein-Gott-Glauben des Alten Testaments vor allem durch das Gebot der Gottesliebe "mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft" (Mk 12,30) bestätigt; das Neue Testament hat ihn gegenüber der heidnischen Vielgötterei neu zur Geltung gebracht (vgl. 1 Kor 8,4; Eph 4,6 u. a.).
Die biblischen Texte machen deutlich, daß mit dem Ein-Gott-Glauben nicht gemeint ist: Wir glauben nur an einen Gott und nicht an zwei oder drei Götter. Gemeint ist vielmehr: Wir bekennen, daß unser Gott sich als so einmalig und einzigartig erwiesen hat, daß es ihn wesensmäßig nur einmal geben kann. Denn ein Gott, der durch andere Götter begrenzt oder gar behindert wäre, der wäre nicht mehr der allmächtige Vater. "Was als höchste Größe gelten soll, das muß einzig dastehen und seinesgleichen nicht haben ... Wenn Gott nicht einer ist, so gibt es gar keinen" (Tertullian).
Der Ein-Gott-Glaube ist beileibe nicht eine bloß abstrakte Theorie, sondern ein Bekenntnis von eminent praktischer Bedeutung. Denn er sagt uns: Die Wirklichkeit der Welt ist, weil sie in dem einen Gott gründet, im letzten kein chaotisches Durcheinander; sie hat von Gott her Ordnung, Sinn und Zusammenhalt. Deshalb gibt es auch nur einen einzigen absolut verläßlichen Grund und einen einzigen absolut gewissen Sinn, auf den allein wir setzen können und müssen. Diese Entscheidung begründet die christliche Freiheit gegenüber der Welt und den Menschen. "Gott dienen heißt herrschen" (Liturgie). Ja, man kann sogar sagen: Je mehr wir allein in Gott unseren einzigen Herrn haben, desto weniger sind wir von Menschen und Dingen abhängige Sklaven, desto mehr sind wir freie Söhne und Töchter im gemeinsamen Haus des einen Vaters. Die Abgrenzung von der Vielgötterei ist auch heute, da es keine Götter im religionsgeschichtlichen Sinn mehr gibt, keineswegs überholt. Denn Götter und Götzen sind alles, was wir an Stelle Gottes zu Letztwerten machen. Götzen können sein: Geld, Ansehen, Arbeit, Macht, Fortschritt, Lust, aber auch: Volk, Rasse, Klasse, Staat, schließlich: Weltanschauungen, Ideologien, Prinzipien u. a. Jeder an sich gute, aber endliche Wert kann zum Götzen werden, der uns fesselt, wenn wir ihn verabsolutieren und wenn wir ihn neben oder gar über Gott und seinen Willen stellen. Der Ein-Gott-Glaube hält uns dazu an, uns allein Gott als letztem Grund und letztem Ziel zuzuwenden, in ihm allein unser Ein-und-Alles zu haben, alles andere aber insoweit zu gebrauchen, als es uns zu diesem Ziel hilft, und es insoweit zu lassen, als es uns daran hindert (Ignatius von Loyola). In dem Bekenntnis zu dem einen und einzigartigen Gott geht es also um die Grundentscheidung unseres Lebens.
2.2 Wesen und Eigenschaften Gottes
Wenn die Heilige Schrift sagen soll, wer Gott ist, dann spricht sie nicht in abstrakten und komplizierten Begriffen. Die Bibel spricht von Gott in vielerlei Bildern, manchmal sogar in sehr menschlichen (anthropomorphen) Ausdrücken. So lesen wir etwa in den Psalmen:
- "Ich will dich rühmen, Herr, meine Stärke, Herr, du mein Fels, meine Burg, mein Retter, mein Gott, meine Feste, in der ich mich berge, mein Schild und sicheres Heil, meine Zuflucht." (Ps 18,2-3)
Natürlich weiß auch die Heilige Schrift, daß man sich von Gott kein Bild machen kann und darf (vgl. Ex 20,4, Dtn 5,8), denn er ist einmalig und unvergleichlich.
- "Mit wem wollt ihr Gott vergleichen und welches Bild an seine Stelle setzen?" (Jes 40,18)
Um auszudrücken, daß Gott über alles Weltliche und Menschliche erhaben ist, nennt ihn die Bibel an vielen Stellen den Herrn (hebr. adonai). Er ist der Herr-Gott, der Herr aller Herren, der Herrscher über alle Welt.
- "Herr, unser Herrscher,
wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde; über den Himmel breitest du deine Hoheit aus." (Ps 8,2)
Das Wesen Gottes ist Heiligkeit und Herrlichkeit, die sich in seiner in Jesus Christus offenbaren Liebe erweisen.
- "Denn ich bin Gott, nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte." (Hos 11,9)
- "Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heere. Von seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde erfüllt." (Jes 6,3)
Die Heiligkeit bedeutet Gottes Erhabenheit und Unterschiedenheit gegenüber der Welt und der Sünde. Die Unterschiedenheit von der Sünde bedeutet zugleich Gottes Entschiedenheit für das Gute, für Wahrheit und Gerechtigkeit. Gottes Herrlichkeit meint sein souveränes Herrsein, seine Macht und Würde, seinen Glanz und seine Schönheit. Sie besagt, daß Gott unabhängig ist von allen anderen Wesen, daß er bedürfnislos aus sich und in sich existiert, weil er ohne jeden Mangel und ohne alle Veränderung die Fülle des Lebens und des Seins, die absolute Vollkommenheit ist. An dieser Fülle hat alles andere teil. Alle Wirklichkeit ist darum ein Abglanz seiner Herrlichkeit. Als der Heilige und Herrliche ist Gott freilich auch der verborgene Gott (vgl. Jes 45,15). Kein Mensch kann sein Angesicht sehen und am Leben bleiben (vgl. Ex 33,20). Nur seine souverän freie gnädige Zuwendung kann uns sein tiefstes Wesen offenbaren, das Geheimnis seiner Liebe. "Gott ist Liebe" (1 Joh 4,8.16b; vgl. Hos 2,21; 11,8-9; 14,4; Jer 31,20).
Wir bringen die unvergleichliche Herrlichkeit Gottes oft zum Ausdruck, indem wir sagen: Gott ist überweltlich. Das ist nicht in einem räumlichen Sinn gemeint. Gott ist nicht irgendwo "da oben" in einem Himmel, den man sich als Stockwerk über den Wolken vorzustellen hätte. Gemeint ist vielmehr: Gott übersteigt und überragt die Weltwirklichkeit. Er ist über alles erhaben. Noch mehr: Gott ist ganz anders als die Wirklichkeit der Welt: größer, gewaltiger, geheimnisvoller. Gott übersteigt alle geschöpflichen Unterschiede. Er hat nicht nur männliche, sondern auch weibliche, nicht nur väterliche, sondern auch mütterliche Züge, aber er ist weder männlich noch weiblich, und er begründet weder eine patriarchale noch eine matriarchale, sondern allein eine menschliche Ordnung. Er überragt auch alle Zeit und Geschichte. Seine Ewigkeit ist nicht unendlich fortlaufende Zeit, sondern als Überzeitlichkeit absolute Gleichzeitigkeit. Letztlich übersteigt Gott alle Möglichkeiten unserer Vorstellung, unserer Sprache und unserer Erkenntnis. Man nennt dies die Transzendenz Gottes.
Auf der anderen Seite ist Gott nicht neben oder über der Welt, er ist auch innerweltlich. Er ist uns in allen Dingen nahe. Wir können ihm in den gewöhnlichen wie außergewöhnlichen Ereignissen des Lebens begegnen. Vor allem begegnet er uns durch andere Menschen. Er durchdringt, umfängt, durchwaltet alles. Er ist grenzenlos, unendlich und deshalb allgegenwärtig. "In ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir" (Apg 17,28). Man nennt dies die Immanenz Gottes.
Man kann das Geheimnis Gottes also auf doppelte Weise verfehlen. Man kann entweder Gott und Welt in eins setzen, statt sie zu unterscheiden (Pantheismus). Oder man kann Gott in eine unendliche Ferne rücken, als ob Gott und Welt nichts miteinander zu tun hätten (Deismus). Nur wenn man Nähe und Ferne Gottes zusammen schaut, wird man dem unergründlichen Geheimnis Gottes gerecht. Beides zusammen kommt zum Ausdruck in der Aussage: Gott ist Geist. Denn der Geist durchdringt alles und steht doch zugleich allem anderen gegenüber. So ist das Bekenntnis zu Gott im schärfsten Widerspruch zu jeder Weltanschauung, die meint, die Materie, das Sichtbare, Berechenbare und Machbare, die Bedürfnisse und Interessen der Menschen seien die ursprüngliche, letztgültige, ja einzige Realität (Materialismus). Auch in dieser Hinsicht hat das Bekenntnis zu Gott weitreichende praktische Konsequenzen.
Immer wieder versucht schon die Bibel, von Gott aufgrund seiner geschichtlichen Offenbarung einzelne Eigenschaften auszusagen.
- "Jahwe ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig, reich an Huld und Treue." (Ex 34,6)
Die verschiedenen Eigenschaften Gottes betrachten das eine Wesen Gottes in seinem Verhältnis zur Welt unter verschiedenen Gesichtspunkten. Da Gott Geist ist, weiß er um jeden und um alles, nichts kann ihm verborgen bleiben: Gott ist allwissend. Er wirkt auch alles in allem, nichts und niemand kann sich seiner Herrschaft entziehen: Gott ist allmächtig. Seine Allmacht will jedoch den Menschen nicht unterdrücken, sondern ihn in sein Recht einsetzen; gegen Unrecht und Lüge entbrennt sein Zorn: Gott ist gerecht. Was er will, vollbringt er auch; auf ihn ist unbedingter Verlaß: Gott ist treu und wahr. Er wendet sich vor allem den Kleinen, Armen, Unterdrückten zu, und er vergibt dem Sünder, der umkehrbereit ist: Gott ist gütig und barmherzig. Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe sind kein Gegensatz. Denn die Liebe Gottes bedeutet, daß Gott jeden Menschen unbedingt annimmt; das schließt Gerechtigkeit ein, die jedem gibt, was ihm gebührt. Im biblischen Sinn meint die Gerechtigkeit Gottes sogar die gnädige Zuwendung Gottes zum Menschen, durch die der sündige Mensch erst gerecht wird. Gottes Gerechtigkeit ist also eine schöpferische und schenkende Gerechtigkeit, die sich aus reiner Liebe des Sünders erbarmt.
Die Zusammenfassung dieser spannungsvollen Aussagen findet sich in dem Bekenntnis zu dem einen Gott, dem allmächtigen Vater. Manche haben mit dieser für den christlichen Glauben wesentlichen Aussage Schwierigkeiten, weil sie meinen, mit dem Bekenntnis zu Gott als allmächtigem Vater werde Gott einseitig männlich bestimmt und eine patriarchale Vorherrschaft des Mannes begründet. Doch "Vater" muß bei Gott, der jenseits geschlechtlicher Unterscheidung ist, als Symbolwort verstanden werden. Er bezeichnet Gott als letzten, allumfassenden und doch zugleich transzendenten Ursprung und schöpferischen Lebensquell, der dem Menschen schützend, treu fürsorgend, liebend und erbarmend zugewandt ist. Das Bekenntnis zu Gott dem allmächtigen Vater nennt Gott deshalb einerseits den Allmächtigen, der alles schafft, trägt und lenkt, der die Welt und die Geschichte in seiner Hand hält. Auf der anderen Seite ist dieser allmächtige Gott kein Despot und kein Tyrann, sondern ein gütiger Vater. Er kümmert sich, mehr noch als um das Gras des Feldes und um die Vögel in der Luft, um den Menschen (vgl. Mt 6,26-30). Die Menschen sind nicht seine Sklaven, er macht sie vielmehr zu seinen Söhnen und Töchtern (vgl. Gal 4,6), ja zu seinen Freunden (vgl. Job 15,15). Wenn Gott in der kommenden Herrschaft Gottes einmal "alles und in allem" sein wird (1 Kor 15,28), dann wird zugleich das Reich der Freiheit und die Herrlichkeit der Kinder Gottes angebrochen sein (vgl. Röm 8,21).
2.3 Name und Person Gottes
Sowenig wir einen Menschen kennen, wenn wir nur einzelne Eigenschaften kennen, sowenig können wir Gottes Wesen auf dem Weg über einzelne Eigenschaften glaubend erfassen. Menschen geben sich zu erkennen, indem sie ihren Namen nennen. Der Name ist nicht "Schall und Rauch", er sagt etwas über das Wesen. Wer einen Namen trägt, ist kein Es, sondern ein Ich und ein Du, eine Person, die reden kann und die man anreden kann, eine Person, über die man nicht einfach verfügen kann, die vielmehr ihre unverletzliche Würde hat. Wenn wir jemand mit Namen nennen, geben wir zu erkennen, daß wir ihn kennen und ein Verhältnis zu ihm haben. Wer in der Öffentlichkeit einen Namen hat, der ist nicht irgend jemand, nicht anonym, sondern bekannt und bedeutend. Die Namenlosen dagegen, das sind die Unbedeutenden, die nicht erwähnenswert sind, die keine Stimme und keinen Einfluß haben.
Auch Gott offenbart sich, indem er seinen Namen kundgibt. Die grundlegende Namensoffenbarung Gottes geschieht vor Mose beim brennenden Dornbusch.
"Da sagte Mose zu Gott: Gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen: Wie heißt er? Was soll ich ihnen darauf sagen? Da antwortete Gott dem Mose: Ich bin der ,Ich-bin-da'. Und er fuhr fort: So sollst du zu den Israeliten sagen: Der ,Ich-bin-da' hat mich zu euch gesandt." (Ex 3,13-14)
Die Offenbarung des Namens Gottes JAHWE ist die Mitte der alttestamentlichen Gottesoffenbarung. Wenn Gott einen Namen hat, dann bedeutet dies: Gott ist keine Sache, kein Gegenstand, über den man verfügen kann. Man darf seinen Namen nicht für die eigenen Zwecke mißbrauchen (vgl. Ex 20,7). Daß Gott einen Namen hat, bedeutet vor allem, daß er nicht im Sinn der Aufklärung ein höheres Wesen oder das höchste Wesen ist. Er ist kein abstraktes Prinzip, kein sachhaftes Weltgesetz, kein blinder Urgrund der Welt, nicht das Absolute und das Unendliche, nicht das Sein, auch nicht die Tiefe des Seins. Gott hat einen Namen, das bedeutet: Gott ist kein Es, sondern ein Ich, ein Du. Sein Name ist für den Menschen eine Verheißung und eine Zusage.
Weil Gott einen Namen hat, kann er uns anrufen, und auch wir können ihn anrufen. Er ist kein stummer, sondern ein sprechender und ansprechbarer Gott. An unzähligen Stellen sagt Gott in der Bibel von sich selbst "Ich"
- "Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat." (Ex 20,2, vgl. Hos 12,10)
- "Ich bin Gott, und sonst niemand, ich bin Gott, und niemand ist wie ich. Ich habe von Anfang an die Zukunft verkündet und lange vorher gesagt, was erst geschehen sollte. Ich sage: Mein Plan steht fest, und alles, was ich will, führe ich aus." (Jes 46,9-10)
Weil Gott von sich "Ich" sagt und sich dabei uns zuwendet und eröffnet, dürfen wir Menschen zu ihm du sagen. Wir sollen nicht nur über Gott reden, sondern vor allem mit Gott reden. Wir können seinen Namen anrufen in aller Not und dabei gewiß sein, daß Gott uns hört:
- "Der Herr erhört mich, wenn ich zu ihm rufe." (Ps 4,4)
- "Ich rufe dich an, denn du, Gott, erhörst mich. Wende dein Ohr mir zu, vernimm meine Rede!" (Ps 17,6)
- "Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir: Herr, höre meine Stimme! Wende dein Ohr mir zu, achte auf mein lautes Flehen!" (Ps 130,1-2)
Am deutlichsten wird die Ansprechbarkeit Gottes in der Abba-Anrede Jesu bezeugt. Sie nimmt Gott gerade dadurch als Gott ernst, daß sie ihm alles zutraut. Die persönliche Bitte ist bei Jesus wahres Gotteslob und das Bittgebet der Ernstfall und die Seele des Gottesglaubens.
Die Namensoffenbarung Gottes und die Abba-Anrede Jesu im Gebet berechtigen, ja nötigen uns, zu sagen: Gott ist ein personales Wesen. Nur eine Person kann Ich sagen und sich als Du anreden lassen. Denn eine Person zeichnet sich vor allen anderen Wesen dadurch aus, daß sie ganz in sich steht, unvertauschbar und einmalig ist, und daß sie eben dadurch frei ist, sich anderen zuzuwenden, mit ihnen in Beziehung zu treten und sich ihnen zu erschließen. Selbstverständlich ist Gott nicht in der begrenzten Weise Person, wie wir Menschen Person sind. Aber er ist nicht weniger Person als wir, sondern ist es in einem unendlich höheren Maße.
Das personale Gottesverständnis unterscheidet die Gottesbotschaft des Alten und Neuen Testaments vom Gottesbild der östlichen Hochreligionen: Hinduismus, Buddhismus, Konfuzianismus, Taoismus. Während das Christentum wie auch das Judentum und der Islam das Verhältnis von Gott und Mensch als personale Begegnung und Gemeinschaft verstehen, suchen die östlichen Religionen die Enge und Beschränktheit der Individualität zu überwinden und Befreiung dadurch zu finden, daß sie im bergenden All-Einen bzw. im übergegenständlichen Nirwana aufgehen. Sie befürchten, durch die Personalität werde Gott zu einem endlichen Gegenüber des Menschen, der Mensch aber in seiner Ichhaftigkeit und Selbstherrlichkeit bestärkt. Die östlichen Religionen sind damit vom Christentum zutiefst verschieden. Gebet und Meditation haben im Christentum und in den östlichen Religionen, bei allen Parallelen im einzelnen, einen unterschiedlichen Sinn. Im Christentum: Freundschaftsverkehr mit Gott, im Osten: Verschmelzung und Einswerden mit dem Ganzen. Trotz dieser unübersehbaren Unterschiede gilt: "Die katholische Kirche lehnt nichts von alledem ab, was in diesen Religionen wahr und heilig ist." Deshalb mahnt sie zum Gespräch und zur Zusammenarbeit "mit Klugheit und Liebe" (NA 2).
Auch manche Christen haben heute ähnliche Einwände gegen ein personales Gottesverständnis bis hin zur Konzeption eines Christentums ohne Gott. Doch die Leugnung oder Verdunkelung der Personalität Gottes schafft ein anderes Evangelium als das, welches die Heilige Schrift bezeugt. Sie macht aus Gott ein Es, aus der Heilsbotschaft des "Ich bin mit euch" eine allgemeine Weltanschauung, die niemandem nützt. Denn Person will Person. Nur wenn Gott absolute Person ist, sind wir als Personen absolut angenommen und bejaht. Das personale Gottesverständnis tut der Unbegrenztheit und Unendlichkeit Gottes keinen Abbruch. Denn zum Begriff der Person gehört beides: sie ist ganz und gar einmalig und zugleich unendlich offen. Der Begriff Personalität ist also umfassender als der der Individualität. So verstanden kann der Personbegriff in seiner Anwendung auf Gott gültig zum Ausdruck bringen, daß Gott der alles Umfassende und alles Umgreifende, der Allmächtige ist und daß er dies in ganz einmaliger Weise als das Geheimnis der alles umfassenden, unergründlichen Liebe des Vaters ist.
Das personale Wesen Gottes ist die tiefste Begründung für die personale Würde jedes Menschen. Deshalb ist es ein Mißverständnis zu meinen, Gott sei im Grunde nichts anderes als ein Ausdruck für ein gutes mitmenschliches Verhalten, eine bestimmte Art der Mitmenschlichkeit. Daran ist richtig, daß Gottes Liebe zu uns unsere Liebe untereinander begründet. Die Liebe zu Gott ist unlösbar mit der Liebe zum Nächsten verbunden (vgl. Mk 12,30-31). Gott ist nie nur eine Privatsache und eine reine Herzensangelegenheit; unser Gottesglaube hat Bedeutung für die anderen. Denn wie können wir einander als Menschen unbedingt lieben, wenn wir nicht zuvor unbedingte Liebe erfahren haben und so zur Liebe erweckt und befähigt worden sind? Gott muß uns also zuerst lieben. Nur wenn Gott uns unbedingt annimmt, können auch wir einander unbedingt annehmen und bejahen. Deshalb geht der christliche Glaube nicht in der "Horizontalen" auf; zu ihm gehört wesentlich auch die "vertikale" Richtung. Nur wenn Gott in sich ein personales Wesen ist, können wir gemeinsam zu ihm sagen: "Unser Vater". Weil Gott darüber hinaus der Vater aller Menschen ist, sind alle Menschen Brüder und Schwestern.
3. Gott, der Vater Jesu Christi
3.1 Jesus Christus - der Sohn Gottes
Das Bekenntnis zum einen Gott, dem allmächtigen Vater, ist Christen und Juden, in etwa auch den Muslimen, gemeinsam. Erst jetzt, da wir von Gott, dem Vater Jesu Christi, und d. h. von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist sprechen, kommen wir zum unterscheidend christlichen Gottesverständnis nicht nur im Verhältnis zu den östlichen Religionen, sondern auch zum Judentum und erst recht zum Islam. Wie das Judentum und der Islam bekennt sich das Christentum zu dem einen und einzigen Gott; aber es bekennt den einen Gott in drei Personen: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Mit diesem zentralen christlichen Glaubensartikel haben heute auch viele Christen Schwierigkeiten. Sie meinen, dieses Bekenntnis sage ihnen nichts. Sie halten es für eine weltferne Spekulation, von der sie oft auch behaupten, sie sei überdies bibelfern und bibelfremd. Ausdrücklich verworfen wird dieses Bekenntnis von den Zeugen Jehovas.
Um Klarheit zu gewinnen, müssen wir uns auf unseren Ausgangspunkt besinnen: Christ ist, wer sich in seinem Denken und in seinem Leben ganz an Jesus Christus orientiert und sich zu ihm bekennt. Auch wer Gott wirklich ist, wissen wir als Christen endgültig letztlich erst durch Jesus Christus. Er hat in einer ganz einmaligen Weise von Gott gesprochen. Wie war das möglich? Woher nahm Jesus die Gewißheit, so von Gott zu reden?
Offensichtlich konnte Jesus nur deshalb so von Gott sprechen, von Gott her, mit Gott und auf Gott hin leben, weil er selbst in einem ganz einzigartigen Gottesverhältnis stand. Nach dem Zeugnis der Evangelien steht Jesus in einem anderen Verhältnis zum Vater als wir. Niemals zeigen uns die Evangelien Jesus eingereiht in den Kreis der übrigen Beter, vielmehr in einer Sonderstellung, durch die er sich von den anderen Betern unterscheidet (vgl. Mk 1,35; 6,46, 14,32-42; Joh 17,1). Sein Verhältnis zum Vater ist so einmalig und einzigartig, daß er niemals mit den Jüngern auf einer Stufe steht. Nie sagt er "unser Vater" in dem Sinn, daß er sich mit anderen Menschen zusammenschließt. Es heißt immer: "mein Vater" - "euer Vater" oder "der Vater". Der Auferstandene sagt zu Maria Magdalena:
- "Geh aber zu meinen Brüdern, und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott." (Joh 20,17)
Wer ist Jesus? Worin liegt nun das Einmalige und Einzigartige im Verhältnis Jesu zu seinem Gott und Vater? Ist Jesus ein Prophet, vielleicht der letzte und größte der Propheten? In der Geschichte Israels haben ja immer wieder von Gott Erwählte und Gesandte wie Mose und die Propheten in Gottes Auftrag und Namen zum Volk gesprochen. Jesus aber steht über Mose und den Propheten, er steht über dem Gesetz und über dem Tempel. Deshalb kann er sagen:
- "Ihr habt gehört, daß zu den Alten gesagt worden ist... Ich aber sage euch..." (Mt 5,21-22.27-28 u. a.)
- "Ihr aber seid selig, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören. Amen, ich sage euch: Viele Propheten und Gerechte haben sich danach gesehnt zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört." (Mt 13,16-17)
- "Die Männer von Ninive werden beim Gericht gegen diese Generation auftreten und sie verurteilen; denn sie haben sich nach der Predigt des Jona bekehrt. Hier aber ist einer, der mehr ist als Jona. Die Königin des Südens wird beim Gericht gegen diese Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Hier aber ist einer, der mehr ist als Salomo." (Mt 12,41-42)
Jesus ist mehr als ein Prophet; er weiß sich in einem einmaligen Sohnes-Verhältnis zu seinem Vater. Er ist der eine Sohn des Vaters, dem der Vater alles geoffenbart und übergeben hat, damit er uns erst zu Söhnen und Töchtern macht. "Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden; niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will." (Mt 11,27)
Das Neue Testament hat entfaltet, was in diesem Sohnes-Verhältnis enthalten ist. Es sagt, Jesus ist "der Sohn" (vgl. Mk 1,11; 13,32; Röm 1,3; 8,3 u. a.) und "der Sohn Gottes" (vgl. Mk 1,1; Mt 16,16; Job 1,34 u. a.). Umgekehrt ist Gott für das Neue Testament der Vater unseres Herrn Jesus Christus (vgl. 2 Kor 1,3 u. a.). Deshalb gilt: Wer Jesus sieht, der sieht den Vater (vgl. Job 14,10). Als Sohn ist Jesus das Bild, die Ikone Gottes, des Vaters (vgl. 2 Kor 4,4; Kol 1,15). In ihm wird Gott anschaulich als der Gott mit einem menschlichen Antlitz. In Jesus Christus ist Gott endgültig und ganz offenbar geworden, so daß man christlich von Gott nicht mehr unter Absehung von Jesus Christus sprechen kann. Daraus erkennen wir, daß die Vater-Sohn-Beziehung Jesu in das ewige Wesen Gottes hineingehört. So ist Jesus Christus der ewige Sohn Gottes, den Gott in die Welt gesandt hat (vgl. Röm 8,3; Gal 4,4; Joh 3,17) (Praeexistenz). Er ist von Ewigkeit her in der Gestalt Gottes (vgl. Phil 2,6) und in der Herrlichkeit Gottes (vgl. Joh 17,5), das Wort, in dem sich der Vater von Ewigkeit her ausspricht. Als Wort und Bild des Vaters ist der Sohn zugleich das Urbild der Schöpfung. In ihm wird sowohl das Geheimnis Gottes wie das der Welt und des Menschen offenbar. Der Prolog des Johannesevangeliums faßt dies alles zusammen:
- "Im Anfang war das Wort,
- und das Wort war bei Gott,
- und das Wort war Gott.
- Im Anfang war es bei Gott.
- Alles ist durch das Wort geworden..." (Joh 1,1-3)
In der Auseinandersetzung mit ungläubigen Juden sagt Jesus: "Ich und der Vater sind eins" (Joh 10,30). Schließlich spricht Thomas am Schluß des vierten Evangeliums das Bekenntnis: "Mein Herr und mein Gott!" (Joh 20,28. Diese Aussagen der Heiligen Schrift führten in den ersten Jahrhunderten zu langen und schwierigen Auseinandersetzungen. In der Tat war diese Lehre sowohl für Juden wie für die Hellenisten schwer verständlich. Ist Jesus ein zweiter, dem Vater untergeordneter Gott? Oder ist er eine bestimmte Erscheinungsform (Maske) der einen Gottheit? Beide Meinungen wurden vertreten und verworfen. Um 320 verbreitete Arius die Ansicht, der Sohn sei dem Vater untergeordnet und nicht wahrer Gott, sondern Gottes erstes und vollkommenstes Geschöpf, durch dessen Vermittlung Gott die Welt erschaffen hat. Damit stellte Arius den Sohn nicht auf die Seite Gottes, sondern auf die Seite der Geschöpfe. Er entsprach damit dem philosophischen Denken seiner Zeit, nicht aber der Offenbarung und dem Glauben der Kirche. Als schärfster Gegner der Lehren des Arius und als geistesmächtigster Anwalt des überlieferten kirchlichen Glaubens trat der hl. Athanasius, der spätere Bischof von Alexandrien, auf. Sein wichtigstes Argument: Wäre Jesus nur ein wenn auch noch so edles und hohes Geschöpf, dann könnte er uns nicht von der Macht der Sünde und des Todes erlösen.
Diese Auseinandersetzungen waren Anlaß für die Kirche, auf dem ersten allgemeinen Konzil, dem Konzil von Nikaia (325), ihren Glauben an die Gottheit des Sohnes feierlich zu bekennen und näher zu beschreiben. Den Konzilsvätern ging es nicht um Spekulationen, sondern darum, das Zeugnis der Heiligen Schrift vor Mißdeutungen zu verteidigen und den in der Kirche überlieferten Glauben zu bewahren. Der Glaube des Konzils von Nikaia ist uns im "Großen Glaubensbekenntnis" überliefert. Es verbindet bis heute alle Kirchen des Ostens und des Westens:
- "Wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus,
- Gottes eingeborenen Sohn,
- aus dem Vater geboren vor aller Zeit:
- Gott von Gott, Licht vom Licht,
- wahrer Gott vom wahren Gott,
- gezeugt, nicht geschaffen,
- eines Wesens mit dem Vater."
Dieses grundlegende Bekenntnis will sagen: In Jesus Christus ist ein für allemal und endgültig offenbar geworden, wer Gott ist und wer der Mensch ist. In Jesus Christus ist in der Zeit und in der Geschichte offenbar geworden, daß Gott, wie Jesus Christus ihn verkündet, kein starres, einsames Wesen ist, das nur im Gespräch mit sich selber und eifersüchtig auf sich selbst bedacht ist. Vielmehr ist Gott von aller Ewigkeit her die Liebe, die sich selbst verschenkt und mitteilt. Von Ewigkeit her teilt der Vater alles, was er ist, dem Sohn mit. Der Vater lebt im Bezug auf den Sohn, im Sich-selbst-Verschenken an den Sohn. Ebenso lebt der Sohn im Bezug zum Vater; indem er sich vom Vater empfängt und liebend auf den Vater zurückbezieht, ist er der Sohn. Der Vater ist der Ursprung und die Quelle des Sohnes. Der Sohn besitzt aber dasselbe Gottsein als vom Vater geschenktes. Deshalb ist er eines Wesens mit dem Vater. Er ist daher nicht wie die Geschöpfe aus dem Nichts hervorgebracht, nicht geschaffen, sondern gezeugt, ohne zeitlichen Anfang, im ewigen Jetzt der Ewigkeit Gottes.
Das ist zweifellos ein undurchdringliches Geheimnis - das Geheimnis einer unbegreiflichen, sich selbst verströmenden Liebe. In der Offenbarung dieser Liebe hat Gott in Jesus Christus auch "dem Menschen den Menschen" geoffenbart und ihm sein tiefstes Geheimnis erschlossen (GS 22). In Jesus Christus ist der Mensch von Ewigkeit her von Gott angenommen und geliebt und zur Liebe bestimmt. Zu dieser Teilhabe an der Gemeinschaft der Liebe zwischen Vater und Sohn sind wir berufen im Heiligen Geist.
3.2 Der Geist - der Herr ist und lebendig macht
Vom Heiligen Geist ist trotz charismatischer Erneuerungsbewegung in der Kirche und in den Gemeinden gewöhnlich wenig die Rede. Für viele ist diese Rede schier unverständlich. Was ist das: Geist?, heiliger Geist? oder gar der Heilige Geist als göttliche Person?
Ursprünglich meint Geist im biblischen Sprachgebrauch Wind, Luft, Sturm, dann Atem als Zeichen des Lebens. Gottes Geist ist darum der Sturm und der Atem des Lebens; er ist es, der alles schafft, trägt und erhält. Er ist es vor allem, der in der Geschichte wirkt und Neues schafft. Im Alten Testament wirkt er vor allem durch die Propheten. Im Credo bekennen wir: "der gesprochen hat durch die Propheten". Für das Ende der Zeit erhofft das Alte Testament vom Geist die große Erneuerung durch eine allgemeine Ausgießung des Geistes (vgl. Joël 3,1-2).
Diese endzeitliche Erneuerung sieht das Neue Testament in Jesus Christus gekommen. Sein Auftreten und Wirken war von Anfang an vom Wirken des Geistes begleitet: bei der Taufe durch Johannes (vgl. Mk 1,10), in seiner Verkündigung (vgl. Lk 4,18), in seinem Kampf gegen die Dämonen (vgl. Mt 4,1; 12,28), bei seiner Kreuzeshingabe (vgl. Hebr 9,14) und bei seiner Auferweckung (vgl. Röm 1,4; 8,11). Der Name "Christus" war ursprünglich ein Titel: Jesus ist der vom Geist Gesalbte, der Messias. Jesus Christus ist jedoch nicht Geistträger wie die Propheten. Er besitzt den Geist Gottes in ungemessener Fülle. Als Auferstandener ist er deshalb Quelle des göttlichen Geistes; er schenkt ihn als Gottes Gabe den Aposteln, er sendet ihn an Pfingsten seiner Kirche (vgl. Apg 2, 32-33).
Die Sendung des Heiligen Geistes ist es, an alles zu erinnern, was Jesus Christus gesagt und getan hat und uns so in die ganze Wahrheit einzuführen (vgl. Joh 14,26; 16,13-14). In ihm ist Jesus Christus bleibend in der Kirche und in der Welt gegenwärtig (vgl. 2 Kor 3,17). Deshalb wird der Heilige Geist als Geist Jesu Christi (vgl. Röm 8,9; Phil 1,19) und als Geist des Sohnes (vgl. Gal 4,6) bezeichnet. Er wird auch Geist des Glaubens genannt (vgl. 2 Kor 4,13); durch ihn können wir Jesus Christus als Herrn bekennen (vgl. 1 Kor 12,3) und beten: "Abba, Vater" (Röm 8,15; vgl. Gal 4,6). Der Heilige Geist ist die Gabe des neuen Lebens. Vater und Sohn senden ihn uns. Indem Gott uns seinen Geist schenkt, schenkt er sich selbst. Durch die Gabe des Geistes empfangen wir Gemeinschaft mit Gott, nehmen wir teil an seinem Leben, werden wir Kinder Gottes (vgl. Röm 8,14; Gal 4,6). Das ist nur möglich, weil der Geist nicht geschöpfliche, sondern göttliche Gabe ist, in der sich uns Gott selbst mitteilt.
- "Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist." (Röm 5,5)
Der Geist Gottes ist aber nicht nur Gabe, er ist auch Geber. Er ist nicht nur eine Kraft, mit der jemand wirken kann, sondern selbst auch ein Wirkender. Er ist nicht etwas, sondern jemand: Er ist Person. Er teilt seine Gaben aus, wie er will (vgl. 1 Kor 12,11); er lehrt und erinnert (vgl. Joh 14,26); er spricht und betet (vgl. Röm 8,26-27); man kann ihn betrüben (vgl. Eph 4,30).
Auch über diese Frage kam es zu Auseinandersetzungen, vor allem im 4. Jahrhundert. Manche meinten, der Heilige Geist sei nur ein dem Sohn untergeordneter Diener, eine Art Engelwesen. Dagegen wandten sich die drei großen griechischen Kirchenväter: Basilius, Gregor von Nazianz, Gregor von Nyssa. Ihr Argument: Wenn der Heilige Geist nicht göttlichen Wesens ist wie der Vater und der Sohn, dann kann er uns auch nicht die Gemeinschaft mit Gott und die Teilhabe am Leben Gottes schenken. So vorbereitet, konnte die Kirche auf dem zweiten allgemeinen Konzil, dem Konzil von Konstantinopel (381), bekennen, daß der Heilige Geist Herr, d. h. göttlicher Art ist, daß er nicht nur Gabe, sondern Spender des Lebens ist und daß ihm mit dem Vater und dem Sohn göttliche Anbetung und Verherrlichung gebührt. Dieser Glaube kommt im "Großen Glaubensbekenntnis" zum Ausdruck:
- "Wir glauben an den Heiligen Geist,
- der Herr ist und lebendig macht,
- der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht,
- der mit dem Vater und dem Sohn angebetet
- und verherrlicht wird."
Die Formulierung "und dem Sohn", das berühmte Filiogue, war im ursprünglichen Glaubensbekenntnis von Konstantinopel noch nicht enthalten. Sie kam als Lehrformel in Spanien im 5.-7. Jahrhundert auf, wurde aber erst im 11. Jahrhundert ins Glaubensbekenntnis der römischen Kirche aufgenommen. Bis heute stellt diese Zusatzformulierung einen Unterschied zu den orthodoxen Kirchen dar. Die Orthodoxen gebrauchen die Formel "aus dem Vater durch den Sohn". Damit wollen sie deutlicher zum Ausdruck bringen, daß in Gott der Vater allein Ursprung und Quelle ist. Die römische Kirche und die anderen westlichen Kirchen wollen deutlicher betonen, daß der Sohn mit dem Vater wesenseins und ihm gleichgestellt ist. In diesem Grundanliegen kommen Ost und West überein. Sie benutzen aber unterschiedliche theologische Begriffe und Denkmodelle. Deshalb liegt hier nach heutiger römisch-katholischer Überzeugung eine legitime Einheit in der Vielfalt, aber kein kirchentrennender Unterschied vor.
Dieses Ost und West verbindende Bekenntnis will sagen: Der Heilige Geist ist nicht nur irgendeine Gabe Gottes, er ist Gottes Gabe in Person. Denn das Leben des Menschen und sein Geheimnis finden erst in der Teilhabe am Leben und Geheimnis Gottes ihre Erfüllung. Doch der Heilige Geist ist nicht nur das Gabesein Gottes, sondern auch der göttliche Geber dieser Gabe, der Spender des Lebens. Wie der Vater der Ursprung und die Quelle des Sohnes ist und alles, was er ist, dem Sohn schenkt, so schenken Vater und Sohn bzw. der Vater durch den Sohn die ihnen eigene Fülle des göttlichen Lebens und Seins weiter und bringen so gemeinsam den Heiligen Geist hervor. Wie der Geist gegenüber Vater und Sohn reines Empfangen ist, so ist er gegenüber uns sprudelnde Quelle, Spender des Lebens. Er ist die bewegende und schöpferische Kraft des neuen Lebens und der endzeitlichen Verwandlung des Menschen und der Welt.
Was dieses vom Heiligen Geist geschenkte Leben bedeutet, bringt der bekannte Hymnus "Veni Creator Spiritus" aus dem 9. Jahrhundert (Übertragung von Friedrich Dörr 1969, Gotteslob 241) in schöner Weise zum Ausdruck (ähnlich der Hymnus "Veni Sancte Spiritus", der um 1200 entstanden ist):
- "Komm, Heiliger Geist, der Leben schafft,
- erfülle uns mit deiner Kraft.
- Dein Schöpferwort rief uns zum Sein:
- nun hauch uns Gottes Odem ein ...
Aus dir strömt Leben, Licht und Glut, du gibst uns Schwachen Kraft und Mut..." Schöner als es in diesen Liedern geschieht, kann kein Konzil, kein Katechismus und kein Theologe ausdrücken, was wir meinen, wenn wir bekennen: "Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht."
3.3 Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist
Noch steht uns der schwierigste Teil und das tiefste Geheimnis des christlichen Bekenntnisses zu Gott bevor: das Bekenntnis zum dreieinigen (oder wie man auch sagt: dreifaltigen) Gott. Die Kritik an dieser Lehre ist bekannt: sie sei das Ergebnis spitzfindiger Spekulationen weltfremder Mönche und Theologen aus längst vergangener Zeit, für den schlichten, unmittelbaren Glauben und für das christliche Leben könne man damit nichts anfangen. Im übrigen sei diese Lehre schlicht unverständlich, ja widersinnig und unlogisch. Das letztere wäre in der Tat der Fall, würde das Bekenntnis sagen: Dreimal eins ist eins. Doch davon kann, wie gleich zu zeigen sein wird, keine Rede sein.
Der Ursprung dieses Bekenntnisses sind nicht weltfremde Spekulationen. Es erwächst vielmehr aus der Erfahrung mit Jesus Christus und seines in der Kirche weiterwirkenden Geistes. Bereits der Taufbefehl des auferstandenen Herrn faßt die Offenbarung des dreieinigen Gottes zusammen:
- "Darum geht zu allen Völkern, und macht alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes." (Mt 28,19)
In der Taufe erhält der Mensch Anteil am Leben und an der Gemeinschaft Gottes: Er wird dem Sohn Gottes so verbunden, daß er, von seinem Geist erfüllt, Kind Gottes, des Vaters, wird. Deshalb faßt der Apostel Paulus das dreifaltige Geheimnis Gottes als Segens- und Gnadenwunsch zusammen. Wir kennen ihn als Eingangsgruß bei der Eucharistiefeier:
- "Die Gnade Jesu Christi, des Herrn, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!" (2 Kor 13,13)
Aus diesem Ursprung geht hervor, daß das Bekenntnis zum dreifaltigen Gott die Summe des christlichen Glaubens ist. Das Christsein wird nämlich bis heute dadurch begründet, daß man getauft wird "im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes". Jede Eucharistiefeier, die Mitte des christlichen und kirchlichen Lebens, wird im Namen des dreieinigen Gottes eröffnet und geschlossen.
Die lehrhafte Entfaltung des Zeugnisses der Heiligen Schrift geschah nach langen Auseinandersetzungen durch die beiden ersten allgemeinen Konzilien in Nikaia (325) und Konstantinopel (381). Zwei irrtümliche Lehren mußten vor allem zurückgewiesen werden: als seien Sohn und Geist dem Vater untergeordnet und als erscheine der eine Gott nur gleichsam hinter drei verschiedenen Masken als Vater, Sohn und Geist. Demgegenüber hielt die Kirche daran fest: Wie Gott erscheint, so ist er auch, Gott erscheint in Jesus Christus als der er ist - Gott ist also Vater, Sohn und Geist. Und doch sind es nicht drei Götter, sondern ein einziger Gott in drei Personen. Maßgebend beteiligt an dieser Klärung waren im Osten der hl. Basilius, Gregor von Nazianz und Gregor von Nyssa, im Westen der hl. Augustinus mit seinem 15 Bücher umfassenden Werk "Über den dreieinigen Gott".
Das Dreifaltigkeitsbekenntnis ist von größter ökumenischer Bedeutung. Es verbindet die römisch-katholische Kirche mit den orthodoxen Kirchen; auch die Reformatoren hielten daran fest. In den Schmalkaldischen Artikeln sagt Luther ausdrücklich, in den hohen Artikeln der göttlichen Majestät sei kein Zank noch Streit. Sowohl das (lutherische) Augsburger Bekenntnis wie der (reformierte) Heidelberger Katechismus bekennen sich zum dreieinigen Gott. Der Ökumenische Rat der Kirchen versteht sich gemäß seiner Basisformel als "eine Gemeinschaft von Kirchen, die den Herrn Jesus Christus gemäß der Heiligen Schrift als Gott und Heiland bekennen und darum gemeinsam zu erfüllen trachten, wozu sie berufen sind, zur Ehre Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes".
Der Inhalt dieses ökumenischen Bekenntnisses zum dreieinigen Gott lautet in seiner kürzesten Form-. ein Gott in drei Personen. Das Bekenntnis sagt also nicht: eine Person = drei Personen, ein Gott = drei Götter, was widersinnig wäre. Das sogenannte Athanasianische Glaubensbekenntnis (das freilich nicht vom hl. Athanasius stammt, sondern vermutlich erst um 500 entstanden ist) formuliert:
- "Wir verehren den einen Gott in der Dreifaltigkeit und die Dreifaltigkeit in der Einheit, ohne Vermengung der Personen und ohne Trennung der Wesenheit."(DS 75, NR 915)
Ähnlich heißt es in der Präfation des Dreifaltigkeitsfestes:
- "Mit deinem eingeborenen Sohn und dem Heiligen Geist bist du (der Vater) der eine Gott und der eine Herr, nicht in der Einzigkeit einer Person, sondern in den drei Personen des einen göttlichen Wesens."
Dieses Bekenntnis zum dreieinigen Gott ist ein tiefes Geheimnis, das kein geschaffener Geist von sich aus zu entdecken oder jemals zu begreifen vermag. Es ist das Geheimnis einer unergründlichen und überströmenden Liebe: Gott ist kein einsames Wesen, sondern ein Gott, der aus der Überfülle seines Seins heraus sich schenkt und mitteilt, ein Gott, der in der Gemeinschaft von Vater, Sohn und Geist lebt und der darum auch Gemeinschaft schenken und begründen kann. Weil er Leben und Liebe in sich ist, kann er Leben und Liebe für uns sein. So sind wir von Ewigkeit her in das Geheimnis Gottes einbezogen. Gott hat von Ewigkeit her Platz für den Menschen. Letztlich ist das Bekenntnis zum dreifaltigen Gott eine Auslegung des Satzes: "Gott ist Liebe" (1 Joh 4,8.16b). Daß Gott von Ewigkeit her in sich Leben und Liebe ist, bedeutet seine Seligkeit und begründet für uns Menschen inmitten einer Welt des Todes und des Hasses unsere Hoffnung. Wir dürfen im Glauben wissen, daß die letzte und tiefste Wirklichkeit Leben und Liebe ist und daß uns durch Jesus Christus im Heiligen Geist Anteil an dieser Wirklichkeit geschenkt ist.
4. Das Gebet - Ausdruck des Glaubens an Gott
4.1 Beten - was ist das?
Unsere Antwort auf das Wort Gottes, in dem er uns das innerste Geheimnis seiner Liebe offenbart, ist nicht in erster Linie das Denken, sondern das Danken - das Gebet. An Gott glauben bedeutet ja nicht nur die Überzeugung, daß Gott existiert, sondern vielmehr die persönliche Hinwendung zu Gott, dem letzten Grund und Ziel, dem Halt und Inhalt unseres Lebens. Das Gebet ist der wichtigste und wesentlichste Ausdruck des Glaubens an Gott; es ist antwortender Glaube, sozusagen der Ernstfall des Glaubens.
Die Heilige Schrift, vor allem Jesus selbst, mahnt uns deshalb immer wieder eindringlich zum beharrlichen Gebet (vgl. Mk 11,24; Mt 7,7-11, 21,22; Lk 11,9-13). Die Heilige Schrift nennt uns viele Beispiele des Betens. Das Buch der Psalmen ist ein einziges Gebetbuch. Vor allem wird uns berichtet, daß Jesus selbst gebetet hat. Am Sabbat ging er "wie gewohnt" in die Synagoge (Lk 4,16). An den Wendepunkten seines Wirkens hat er sich jeweils in die Einsamkeit zurückgezogen zum Gebet zu Gott, seinem Vater (vgl. Lk 3,21; 5,16; 6,12; 9,28; 10,21; 11,1). Sein Gebet war sowohl Dank und Preis (vgl. Mt 11,25-27; Lk 10,21-22) wie auch Klage, Bitte und Ergebung in den Willen des Vaters (Mk 14,33-36 par.; Hebr 5,7-8). So kann niemand als Christ leben, ohne zu beten.
Das Gebet ist freilich für viele Christen auch die eigentliche Not ihres Glaubens. Nicht ob man beten soll, ist ihnen problematisch, sondern wie man beten soll und beten kann. Daneben gibt es aber auch grundsätzliche Einwände gegen das Beten. Manche fürchten, das Gebet könne eine Flucht sein vor der Verantwortung und dem Einsatz in der Welt, eine Vertröstung, welche die Kraft und die Phantasie des Menschen lähmt. Andere halten das Gebet für eine kindliche Verhaltensweise. Weil der Mensch, so sagen sie, nicht stark und erwachsen genug ist, um die harte Wirklichkeit nüchtern zu ertragen, betrügt er sich selbst, projiziert und konstruiert er ein Gegenüber, bei dem er sich geborgen wähnt. Wieder andere argwöhnen, im Gebet werde Gott in sublimer Weise für die Zwecke, Interessen und Bedürfnisse des Menschen mißbraucht und verfügbar gemacht.
Niemand kann bestreiten, daß es solche Zerrformen des Gebetes gibt. Aber treffen sie das wahre Beten, wie es uns in den Psalmen, von Jesus, von den großen Heiligen bezeugt ist? Was heißt das also, beten?
Einer der größten Theologen der Christenheit, der hl. Thomas von Aquin, gibt die wohl zutreffendste Antwort. Er definiert das Gebet als Ausdruck der Sehnsucht des Menschen vor Gott. Damit ist das Gebet mehr als Einkehr und Besinnung, mehr als Hygiene und Kultur der Seele oder ein bloßes psychologisches "Auftanken". Im Gebet betrachtet der Mensch sich und seine Situation vor Gott, auf ihn hin und von ihm her. Dabei erfährt er, daß er ein der Hilfe bedürftiges Geschöpf ist, ohnmächtig, sich die Erfüllung seines Daseins und seiner Hoffnung selbst zu geben. Allein Gott, der Grund und das Ziel des Menschen, ist groß genug, um das Herz des Menschen ganz auszufüllen. Darum ist das Gebet Aufbruch zu Gott, Erhebung des Herzens zu Gott, Begegnung des Menschen mit Gott. Die tiefste Sehnsucht des Menschen ist das Einswerden mit Gott, d. h. die Gemeinschaft und die Freundschaft mit ihm. Die eigentliche Definition des Gebetes lautet deshalb: Das Gebet ist ein Gespräch mit Gott, Austausch der Freundschaft mit ihm (Teresa von Avila).
Das alles zeigt: Das Gebet ist keine schwächliche Flucht vor der Realität; es ist das einzig realitätsgerechte Verhalten des Menschen. Das Gebet bedeutet ein Standhalten in der Hoffnung ohne alle Illusionen. Deshalb ist es auch eine Hilfe, um mit uns, mit den andern und mit der Welt ins reine zu kommen. Es klärt und läutert die Grundhaltung des Menschen, entlarvt bloßen Schein, mit dem wir uns und den andern etwas vormachen. Es gibt uns die Kraft, von unseren Lebenslügen zu lassen und die Wahrheit über uns und unser Leben anzuerkennen. Dabei ist wahres Beten nie folgenlos. Es bewährt sich in der Umkehr und in der Hinkehr zu Gott wie zu den andern. Es gibt uns die Gewißheit, daß das Tun der Liebe niemals sinnlos sein kann. So gibt das Beten auch Mut und Kraft zum Einsatz in der Welt. Es ist zugleich Ausdruck der Demut wie der Großmut. Es lehrt uns Gelassenheit ohne alle Resignation und hilft uns, uns selbst, die andern und die Welt anzunehmen, weil wir von Gott unbedingt und absolut angenommen sind. So schenkt das Gebet innere Ruhe und Freude, Trost, ohne jemals bloße Vertröstung zu sein. Wo aber aller Trost als Vertröstung verleumdet wird, da wird das Dasein selbst trostlos.
4.2 Beten - wie geht das? Formen des Gebets
Das Gebet ist etwas höchst Persönliches und deshalb etwas äußerst Vielfältiges. Es gibt keine Rezepte oder Techniken für das Beten. Eines aber steht für das Neue Testament unumstößlich fest: Ein rein äußerliches Aufsagen von Gebetsformeln ist wertlos. Jesus lehnt dies ausdrücklich ab und spricht von einem "Plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen" (Mt 6,7). Das Gebet kann sehr nüchtern und schmucklos sein. Beten kann darin bestehen, daß einer sein Herz ausschüttet vor Gott, daß er klagt und fragt: Warum? Es kann in der Bitte für sich oder für andere bestehen: "Herr, hilf doch!" Beten kann im Bekenntnis von Sünde und Schuld, in der Ergebung in Gottes Willen und im Versprechen, ihn zu erfüllen, bestehen, aber auch in Lob, Dank und Anbetung. So unterscheiden wir neben der Klage, dem Bekenntnis und dem Gelübde vor allem das Lobgebet, das Dankgebet und das Bittgebet.
Die Weisen des Gebetes unterscheiden sich nicht nur dem Inhalt, sondern auch der Form nach. Es gibt das mündliche Gebet, das frei und spontan geschehen, das sich aber auch an einen vorgeformten Text halten kann. Dieses mündliche Gebet kann verborgen im stillen Kämmerlein (vgl. Mt 6,6) oder in Gemeinschaft, sei es in der Familie, in einer Gruppe oder in der offiziellen Liturgie erfolgen. Zum mündlichen Gebet gehört auch die rhythmische Wiederholung bestimmter Formeln, etwa im Jesus-Gebet der Ostkirche, beim Rosenkranz oder bei Litaneien. Das hat, recht vollzogen, nichts mit einem mechanischen Herunterleiern zu tun, der Rhythmus entspricht der leib-seelischen Ganzheit des Menschen, er kann eine Hilfe sein, eine bestimmte Aussage innerlich immer mehr auszuschöpfen. Das vollkommenste mündliche Gebet ist das Gebet, das uns der Herr selbst zu beten gelehrt hat, das "Vater unser" (vgl. Lk 11,2-4; Mt 6,9-13). Es verbindet das Lob und den Preis Gottes mit der Bitte um das, was dem Menschen vor allem notwendig ist. Deshalb sollen wir dieses Gebet immer wieder sprechen und es zum Maßstab unseres Betens machen.
Zum mündlichen Gebet kommt das betrachtende Gebet, d. h. das Nachsinnen über einen Text, vor allem einen Text aus der Heiligen Schrift (Textbetrachtung), ein religiöses Bild (Bildbetrachtung) oder eine Lebenssituation (Lebensbetrachtung). Dabei geht es nicht um möglichst kluge Gedanken, Analysen und Informationen; "denn nicht das Vielwissen sättigt die Seele und gibt ihr Genüge, sondern das Fühlen und Kosten der Dinge von innen" (Ignatius von Loyola).
Von besonderer Bedeutung ist schließlich das innere Gebet; man nennt es auch das beschauende Gebet oder besser: das Herzensgebet. Es meint ein unmittelbares Innewerden der Gegenwart Gottes, ein unmittelbares Sich-angesprochen-Wissen und ein antwortendes Du-Sagen. Es kann auch im Wandel in Gottes Gegenwart, im Finden Gottes in allen Dingen bestehen und so mitten im Alltag geschehen. Bei besonders begnadeten Betern kann das innere Gebet bis zur innigsten mystischen Vertrautheit mit Gott führen. Das Entscheidende dabei sind nicht außerordentliche Erfahrungen oder geistliche Hochstimmungen. Gerade die großen Beter in der Heiligengeschichte berichten, daß das innere Gebet sehr oft verbunden ist mit Erfahrungen geistlicher Trockenheit und Trostlosigkeit, mit der Erfahrung der dunklen Nacht, in der ihnen die ganze Verborgenheit und Geheimnishaftigkeit Gottes aufgegangen ist.
Das alles zeigt: Es gibt nicht nur vielfältige Weisen des Betens, es gibt in jedem ernsthaften Christenleben auch einen Weg des Betenlernens und Stufen der Gebetserfahrung. So sehr uns das Beten immer wieder neu gnadenhaft geschenkt werden muß, muß sich der Mensch dafür doch bereiten durch Einkehr und Stillewerden, Entspannung und Sammlung und durch Selbstzucht. Wichtig ist auch das Einhalten von bestimmten Ordnungen des Gebets, besonders von bestimmten Gebetszeiten (Morgen- und Abendgebet, Tischgebet, Sonntagsheiligung, Kirchenjahr, Einkehrtage). Eine Hilfe für das Beten ist auch das geistliche Gespräch und der geistliche Erfahrungsaustausch mit anderen Christen, die sich ebenfalls um das Beten mühen.
4.3 Beten im Namen Jesu
Jesus hat uns nicht nur gesagt, wir sollen beten, so wie er uns zu beten gelehrt hat, sondern auch, wir sollen in seinem Namen beten (vgl. Joh 14,13-14 u. a.). Wir dürfen uns in unserem Beten also auf Jesus und auf die Gemeinschaft mit ihm berufen und darum der Erhörung gewiß sein. Jesus tritt ja bleibend für uns ein vor Gott (vgl. Röm 8,34; Hebr 7,25; 1 Joh 2,1). Er hat uns ein neues Verhältnis zu Gott als unserem Vater ermöglicht; durch den Heiligen Geist dürfen wir an seinem Vaterverhältnis teilnehmen und ebenfalls rufen: "Abba, lieber Vater" s3-s5 (vgl. Röm 8,15; Gal 4,6). So ist unser Beten nach dem Neuen Testament letztlich trinitarisch begründet. "Sagt Gott, dem Vater, jederzeit Dank für alles im Namen Jesu Christi, unseres Herrn!" (Eph 5,20). Besonders in der Liturgie richten sich alle Gebete "in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes durch Jesus Christus, unseren Herrn" an Gott, den allmächtigen Vater. Diese Ordnung des Betens kommt vor allem am Ende und als Zusammenfassung des Hochgebets bei der Eucharistiefeier zum Ausdruck. Dort preist die Kirche den Vater:
- "Durch ihn und mit ihm und in ihm
- ist dir, Gott, allmächtiger Vater,
- in der Einheit des Heiligen Geistes
- alle Herrlichkeit und Ehre."
Neben dieser trinitarischen Grundordnung des christlichen Betens begegnen wir auch schon im Neuen Testament einem Beten zu Jesus Christus selbst. Die urchristlichen Gemeinden beteten vor allem: "Komm, Herr Jesus!" (Offb 22,20; vgl. 1 Kor 16,22). In der Eucharistiefeier rufen wir: "Kyrie eleison" - "Herr, erbarme dich". Die Gebetstradition der Kirche kennt auch das Gebet um das Kommen des Heiligen Geistes: "Komm, Schöpfer Geist" (Gotteslob 240; 245). Nach dem "Großen Glaubensbekenntnis" wird der Heilige Geist "mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht".
Zum Vater beten wir als seine Söhne und Töchter, ihm gilt unser Lob und Dank, unsere Bitte um Vergebung und um alles, was im weitesten Sinn des Wortes in den Bereich des "täglichen Brotes" gehört. Zu Jesus Christus beten wir als seine Jünger um alles, was seine Sache hier auf Erden betrifft: für die Kirche, für unseren Dienst an der Welt und den Menschen, für die Mission und die Glaubensverkündigung; dem fügt sich die neutestamentliche Bitte um seine Wiederkunft sinnvoll ein. Zum Heiligen Geist beten wir als Erben Jesu Christi, daß er komme, daß er uns erfülle, uns zu Gliedern Jesu Christi mache, uns Wachstum in Glaube, Hoffnung und Liebe schenke, daß er uns Freude und Kraft im Leiden wie im Widerstand gegen das Böse gebe. Schließlich wird die Kirche in ihrer öffentlichen Liturgie wie beim privaten Gebet nicht müde, den dreifaltigen Gott zu loben und zu preisen:
- "Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit."
Wenn das Bekenntnis zum dreifaltigen Gott besagt, "Gott ist Liebe", dann dürfen wir in jeder Situation seines Beistands gewiß sein, weil wir wissen, daß uns nichts von dieser Liebe Gottes scheiden kann (vgl. Röm 8,39). An dieser Stelle melden sich freilich viele Fragen und Probleme. Denn machen wir nicht oft die Erfahrung, daß Gott scheinbar nicht hört, daß er schweigt und nicht eingreift? Dürfen wir überhaupt hoffen, daß er uns konkret hilft und erhört? Warum läßt er das Übel und das Unrecht in der Welt zu? Was also bedeutet der Glaube an Gott, den allmächtigen Vater, und an den Vater Jesu Christi konkret in unserem Leben? Über diese bedrängenden Fragen müssen wir jetzt genauer nachdenken, indem wir nach dem Verhältnis von Gott und Welt fragen und von Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, sprechen.
III. Gott - Der Schöpfer des Himmels und der Erde
1. Gott, der Schöpfer
1.1 Naturwissenschaft und Theologie im Gespräch
Im Credo bekennen wir von Gott, daß er "alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt". Mit diesem Bekenntnis will der Glaube eine Antwort geben auf die Urfrage des Menschen und der Menschheit: Woher und wozu ist alles? Woher und wozu ist der Mensch?
Die Antwort auf diese Frage erwarten heute viele Menschen zunächst von den modernen Naturwissenschaften. Sie können uns vieles sagen über Entstehung und Alter der Welt, über das Weltall, seine "Wunder" und Rätsel. Sie haben uns Einsichten gebracht, durch die uns die Wunder im Bereich der materiellen Welt viel konkreter deutlich geworden sind, und zwar sowohl im Bereich des ganz Kleinen (Mikrokosmos), im Bereich des Atomaren und Subatomaren, vor allem im Bereich der Gene, wie im Bereich des ganz Großen (Makrokosmos), im Bereich des Weltalls und der Vielzahl seiner Sonnensysteme. So sind es nicht zuletzt die Ergebnisse der modernen Naturwissenschaften, die uns staunend fragen lassen nach dem Woher dieser Ordnung der Wirklichkeit.
Dennoch kam es in der Vergangenheit oft zu Konflikten zwischen dem Weltbild, wie es uns in der Bibel und in der kirchlichen Überlieferung bezeugt wird, und dem neuen Weltbild, das sich auf methodisch gesicherte Erfahrung und mathematische Berechnung gründet. Im Prozeß gegen Galilei (17. Jh.), der als erster klar formulierte, daß sich entgegen dem Augenschein nicht die Sonne um die Erde, sondern die Erde um die Sonne dreht, prallten das alte und das neuzeitliche Weltbild aufeinander. Als Darwin im 19. Jahrhundert die Theorie aufstellte, daß die verschiedenen Arten der Lebewesen nicht unmittelbar von Gott geschaffen sind, sondern voneinander abstammen und als er in diesen Entwicklungsprozeß auch den Menschen einbezog, gab es wiederum lang andauernde Auseinandersetzungen. Oft brachte man das Problem auf die schiefe Alternative: Stammt der Mensch von Gott oder vom Affen ab?
Diese Konflikte haben sich in unserem Jahrhundert entschärft. Das hängt einmal damit zusammen, daß die modernen Naturwissenschaften heute deutlicher als früher ihre eigenen Grenzen erkennen. Sie wissen, daß sie die Wirklichkeit immer nur unter einem Gesichtspunkt erkennen und so grundlegende Phänomene wie Raum und Zeit nur relativ zum Standort des Beobachters bestimmen können (Relativitätstheorie von A. Einstein). Bei der Erforschung der kleinsten Teile der Materie ergab sich, daß wir dafür komplementäre Vorstellungen wie Welle und Korpuskel benutzen müssen (Unschärfe-Relation in der Quantentheorie von N. Bohr und W. Heisenberg). So mußte der klassische Begriff der Materie aufgegeben werden, ohne daß bisher ein eindeutiger und einheitlicher neuer Begriff möglich wäre. Die heutige Naturwissenschaft ist also trotz aller großen und imponierenden Erfolge im einzelnen gegenüber früher bescheidener geworden, wenn es um die Gesamtdeutung der Wirklichkeit geht.
Schärfer achtet auch die Theologie auf ihre Grenzen. Sie weiß heute, daß die Bibel sich in ihrer Ausdrucks- und Vorstellungsweise des Weltbilds der damaligen Zeit bedient, das als solches für uns nicht verbindlich ist. Ihrer Aussageintention nach will uns die Bibel nicht über die empirisch erkennbare Entstehung der Welt und der verschiedenen Arten der Lebewesen unterrichten. Sie will vor allem sagen, daß Gott der Schöpfer der Welt und ihr Heil ist. Es ist darum kein Gegenstand des Glaubens, daß Gott die Welt, wie es die Bibel bildhaft darstellt, in sechs Tagen geschaffen hat und daß er alles am Anfang so geschaffen hat, wie wir es heute vorfinden.
Wenn wir die theologische Aussageabsicht der biblischen Schöpfungsberichte von deren weltbildbedingter Einkleidung unterscheiden, stellt sich das entscheidende Sachproblem: das Verhältnis Schöpfung und Evolution. Die meisten Vertreter der heutigen Naturwissenschaft gehen von der Hypothese aus, daß alles materielle Sein auf dem Weg der Evolution zu immer höheren Seinsund Lebensformen geführt wird bis hin zum Menschen, dem Ziel der Evolution. Danach wäre die Welt vor etwa 12 Jahrmilliarden, unsere Erde vor etwa 5-6 Milliarden Jahren entstanden, vor etwa 3 Milliarden Jahren das erste Leben aufgetreten, während sich menschliches Leben "erst" seit rund 2 Millionen Jahren findet.
Wie verhält sich diese Auffassung zum Schöpfungsglauben? Selbstverständlich ist die materialistische Entwicklungslehre theologisch abzulehnen, die eine ungeschaffene Materie annimmt, aus der alle Lebewesen, auch der Mensch, nach Leib und Seele durch rein mechanische Entwicklung entstanden sind. In dieser weltanschaulichen Weise wird die Evolutionslehre heute von den allermeisten Wissenschaftlern nicht mehr verstanden. Heute setzt sich nämlich immer mehr die Meinung durch, daß Schöpfung und Evolution Antworten auf jeweils ganz verschiedene Fragen sind und deshalb auf verschiedenen Ebenen liegen. Evolution ist ein empirischer Begriff, der auf die Frage nach dem "horizontalen" Woher und dem raum-zeitlichen Nacheinander der Geschöpfe eingeht. Schöpfung dagegen ist ein theologischer Begriff und fragt nach dem "vertikalen" Warum und Wozu der Wirklichkeit. Evolution setzt immer schon "etwas" voraus, das sich verändert und entwickelt; Schöpfung zeigt, warum und wozu überhaupt etwas ist, das sich verändern und entwikkeln kann. Um beide Sichtweisen zu verbinden, sagen heute viele Theologen: Gott schafft die Dinge so, daß sie ermächtigt sind, bei ihrer eigenen Entwicklung mitzuwirken. "Gott macht, daß sich die Dinge selber machen" (P. Teilhard de Chardin). Dabei wirkt Gott nicht nur am Anfang, um dann die Entwicklung sich selbst zu überlassen. Er hält die Wirklichkeit ständig im Sein, und er trägt und leitet sie auch in ihrem Werden. Gott ist also die alles umgreifende schöpferische Macht, die eigentätiges geschöpfliches Mitwirken freisetzt und durchwaltet. Gerade in ihrer schöpferischen Kraft sind die Geschöpfe ein Abbild des schöpferischen Gottes. Schöpfungsglaube und Evolutionstheorie widerstreiten also einander nicht grundsätzlich; beide Aussagen geben vielmehr eine Antwort auf ganz verschiedene Fragen; sie liegen auf verschiedenen Ebenen und sind verschiedenen Erkenntnisweisen zugeordnet.
Trotz dieser notwendigen Unterscheidungen geht es in Naturwissenschaft und Theologie nicht um zwei Welten, die nichts miteinander zu tun hätten. Es geht um die eine und selbe Wirklichkeit, die unter verschiedenen Aspekten betrachtet wird. Deshalb können Naturwissenschaft und Theologie nicht achtlos aneinander vorübergehen; sie sind vielmehr auf ein wechselseitiges Gespräch angewiesen.
1.2 Ursprung, Mitte und Ziel der Welt
Die grundlegenden Aussagen des christlichen Schöpfungsglaubens finden sich bereits auf den ersten Seiten des Alten Testaments. Es ist freilich wichtig, daß das Alte Testament nicht nur eine, sondern zwei Schöpfungsgeschichten kennt. Sie stimmen völlig überein in ihrem Glauben an Gott, den Schöpfer; sie drücken diesen Glauben aber mit unterschiedlichen Vorstellungen aus. Damit wird nochmals deutlich, daß es der Bibel nicht um die empirisch erkennbare Entstehung der Welt geht, sondern um den Glauben, daß die Welt in Gott ihren Grund hat.
Der erste, aber jüngere Schöpfungsbericht setzt sehr lapidar ein:
- "Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde; die Erde aber war wüst und wirr, Finsternis lag über der Urflut, und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. Gott sah, daß das Licht gut war..." (Gen 1,1-4)
Dann schildert dieser Schöpfungsbericht, wie Gott im Rhythmus von sieben Tagen die einzelnen Schöpfungswerke hervorbringt. Den Höhepunkt bildet die Erschaffung des Menschen am sechsten Tag. Am Schluß heißt es zusammenfassend: "Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Es war sehr gut" (Gen 1,31). Anders die zweite, ältere Schöpfungserzählung. Für sie ist der Mensch nicht der Höhepunkt, sondern der Mittelpunkt der Schöpfung. Deshalb wird die Erschaffung der Welt nur knapp und kurz angedeutet, dafür aber die Erschaffung des Menschen sehr breit und plastisch erzählt:
- "Zur Zeit, als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte... Da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen." (Gen 2,4b.7)
Beide Schöpfungsgeschichten sprechen die Sprache ihrer Zeit und benutzen Vorstellungen der damaligen Kultur. In dieser uns heute fremden Gestalt bringen sie freilich einen Inhalt zum Ausdruck, der nicht aus dem damaligen Weltbild stammt, sondern das Ergebnis des Weges Gottes mit dem Volk Israel war und eine Offenbarungs- und Glaubenswahrheit darstellt. In seiner Geschichte erfuhr Israel immer wieder: Die Herrschaft Gottes hat keine Grenzen. Gott ist nicht nur der Herr Israels, sondern der Herr aller Völker, der ganzen Welt. Er kann ja Israel und dem einzelnen Gläubigen nur helfen, wenn er der allmächtige Vater aller Wirklichkeit ist. So mußte Israel immer wieder sprechen: "Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat" (Ps 124,8), ein Psalmvers, der uns in der Liturgie der Kirche oft begegnet. Der Glaube an die Schöpfung ist die äußerste Ausweitung der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Die Schöpfung ist sozusagen die Vorgeschichte, der Einleitungsakt und die Voraussetzung der übrigen Geschichte. Die Schöpfung ist die erste der Offenbarungstaten Gottes. Sie ist die bleibende Grundlage unseres Gottesverhältnisses und Gottesverständnisses.
Die Schöpfung ist der Anfang, der auf die Vollendung hingeordnet ist. Das bringt der erste Schöpfungsbericht dadurch bildhaft zum Ausdruck, daß er Gott am siebten Tag, nachdem er sein Werk vollbracht hat, ruhen läßt (vgl. Gen 2,2). Damit soll nicht gesagt werden, daß Gott von seiner Arbeit müde geworden sei; vielmehr ist gesagt: Das Ziel der Schöpfung ist der Sabbat, die Verherrlichung Gottes. Deshalb schreibt Paulus, die ganze Schöpfung warte sehnsüchtig und unter Geburtswehen auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes, das heißt auf die Herrlichkeit des vollendeten Reiches Gottes (vgl. Röm 8,19-24). Die erste Schöpfung ist also auf den neuen Himmel und die neue Erde (vgl. Jes 65,17, 66,22; Offb 21,1) hingeordnet. Sie findet ihre Vollendung, wenn einmal Gott "alles und in allem" sein wird (1 Kor 15,28). So ist die Schöpfung keine starre Wirklichkeit, sondern stellt ein Geschehen dar, das nicht abgeschlossen, sondern offen ist für die Zukunft, die Gott selbst für den Menschen ist.
Wie die Schöpfung einen Anfang und ein Ziel hat, so hat sie 124; ihre Mitte in Jesus Christus. Diese Überzeugung wird im Alten Testament vorbereitet durch die Aussage, Gott habe alles durch sein Wort geschaffen (vgl. Gen 1). Das Wort ist im Neuen Testament Jesus Christus (vgl. Joh 1).
- "Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes,
- der Erstgeborene der ganzen Schöpfung.
- Denn in ihm wurde alles erschaffen
- im Himmel und auf Erden,
- das Sichtbare und das Unsichtbare,
- Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten;
- alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen.
- Er ist vor aller Schöpfung,
- in ihm hat alles Bestand." (Kol 1,15-17)
Der Sinn der Schöpfung wird uns letztlich erst von Jesus Christus her erschlossen. Erst durch Jesus Christus werden auch die dunklen Aspekte und die Rätsel der Weltwirklichkeit wie Leiden und Sterben mit Sinn erhellt (vgl. GS 22). Umgekehrt darf der Christ in aller Schöpfungswirklichkeit vorausweisende Spuren und Fragmente der Christuswirklichkeit entdecken und Jesus Christus als die Zusammenfassung und die Fülle von allem, "was im Himmel und auf Erden ist" (Eph 1,10), verstehen.
1.3 Das Geheimnis der Schöpfung
Aus der christlichen Gesamtperspektive der Schöpfung folgen die verschiedenen Einzelwahrheiten des christlichen Schöpfungsglaubens.
1. Die Freiheit der Schöpfung. Obwohl es vielen so scheint, als sei die Welt ein Produkt des Zufalls, eines blinden Schicksals oder irgendeiner gesetzlichen Notwendigkeit, bekennt der christliche Glaube: Diese Welt ist von Gott gewollt, geschaffen, geliebt, bejaht. Sie entspringt dem freien Willen, der Güte und der Liebe Gottes, der ohne jede Notwendigkeit, aus freiem Ratschluß die Geschöpfe an seinem Sein teilhaben lassen wollte. "Denn du bist es, der die Welt erschaffen hat, durch deinen Willen war sie und wurde sie erschaffen" (Offb 4,11). Gott wäre auch ohne die Welt Gott und selig gewesen; er hat uns und die Welt nicht gebraucht, aber er hat uns und die Welt gewollt. So dürfen wir uns sagen: Alles, was ist, nicht zuletzt wir selbst, ist, weil Gott sprach: Ich will, daß du bist - du bist, weil ich dich will, weil ich dich liebe. "Weil er gut ist, sind wir" (Augustinus).
2. Die Ordnung in der Schöpfung. Immer wieder heißt es: "Gott sprach..., und es wurde." Im Buch der Weisheit lesen wir: "Du hast das All durch dein Wort gemacht" (Weish 9,1; vgl. Job 1,3; Röm 4,17). In der Erschaffung durch das Wort Gottes ist die "Wortwahrhaftigkeit" und Sinnhaftigkeit der Geschöpfe begründet. Denn durch das Wort scheidet Gott den Kosmos vom Chaos, das Licht von der Finsternis, den Himmel von der Erde. Die Bibel sagt im gleichen Sinn, Gott habe alle seine Werke mit Weisheit geschaffen (vgl. Ps 104,24; Spr 8,27). So ist die Welt für den Christen nicht Ausdruck einer irrationalen chaotischen Lebensmacht, sondern rational geordnet. "Du aber hast alles nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet" (Weish 11,20). Die Welt ist die Verwirklichung göttlicher Ideen. Wie anders sollte man die wunderbare Ordnung der Welt, die die Wissenschaft neu entdeckt, erklären als durch einen alles ordnenden Geist? In seinem Forschen und Denken darf der Mensch den Schöpfungsgedanken Gottes nachspüren und nachdenken. An Gott, den Schöpfer, glauben heißt auch, an der Sinnhaftigkeit und Rationalität der Welt festhalten.
3. Das Gutsein der Schöpfung. Im biblischen Schöpfungsbericht wird immer wieder gesagt, Gott habe alle Dinge gut gemacht (vgl. Gen 1,4.10.12.18.21.31). Diese "Güteformeln" drücken aus, daß alles aus der Güte Gottes kommt und an der Güte Gottes Anteil hat. Aus dieser Einsicht heraus mußte die frühe Kirche der Gnosis, einer damals weit verbreiteten Weltweisheit, widerstehen, die die materielle Welt als böse verwarf und den Schöpfergott des Alten Testaments ablehnte. Auch im Mittelalter mußte die Kirche die Güte der Schöpfung gegen die pessimistischen Vorstellungen der Katharer und anderer dualistischer Sekten verteidigen (vgl. DS 800; 1333; 3002; NR 277; 301; 316). Mit dieser Lehre vom Gutsein der Schöpfung in allen ihren Bereichen ist jeder falschen Aszese, jeder skeptischen und pessimistischen Weltflucht und Weltverachtung der Boden entzogen. Das ist frohe Botschaft gerade für unsere Welt, die "zwischen Hoffnung und Angst hin und her getrieben" und "durch die Frage nach dem heutigen Lauf der Dinge zutiefst beunruhigt" wird (GS 4).
4. Das Wesen der Schöpfung. Die Bibel spricht von der Schöpfung trotz gelegentlicher Anklänge anders als die Schöpfungsmythen der damaligen Religionen, die von einem Kampf Gottes mit den Chaosmächten oder von einem Kampf der Götter untereinander erzählen. Nach der Bibel schafft Gott sozusagen mühelos und völlig souverän. Er schafft auch anders als Menschen schaffen, die immer einen vorgegebenen Stoff voraussetzen, den sie nur umschaffen und umformen. Bei Gott ist nie von einem vorgegebenen Stoff die Rede. Er ist deshalb kein Demiurg (Weltenbaumeister). Um die Einmaligkeit des schöpferischen Handelns Gottes auszudrücken, sprechen die Schrift (vgl. 2 Makk 7,28; Röm 4,17) und die kirchliche Lehre (vgl. DS 800; 3025; NR 295; 322) von der Schöpfung aus Nichts. Damit ist nicht gemeint, das Nichts sei der Stoff, aus dem die Welt gemacht ist, die Welt sei also zutiefst nichtig. Vielmehr wird das Fehlen jeder stofflichen Voraussetzung behauptet. Positiv ist damit ausgesprochen, daß Gott allein und ausschließlich der Grund der Welt ist, daß diese völlig von ihm abhängt und in allem, was sie ist, Anteil hat an Gottes Sein. Für eine Welt, die unter der Angst vor anonymen Gewalten und übermenschlichen Schicksalsmächten litt und leidet, ist dies ein tröstlicher Gedanke. Er sagt uns, daß alles, was wir sind und haben, ja, daß alles, was ist, geschenkte und verdankte Wirklichkeit ist.
5. Die Eigenständigkeit der Schöpfung. Durch ihre radikale Abhängigkeit von Gott ist die Welt wesensmäßig und unendlich von Gott, dem absolut Unabhängigen, verschieden und unterschieden. Damit ist sie gerade in ihrer radikalen Abhängigkeit etwas gegenüber Gott Eigenständiges. Die Schöpfung aus Nichts verleiht also dem Geschöpf seine ihm eigene Würde vor Gott. Sie ist keine Erniedrigung und Demütigung, sondern Ermächtigung zu einem Sein aus Gott und auf Gott hin. Das II. Vatikanische Konzil spricht darum von einer recht verstandenen Autonomie der Welt und ihrer verschiedenen Bereiche (vgl. GS 36; 41; 56; 76; AA 7). Das bedeutet, daß der Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und den anderen Weltbereichen ein relativer Eigenstand, eine eigene Wahrheit, Gutheit, Ordnung und eine Eigengesetzlichkeit zukommt. Der Mensch muß die eigene Würde der Geschöpfe und ihrer Rhythmen respektieren; er darf nicht beliebig schalten und walten. Der Christ muß sich in der Welt und in den verschiedenen Bereichen der Welt sachgerecht verhalten. Der Wille Gottes begegnet ihm konkret in den Ordnungen und Strukturen der Welt und durch sie hindurch. Der recht verstandene Eigenstand, von dem das Konzil spricht, muß freilich unterschieden werden vom Anspruch auf absolute Autonomie der Welt von Gott. Diese Auffassung des modernen Säkularismus ist mit dem Glauben an die Geschöpflichkeit der Welt unvereinbar.
6. Der Sinn der Schöpfung. Da die Schöpfung ganz aus Gott ist, ist sie gerade in ihrer Eigenständigkeit auch ganz für ihn da, zu seinem Ruhm und zu seiner Ehre. Der erste Sinn der Schöpfung ist die Verherrlichung Gottes. Besonders die Psalmen bringen diesen Gedanken immer wieder zum Ausdruck:
- "Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde; über den Himmel breitest du deine Hoheit aus." (Ps 8,2)
- "Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes, vom Werk seiner Hände kündet das Firmament." (Ps 19,2)
Im Lobgesang der drei jungen Männer, die der König Nebukadnezzar in einen Feuerofen werfen ließ, weil sie sich weigerten, ein von ihm errichtetes Götzenbild anzubeten, wird die ganze Schöpfung - Himmel und Erde, Sonne, Mond und Sterne, Tau und Regen, Blitz und Wolken, alles, was ist - aufgerufen, Gott zu preisen: "Preist den Herrn, all ihr Werke des Herrn; lobt und rühmt ihn in Ewigkeit!" (Dan 3,57). Das Lob Gottes aus der Schöpfung begegnet uns in der christlichen Frömmigkeitsgeschichte immer wieder. Am bekanntesten ist der "Sonnengesang" des hl. Franziskus, den er "zum Lob und zur Ehre Gottes verfaßt hat, als er krank zu San Damiano lag"
- "Du höchster, allmächtiger, guter Herr,
- Dein sind der Lobpreis, die Herrlichkeit
- und die Ehre und jegliche Benedeiung.
- Dir allein, Höchster, gebühren sie,
- und kein Mensch ist würdig, Dich nur zu nennen.
- Lob sei Dir, Du Herre mein, mit allen Deinen Geschöpfen,
- zumal dem Herrn Bruder, der Sonne,
- denn er ist der Tag,
- und er spendet das Licht uns durch sich.
- Und er ist schön und strahlend in großem Glanz.
- Dein Sinnbild trägt er, Du Höchster."
In ähnlicher Weise spricht Franziskus den Mond, die Sterne an, den Wind, das köstliche und keusche Wasser, Feuer, Erde, Blumen und Kräuter, aber auch Krankheit, Drangsal und Tod. Er hat zu den Mitgeschöpfen geradezu ein geschwisterliches Verhältnis und nennt sie daher Bruder und Schwester.
Wenn die Verherrlichung Gottes der erste Sinn der Schöpfung ist, dann hat dies nichts mit einem egoistischen und narzißtischen Wesen Gottes zu tun. Gottes Herrlichkeit ist die Herrlichkeit seiner Liebe. Gottes Ehre ist deshalb zugleich das Heil des Menschen. "Gottes Ehre ist der lebendige Mensch" (Irenäus von Lyon). So dient die Schöpfung auch der Beglückung der Geschöpfe, die an Gottes Herrlichkeit teilhaben dürfen und die eben in der Verherrlichung Gottes ihre letzte Erfüllung linden. Der Mensch findet seine letzte Erfüllung nicht im Haben und Genießen, sondern in Fest und Feier, im Danken, Loben und Preisen. Die Eucharistie, die Danksagung, in die Brot und Wein repräsentativ für die gesamte Schöpfung einbezogen sind, ist darum die Sinnmitte der Welt, gleichsam die Liturgie der Welt und die Vorwegnahme ihrer endgültigen Vollendung. Paulus bringt diese rechte Ordnung zum Ausdruck: "Alles gehört euch; ihr aber gehört Christus, und Christus gehört Gott" (1 Kor 3,22-23).
1.4 Gott erhält und trägt die Welt
Oft denken wir uns die Schöpfung als ein unvorstellbar weit zurückliegendes Geschehen nach Art des "Urknalls", von dem viele Naturwissenschaftler sprechen. Nach diesem Urgeschehen hätte sich dann die Wirklichkeit in einem Zeitraum von etwa 12 Milliarden Jahren zu der imposanten Ordnung und Fülle entfaltet, wie sie uns heute begegnet. Oft denkt man sich Gott auch nach Art eines überdimensionalen Uhrmachers, der die Welt vor Urzeiten konstruiert hat und sie nun nach den von ihm ihr gegebenen Gesetzen selbständig ablaufen läßt (Deismus). Dies ist jedoch nicht die Vorstellung des biblischen Schöpfungsglaubens. Zu ihm gehört nicht nur die einmalige Erschaffung, sondern auch die bleibende Erhaltung der Welt durch Gott.
- "Sie alle warten auf dich,
- daß du ihnen Speise gibst zur rechten Zeit ...
- Verbirgst du dein Gesicht, sind sie verstört;
- nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin
- und kehren zurück zum Staub der Erde.
- Sendest du deinen Geist aus,
- so werden sie alle erschaffen,
- und du erneuerst das Antlitz der Erde."
- (Ps 104,27.29-30)
"Wie könnte etwas ohne deinen Willen Bestand haben, oder wie könnte etwas erhalten bleiben, das nicht von dir ins Dasein gerufen wäre?"(Weish 11,25) Die Schöpfung ist also nicht nur ein urzeitliches Geschehen, sondern auch ein jetztzeitliches Geschehen. Sie ist jedem Augenblick koexistent. In der Erhaltung der Welt ist der Akt der Schöpfung immer neue Gegenwart; er trägt, durchwirkt und umgreift alles. Ohne diese Erhaltung der Welt würde alles ins Nichts zurücksinken. Wir können keinen Atemzug tun, ohne daß Gott uns trägt, will und bejaht. Ist nicht auch dies ein tröstlicher Gedanke? Der Glaube an die beständige wirkmächtige Gegenwart des Schöpfers in seiner Schöpfung hebt das immer wieder drohende Gefühl der Leere, der Fassadenhaftigkeit und der Hohlheit der Welt auf und macht diese zu einem gotterfüllten, gottinnigen Geheimnis.
Die Erhaltung der Welt und ihrer Ordnungen ist auch deshalb von existentieller Bedeutung, weil der Kosmos dauernd vom Chaos bedroht ist. Die Sündflutgeschichte erzählt uns von dieser ständigen Gefahr. Am Ende verheißt sie aber auch den Bestand der Weltordnung: "Solange die Erde besteht, sollen nicht aufhören Aussaat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht" (Gen 8,22). Der Feind des Lebens ist der Tod. Deshalb geschieht der Akt der Erhaltung der Welt dort, wo Gott noch im Tod den Menschen nicht ins Nichts zurückfallen läßt, sondern ihn trägt, erhält und zu neuem Leben erweckt. Der Gott, der "das, was nicht ist, ins Dasein ruft", ist zugleich der "Gott, der die Toten lebendig macht" (Röm 4,17). Dies geschah ein für allemal in Tod und Auferweckung Jesu Christi. Auf sie hin und von ihr her geschieht alle Erhaltung der Welt. Auch in diesem Sinn hat in Jesus Christus alles Bestand (vgl. Kol 1,17).
1.5 Gottes verborgene Vorsehung
Der Schöpfungsglaube gewinnt erst im Glauben an die Vorsehung Gottes seine letzte Tiefe und seinen existentiellen Ernst. Freilich werden im Vorsehungsglauben auch große existentielle Schwierigkeiten deutlich. Immer wieder geraten wir in Situationen, in denen wir fragen: Warum muß ich dies erleiden? Warum gerade ich? Oft sprachen und sprechen die Menschen - je nachdem - von einem blinden, guten oder bösen Schicksal. Oft meinten und meinen sie, dieses Schicksal sei in den Sternen geschrieben und durch Sterndeutung (Astrologie) zu ermitteln. In säkularisierter Sprache reden wir von einem Glückspilz, einem Sonntagskind, einem Hans im Glück, über dessen Leben ein glücklicher Stern waltet, oder von einem Pechvogel, der vom Mißgeschick geradezu verfolgt ist. Bewußt oder unbewußt gibt es auch heute noch vielerlei Relikte des Aberglaubens: Talisman, Angst vor Unglückszahlen, Glaube an gute und schlechte Vorzeichen u. a.
Auch die Bibel geht davon aus, daß das Leben und die Wirklichkeit im Ganzen eine Ordnung haben, die wie eine Macht über den Menschen waltet. Aber diese Macht ist für die Bibel keine anonyme Schicksalsmacht, sondern die persönliche Führung durch Gott. Von dieser persönlichen Führung wird uns schon im Alten Testament bei einzelnen biblischen Gestalten berichtet, beim ägyptischen Josef, bei Mose, der als Knäblein durch die Fürsorge Gottes aus dem Nilwasser gezogen wird, bei Tobias, dem Gott für die Reise einen Engel zur Seite gibt. In besonders ausdrucksvoller Weise kommt die persönliche Führung in dem bekannten Psalm zum Ausdruck:
- "Der Herr ist mein Hirte,
- nichts wird mir fehlen ...
- Er stillt mein Verlangen;
- er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen.
- Muß ich auch wandern in finsterer Schlucht,
- ich fürchte kein Unheil;
- denn du bist bei mir,
- dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht."
- (Ps 23,1.3-4)
Ähnlich spricht der Psalm (und das Kirchenlied): "Wer im Schutz des Höchsten wohnt" (Ps 91; vgl. Gotteslob 291). Das Weisheitsbuch bezeugt die göttliche Vorsehung ganz allgemein: "Er hat klein und groß erschaffen und trägt gleiche Sorge für alle" (Weish 6,7). Vor allem Jesus bezeugt immer wieder, daß sein Leben, Wirken und Sterben ganz unter dem Willen des Vaters stehen. Deshalb kann er auch uns zu einem geradezu kindlichen Vertrauen mahnen.
- "Sorgt euch nicht um euer Leben...
- Seht euch die Vögel des Himmels an:
- Sie säen nicht, sie ernten nicht
- und sammeln keine Vorräte in Scheunen;
- euer himmlischer Vater ernährt sie.
- Seid ihr nicht viel mehr wert als sie?...
- Macht euch also keine Sorgen...
- Denn um all das geht es den Heiden.
- Euer himmlischer Vater weiß,
- daß ihr das alles braucht."
- (Mt 6,25-26.31-32; vgl. 10,26-31)
- Das Neue Testament faßt die Botschaft Jesu zusammen: "Werft alle eure Sorge :auf ihn, denn er kümmert sich um euch" (1 Petr 5,7).
Das alles sind keine idyllischen Gedanken von frommen, aber weltfremden Menschen. Der Vorsehungsglaube des Alten und Neuen Testaments steht vielmehr im großen Zusammenhang des ganzen Heilsplans Gottes. Danach führt Gott die Menschheit in vielen Stufen (Noach-, Abraham-, Mose-, Davidbund) bis zum neuen Bund in Jesus Christus und zu seiner Vollendung am Ende der Zeiten. Durch seinen Geist führt er auch die Kirche, um durch sie das allumfassende Reich Gottes vorzubereiten. Die Vorsehung des einzelnen dient diesem umfassenden Heilsplan. Der Schlüssel zum Vorsehungsglauben Jesu liegt darum in der Aussage: "Euch aber muß es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen; dann wird euch alles andere dazugegeben" (Mt 6,33). Damit ist keinem naiven Optimismus das Wort geredet. Vielmehr wird gesagt: Mache Gott und die Sorge um sein Reich zum Inhalt deines Lebens, dann verändert sich die Welt um dich her.
Im Vorsehungsglauben kommt zum Ausdruck, daß die unermeßlich große Schöpfung und der allumfassende Heilsplan Gottes auf den einzelnen Menschen ausgerichtet sind, ja, daß sich der Sinn der Schöpfung und der Geschichte im einzelnen Menschen entscheidet. Die Vorsehung Gottes darf deshalb nicht als ein Plan mißverstanden werden, der über den Kopf der Menschen hinweggeht. Sie setzt das Mitgehen des Menschen voraus, der sich Gottes Fürsorge anvertraut. In dem Maße, als sich ein Mensch auf Gottes Willen einläßt und sein Leben ändert, ändert sich auch sein "Schicksal". Der Mensch, der mit Gott ins Einvernehmen kommt, kommt auch mit der Welt ins Einvernehmen. Die Dinge und Geschehnisse verlieren dann ihre Fremdheit und erscheinen in besonderer Weise von Gott "zugefügt". Wo dies geschieht, da ist für den, der glaubt, Gott schon jetzt "alles und in allem". Auch wenn er unter Umständen keine anderen äußeren Verhältnisse schaffen kann, werden sie doch anders, weil er weiß, daß ihn nichts scheiden kann von der Liebe Christi (vgl. Röm 8,35) und "daß die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll" (Röm 8,18).
Der innere Zusammenhang zwischen der alles umfassenden Vorsehung Gottes und der Freiheit des Menschen kommt vor allem im Bittgebet zum Ausdruck. Schon das Bitten-Dürfen zeigt, daß der Mensch Zugang hat zu Gott und sich von ihm angenommen wissen darf; es bringt zum Ausdruck, daß Gott den Menschen hört, anhört und bejaht. Durch solches Bitten wird der Mensch also keineswegs zu einer unterwürfigen Figur erniedrigt. Im Gegenteil, in Gottes Vorsehung ist das Bittgebet von Ewigkeit vorgesehen und einbezogen. Gottes allmächtige Vorsehung schaltet die Initiative des Menschen nicht aus, sondern bezieht sie ein und nimmt sie in Dienst. Wenn daher der Mensch im Bittgebet seine Situation vor Gott trägt, darf er sich der Erhörung von vornherein gewiß sein. Jesus selbst sagt uns:
- "Alles, worum ihr betet und bittet - glaubt nur, daß ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil." (Mk 11,24, vgl. Mt 7,7; 21,22; Lk 11,9)
Viele werden erstaunt fragen: Wenn Gott grundsätzlich jedes Gebet erhört, wie steht es dann mit den Gebeten, die - scheinbar oder wirklich - nicht erhört werden, wo Gott schweigt, obwohl wir ihn vielleicht geradezu bestürmt haben? Die Antwort ist nicht leicht. Aber im Licht der sehr klaren Aussagen Jesu müssen wir antworten: Gott erhört jedes Gebet in einer all unser Hoffen übertreffenden Weise. Wenn er deshalb ein Gebet nicht in der Weise erhört, wie wir es wünschen, dann deshalb, weil dieser Wunsch noch nicht unserem wahren Besten entspricht. Der hl. Augustinus drückt diesen Gedanken so aus: "Gut ist Gott, der oftmals nicht gibt, was wir wollen, auf daß er uns gebe, was wir lieber wollen sollten." Die hl. Theresia von Lisieux sagt deshalb: "Und wenn du mich nicht erhörst, liebe ich dich noch mehr." Gerade wenn Gott unsere Wünsche korrigiert, unseren Glauben, unsere Hoffnung und unsere Liebe vertieft, versöhnt er uns im Gebet doch mit unserer Situation und schenkt uns einen Frieden, der alles Verstehen übersteigt (vgl. Phil 4,7).
Das alles zeigt, daß Gottes Vorsehung letztlich sein Geheimnis bleibt, das Geheimnis des je größeren Gottes und seiner je größeren Liebe. Der Vorsehungsglaube löst die Rätsel des Daseins nicht einfach auf und macht sie nicht einfach durchsichtig. Er gibt uns weder Einblick in die Gedanken Gottes, noch erklärt er uns die Einzelheiten von Gottes Fügungen und Führungen in der Welt. Er macht uns auch unsere eigene Lebensgeschichte nicht durchsichtig, so daß wir über allem stünden und Dunkelheit und Anfechtung uns erspart würden. Gott ist gerade in der Lenkung der Geschichte ein verborgener Gott (vgl. Jes 45,15).
- O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege! Denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen?" (Röm 11,33-34)
Aber was im Schicksalsglauben einfachhin unbegreifbar blieb, wird nun zu einem zwar nicht auflösbaren, aber Vertrauen erweckenden Geheimnis. Wo der Schicksalsglaube als letzten Kern des Geschehens Gleichgültigkeit und Leere findet, offenbart sich für den Vorsehungsglauben die Liebe des Vaters. Auch wenn wir keinen Einblick in das Wie der göttlichen Wege und Führungen haben, so dürfen wir doch immer wieder Zeichen erkennen, in denen für den Glauben Gottes Führung erfahrbar wird. Daran kann sich der Glaube vergewissern und kräftigen in der Überzeugung, "daß Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt" (Röm 8,28).
2. Himmel und Erde
Im Anschluß an die Heilige Schrift nennt das Glaubensbekenntnis Gott den "Schöpfer des Himmels und der Erde". Mit "Himmel und Erde" bezeichnet es gemäß dem alten Weltbild die beiden äußersten Enden der Wirklichkeit. "Himmel und Erde" meint also das All und das Ganze der Wirklichkeit. Das Credo will sagen: Gott hat schlechterdings alles geschaffen. Aber es fügt sofort hinzu: Gott hat das All der Wirklichkeit in einer bestimmten Ordnung geschaffen. Denn das Große Glaubensbekenntnis deutet die bildhafte Aussage "Himmel und Erde" durch die abstrakten Begriffe "Sichtbares und Unsichtbares". Es unterscheidet damit eine geistige und eine materielle Schöpfungswirklichkeit. Erst beide zusammen machen das Ganze der Schöpfung, das All der Wirklichkeit aus. Zwischen beiden tut sich ein Raum auf, der der Daseinsraum des Menschen ist.
2.1 Die Erde - der Lebensraum des Menschen
Die Erde ist zunächst der Stoff, aus dem Gott Pflanzen und Tiere (vgl. Gen 1,11.24; 2,19) hervorgehen läßt. Aus ihr ist auch der Mensch genommen; zu ihr kehrt er wieder zurück (vgl. Gen 2,7; 3,19); sie muß er unter Mühsal und im Schweiß seines Angesichts bebauen, um so sein Brot zu verdienen (vgl. Gen 3,17-19). Die Erde ist also das Ganze der materiellen Welt, der Daseinsraum und die Daseinsbedingung des Menschen. Sie ist die Wohnstätte des Menschen und der Schauplatz der Geschichte. Sie ist von Gott für den Menschen geschaffen.
Die Schönheit der Erde und ihre Pracht wie ihre Nützlichkeit und Gediegenheit sind in der Bibel immer wieder Gegenstand des Lobes und des Dankes an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Auch Wohlstand und Reichtum sind davon im Alten Testament nicht ausgeschlossen. Die Bibel warnt zwar eindringlich vor den Gefahren des Reichtums, weil er zum Mammon, d. h. zum Abgott werden kann (vgl. Spr 11,28; Mt 6,19-21.24; Mk 10,23-25). Grundsätzlich ist aber auch der Reichtum, wenn er gerecht erworben wird, eine Gabe Gottes (vgl. Spr 10,22 u. a.). Jede Weltverachtung und jede Abwertung des Materiellen ist der Bibel zutiefst fremd. Ja, die Bibel vollzieht gegenüber dem Dualismus, der die Materie als Prinzip des Bösen und die Erde als Gefängnis des Menschen ansieht, eine Rehabilitation der Materie.
Die Schrift spricht darüber hinaus von der neuen Erde (vgl. Jes 65,17; Offb 21,1). Sie hofft, wenn die Gestalt dieser Welt vergeht (vgl. 1 Kor 7,31), auf die endgültige Verklärung auch der materiellen Wirklichkeit (vgl. Röm 8,21). In den Sakramenten dienen materielle Wirklichkeiten wie Wasser, Brot, Wein schon jetzt als Zeichen und Mittel des neuen Lebens. Unser Haben, Besitzen und Gebrauchen der materiellen Güter kann und darf darum nie Selbstzweck und letzte Daseinserfüllung sein, sondern muß auf das letzte Ziel des Menschen und der Welt, das Reich Gottes, ausgerichtet bleiben. Der hl. Augustinus sagt: Wir dürfen die irdischen Güter gebrauchen, aber wir dürfen sie nicht als Letztwerte genießen.
Sowenig wie die Bibel die Natur verachtet, verwirft sie die Kultur der Erde. Erst durch die kulturschöpferische Tat des Menschen wird die Erde zum Wohn- und Lebensraum des Menschen. Besonders die alttestamentliche Weisheitsliteratur beschreibt dieses Kulturschaffen des Menschen in Ackerbau, Städtebau, Technik, Handel, Rechtsprechung, Weisheitsüberlieferung, Erziehung, Politik u. a. Dabei ist die Bibel weit davon entfernt, die Erde als Material anzusehen, das der schrankenlosen Ausbeutung und dem egoistischen Konsum des Menschen dient. Im Gegenteil, aus dem Glauben an Gott, den "Schöpfer und Herrn der Erde", ergeben sich ethische Impulse. Weil Gott der Schöpfer und der Herr der Erde ist und diese als Gottes Schöpfung eine eigene Würde besitzt, ist sie dem Menschen zur verantwortlichen und pfleglichen Herrschaft anvertraut (vgl. Gen 1,28-30; 2,15). Nicht umsonst ist in diesem Zusammenhang vom Kulturauftrag, d. h. wörtlich übersetzt: vom Auftrag zum Hegen und Pflegen, die Rede. Dieser Gesichtspunkt ist gerade in unserer Situation von Bedeutung. Denn heute sind um einer lebenswürdigen Zukunft der Menschheit willen neue Orientierungen, aber auch neue Formen der Selbstbescheidung im Umgang mit unserer Umwelt vonnöten (vgl. Gem. Synode, Unsere Hoffnung IV, 4).
Daraus ergeben sich auch Konsequenzen für die Frage nach Recht und Grenzen des Eigentums. Weil Gott der Schöpfer und der Herr der Erde ist und weil er sie für alle Menschen gemacht hat, kann der Mensch nur als Treuhänder Eigentümer der Erde sein. Sein Recht auf Eigentum wird im 7. Gebot ausdrücklich geschützt (vgl. Ex 20,15.17; Dtn 5,19.21), aber es wird von den Propheten doch eindeutig der Fürsorgepflicht für die sozial Schwachen untergeordnet. Die Kritik der Propheten Amos und Jesaja an der Unterdrückung und Ausbeutung der Armen, an der Bestechlichkeit der Richter und an der Unbarmherzigkeit und Parteilichkeit der Amtsträger läßt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig (vgl. Am 5,10-12; 8,4-8; Jes 5,8-10; 10,1-3 u. a.). Auch wenn Jesus sich nicht als Richter oder Erbteiler eingesetzt weiß (vgl. Lk 12,13-14), so weiß er sich im Anschluß an den Propheten Jesaja doch gesandt, den Armen die Frohe Botschaft zu bringen und die Freilassung der Gefangenen auszurufen (vgl. Jes 61,1-2; Lk 4,18). Die freiwillige Gütergemeinschaft der Jerusalemer Urgemeinde ist ein Zeichen der anbrechenden Gottesherrschaft (vgl. Apg 2,44-45; 4,32-37). Dasselbe Ideal war zu allen Zeiten der Kirchengeschichte für Christen, die dazu berufen waren, ein Anstoß, freiwillig auf persönliches Eigentum zu verzichten und in Ordensgemeinschaften Gütergemeinschaft zu üben. Für alle Christen aber folgt aus der Herrschaft Gottes über die Erde, daß die Güter der Erde gerecht zu verteilen sind, damit alle daran Anteil haben und jeder seinen Lebensraum und seine Lebensbedingungen auf der Erde finden kann (vgl. GS 69).
2.2 Der Himmel - die Hoffnung des Menschen
Schwieriger als die Erschaffung der Erde ist für uns heute die Erschaffung des Himmels zu verstehen. Was ist der Himmel? Für uns wie für die Bibel ist der Himmel zunächst das sichtbare Firmament, das sich über der Erde wölbt. Daneben findet sich auch noch in unserem heutigen Sprachgebrauch eine zweite Deutung. Wir sagen etwa, man fühle sich im Himmel, habe den Himmel auf Erden oder aber der Himmel sei wie verhangen. In dieser zweiten Bedeutung ist der Himmel der Bereich des menschlichen Strebens, Hoffens, Träumens, das alles Sichtbare, Greifbare, Berechenbare und Machbare übersteigt und ihm erst Weite, Höhe und Tiefe, Aussicht und Perspektive gewährt. Das meint auch das Credo, wenn es sagt, Gott habe zusammen mit der Erde, dem Sichtbaren, die Welt des Unsichtbaren geschaffen. Die Welt ist also mehr, als der Materialismus - der theoretische wie der praktische - meint. Der Materialismus verkennt die Höhe und Tiefe, den Reichtum und die Fülle der Wirklichkeit.
Für die Bibel besteht kein Zweifel daran, daß Gott allein der Himmel des Menschen, d. h. die Erfüllung seiner tiefsten Wünsche und Sehnsüchte ist. Himmel ist dort, wo Gott ist, wo man ihm begegnet und nahe ist. Nicht umsonst ist im Neuen Testament "Himmelreich" ein anderes Wort für "Gottesreich". Wenn das Credo sagt, Gott habe den Himmel geschaffen, dann meint es damit auch Wesen, die Gott besonders nahestehen und ihn stets verherrlichen. In der Weihnachtsgeschichte ist von den himmlischen Heerscharen die Rede, die Gott loben: "Verherrlicht ist Gott in der Höhe" (Lk 2,14). Die Heilige Schrift und die kirchliche Glaubensüberlieferung nennen sie die Engel. Sie sind sozusagen die unsichtbaren Begleiter und Wächter der Sehnsüchte und Hoffnungen des Menschen.
Die Aussagen über die Engel begegnen heute vielen Einwänden und Verstehensschwierigkeiten. Ohne Zweifel drückt die Schrift die Lehre von den Engeln weithin in mythologischen Sprachformen und in den Vorstellungen der damaligen Zeit aus. Auch ist eine geschichtliche Entwicklung der Engelvorstellungen nicht zu bestreiten. In der christlichen Frömmigkeit wurden sie nicht selten verharmlost, verniedlicht und verkitscht. Ein ernsthaftes Sprechen über die Engel ist auch deshalb schwierig, weil wir dabei an Grenzen der menschlichen Aussagemöglichkeiten geraten. Das wußten auch die großen Lehrer der Kirche. Deshalb müssen wir mit Spekulationen über die Zahl, die Art, die Unterscheidungen und Ordnungen (Chöre) der Engel zurückhaltend sein. Auf der anderen Seite sollten wir freilich auch sehen, daß die Wirklichkeit umfassender und tiefer ist, als eine rationalistisch mißverstandene Vernunft ahnt. Die Wirklichkeit hat ein Unten und ein Oben, ohne welche der Schöpfung Ganzheit, Fülle und Vollkommenheit fehlen würde. Sie wäre dann materialistisch verengt und hätte nicht jene geheimnishafte (numinose) Tiefe und Höhe, die auch viele Dichter und Denker erahnt haben. In der Bildersprache des Mythos drückt sich also eine wesentliche Dimension der Wirklichkeit aus, die rein begrifflich kaum zu fassen ist.
Das Zeugnis der Heiligen Schrift von der Existenz der Engel ist eindeutig. Es findet sich in der Bibel an sehr vielen Stellen.
- "Durch das Wort des Herrn wurden die Himmel geschaffen, ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes." (Ps 33,6)
- "Denn in ihm (Christus) wurde alles erschaffen im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten..." (Kol 1,16)
Neben dem Zeugnis der Heiligen Schrift ist vor allem das Zeugnis der Liturgie von Bedeutung. Die Engel kommen dort nicht nur am Rande vor, sie haben ihren Ort in der innersten Mitte der Liturgie, beim Sanctus innerhalb des eucharistischen Hochgebets. Gestützt auf solche Zeugnisse der Schrift, der Liturgie und der übrigen Überlieferung hat die kirchliche Lehrverkündigung die Existenz der Engel mehrfach amtlich bekundet (vgl. DS 455-457; 800; 3002; NR 288-290; 295; 316).
Was sind die Engel? Nach der Heiligen Schrift sind sie eindeutig Geschöpfe. Wir dürfen sie verehren, aber nicht anbeten (vgl. Dtn 17,3; Offb 22,8-9). In Anlehnung an die Bibel (vgl. Hebt 1,14) bestimmt sie das Glaubensbekenntnis als unsichtbare, d. h. geistige Schöpfung. Das heißt nicht, daß sie ohne jeden Bezug zur sichtbaren Welt sind und nur sporadisch in sie hineinwirken. Sie repräsentieren einzelne Bereiche der Schöpfung vor Gott.
Die ureigene Aufgabe der Engel ist die Verherrlichung Gottes. Immer wieder heißt es in der Heiligen Schrift: "Lobt den Herrn, ihr seine Engel" (Ps 103,20; vgl. 148,2; Dan 3,59). Im Sanctus der Liturgie stimmt die Kirche in das Dreimal-Heilig der Engel vor dem Thron Gottes ein (vgl. Jes 6,3; Offb 4,8). So verwirklichen die Engel das wichtigste Sinnziel der Schöpfung, die Verherrlichung Gottes. Die Engel sind aber auch in die Geschichte Gottes mit den Menschen einbezogen. Auch die Engel sind in Christus und auf Christus hin geschaffen (vgl. Kol 1,16). Deshalb sind sie nach den großen Lehrern der Kirche von Gott mit übernatürlicher Gnade ausgestattet. Sie sind in der Geschichte Gottes mit den Menschen Diener und Boten Gottes (vgl. Hebt 1,7). Besonders im Zusammenhang der Offenbarung Jesu Christi treten sie als deutende Boten auf (vgl. Lk 1,11-13.26-28; Mt 28,2-4; Apg 1,10-11). Schließlich sind die Engel personale Gestalten des Schutzes und der Fürsorge Gottes für die Gläubigen. In dem bekannten Psalm (und Kirchenlied) "Wer im Schutz des Höchsten wohnt" wird das Vertrauen und die Zuversicht in Gott auch damit begründet: "Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen" (Ps 91,11; vgl. Gotteslob 291). So sind die Engel "dienende Geister, ausgesandt, um denen zu helfen, die das Heil erben sollen" (Hebt 1,14).
Ausgehend von solchen Aussagen hat sich in der Frömmigkeitsgeschichte der Kirche der Glaube herausgebildet, Gott habe jedem Gläubigen, ja jedem Menschen einen besonderen Schutzengel beigegeben. Diese Glaubensüberzeugung stößt heute, zumal in der verniedlichenden Form eines falschen Kinderglaubens, auf Skepsis. Sie hat indes - recht verstanden - einen Anhalt in der Aussage Jesu über die Kinder: "Ihre Engel im Himmel sehen stets das Angesicht meines himmlischen Vaters" (Mt 18,10). Sie bringt nochmals zum Ausdruck, daß die sichtbare Welt eine unsichtbare Tiefendimension besitzt und daß jeder einzelne Mensch, auch und gerade das kleine Kind, vor Gott einen unendlichen Wert besitzt. Die Engel sind uns Helfer und Bürgen dafür, daß unsere Hoffnung und Sehnsucht nicht ins Leere gehen, daß uns der Himmel offensteht.
In ganz anderer Weise kommt die Höhen- und Tiefendimension der Wirklichkeit in der biblischen und kirchlichen Überzeugung von der Existenz der bösen Geister, der Dämonen, des Satans bzw. des Teufels zur Geltung. Es gibt nicht nur Hüter und Wächter der menschlichen Hoffnung, sondern auch Neider, Feinde und Verführer, die die Sehnsucht und Hoffnung des Menschen verwirren, gewaltsam niederhalten oder ins Maßlose, ins Dämonische hinein übersteigern; es gibt den Teufel, den Vater der Lüge (vgl. Joh 8,44). Er ist der Versucher, der uns den Himmel vergällen und verstellen will.
Die Verstehensschwierigkeiten und Mißverständnisse sind hier eher noch größer als bei den Engeln. Sicherlich ist die Sprache der Heiligen Schrift wie der kirchlichen Glaubensüberlieferung gerade hier zeit- und weltbildbedingt. Auf der anderen Seite ist die Existenz des Üblen, des Bösen, Destruktiven, Perversen, Monströsen, Absurden und nicht zuletzt des Diabolischen eine menschliche Erfahrungswirklichkeit wie der Eindruck, daß dieses Böse nicht nur Ausdruck und Folge menschlicher Freiheit ist, sondern eine kosmische Dimension besitzt. Der Horizont, biblisch gesprochen: der Himmel, in den hinein die menschliche Freiheit sich vollzieht, ist vorgängig zu unseren Entscheidungen verengt, verfinstert, verwirrt. Das Paradies ist uns wie durch Cherubim und mit loderndem Flammenschwert versperrt (vgl. Gen 3,24).
Das biblische Zeugnis deutet diese Situation in mythischer Bildersprache, will damit aber eine Realität bezeichnen, die rein begrifflich kaum zu fassen ist. Die bildhaften Aussagen vom zusammengestürzten Himmel, vom Engelsturz (vgl. 2 Petr 2,4; Jud 6), von den bösen Geistern in den Lüften, im Bereich zwischen Himmel und Erde (vgl. Eph 2,2; 3,10; 6,12) treffen die Situation des Menschen sehr genau. Sie deuten an, daß wir nicht nur gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen haben (vgl. Eph 6,12). Die bösen "Mächte und Gewalten" (vgl. Eph 1,21; Kol 2,15 u. a.) repräsentieren den Aufstand und Widerstand der Welt gegen Gott und seine Ordnung und damit zugleich das menschenfeindliche Wesen vieler Wirklichkeitsbereiche. Sie verderben Gottes gute Schöpfung und suchen dem Menschen auch im Bereich des Leiblichen zu schaden, bis dahin, daß sie von seinen körperlichen und seelischen Kräften Besitz ergreifen und den Menschen zutiefst von sich selbst entfremden können (Besessenheit). Als Herrscher dieser Welt (vgl. Joh 12,31; 14,30) und als Gott dieser Weltzeit (vgl. 2 Kor 4,4) vereiteln sie die Hoffnung und die Sehnsucht des Menschen, oder sie übersteigern diese ins Maßlose wie die Paradiesesschlange: "Ihr werdet wie Gott" (Gen 3,5). So ist der Teufel der Vater der Lüge (vgl. Joh 8,44). Er deutet die Wahrheit über den Menschen um; er vernebelt die an sich klare Unterscheidung zwischen Ja und Nein und verwirrt die von Gott gegebene Ordnung der Welt. Damit wird er für den Menschen zum Versucher, der freilich nur dann, wenn der Mensch ihm zustimmt, Macht über ihn gewinnen kann.
Macht und Ohnmacht der bösen Geister werden in der Bibel vor allem im Zusammenhang des Auftretens Jesu deutlich. Besonders das Markusevangelium beschreibt das ganze Leben und Wirken Jesu als Kampf mit dem Satan (vgl. Mk 1,23-28.32-34.39; 3,22-30 u. a.). Mit Jesus aber kommt der Stärkere, der den Starken besiegt. In ihm bricht die Herrschaft Gottes an, weil er in der Macht Gottes die Dämonen austreibt (vgl. Mt 12,28; Lk 11,18; 10,18). Weil Jesus Christus die bösen Mächte und Gewalten endgültig besiegt hat (vgl. Eph 1,21; Kol 2,15; Offb 12,7-12), ist Dämonenangst unchristlich. Vielmehr gilt: "Seid nüchtern und wachsam! Euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Leistet ihm Widerstand in der Kraft des Glaubens!" (1 Petr 5,8-9).
Die kirchliche Lehre liegt auf der Linie des Schriftzeugnisses. Denn soll das den Menschen unfrei machende Böse nicht von einem bösen, von Gott unabhängigen Urprinzip stammen, was dem christlichen Glauben an Gott, den allmächtigen Vater, zutiefst widerspräche, dann kann es nur auf Geschöpfe zurückgehen, die von Gott gut geschaffen, aber - wie das IV. Laterankonzil (1215) sagt - durch eigene Entscheidung böse geworden sind (vgl. DS 800; NR 295). Nach kirchlicher Lehre gibt es also nicht nur das Böse, sondern auch den Bösen bzw. die Bösen. Damit wird die katholische Lehre einerseits der menschlichen Erfahrung von der Abgründigkeit der Welt wie dem biblischen Zeugnis gerecht, andererseits kann sie damit die Bedeutung und den Einfluß der bösen Geister begrenzen: Sie sind trotz allem nur endliche, von Gott geschaffene und insofern bleibend von ihm abhängige Größen. Ihre unselige Herrschaft ist durch Jesus Christus gebrochen und wird durch das Wirken des Heiligen Geistes immer mehr überwunden. Die Hoffnung behält das letzte Wort.
Mit "Himmel und Erde" ist der Daseinsraum des Menschen abgesteckt und der Raum eröffnet, in dem sich die Geschichte Gottes mit dem Menschen abspielt. Alle Aussagen über die materielle Welt wie über die geistige Welt der Engel und Dämonen sind deshalb Rand- und Rahmenaussagen für dieses Zentrum der Glaubensverkündigung. Wir dürfen diese Aussagen darum nicht zum Zentrum oder zu einem um seiner selbst willen wichtigen Gegenstand der Verkündigung und des Glaubens machen. Umgekehrt dürfen wir die kosmische Dimension, die sich in ihnen ausspricht, nicht zugunsten einer anthropologischen Engführung übersehen. In der biblischen und kirchlichen Rede von den Engeln wie von den Dämonen geht es um die universal-kosmologische Dimension der Geschichte Gottes mit den Menschen. Sie erst gibt dieser Geschichte ihre Dramatik und ihre universale Dimension.
3. Der Mensch - Mitte und Krone der Schöpfung
3.1 Frage nach dem Menschen
Himmel und Erde sind die beiden Dimensionen der Wirklichkeit; sie stecken den Raum ab, in dessen Mitte der Mensch steht. "Es ist", so stellt das II. Vatikanische Konzil fest, "fast einmütige Auffassung der Gläubigen und der Nichtgläubigen, daß alles auf Erden auf den Menschen als seinen Mittel- und Höhepunkt hinzuordnen ist" (GS 12). Doch steht dieser Aussage nicht die Erfahrung entgegen, daß der Mensch in vielfacher Hinsicht ein armseliges Wesen ist? Wir wissen heute, daß unsere Erde nicht der Mittelpunkt der Welt und daß nach der Überzeugung der meisten Naturwissenschaftler der Mensch hineinverflochten ist in die Evolution des Lebens. So fragen wir neu: Was ist der Mensch? Dies ist die Urfrage der abendländischen Menschheit von ihren Anfängen an. Auch die Bibel stellt diese Frage (vgl. Ps 8,5; 144,3; Ijob 7,17f. Diese Frage findet zumal heute unterschiedliche, ja gegensätzliche Antworten. Entweder wird der Mensch optimistisch und idealistisch als Freiheitswesen bestimmt, das über seine Bestimmung selbst zu entscheiden hat. Oft ist er sich dabei selbst der höchste Maßstab. Er meint, er müsse sich von Abhängigkeiten aller Art emanzipieren, es gelte, nur sich selbst zu verwirklichen. Oder es kommt zu einem materialistischen "schlechthin geheimnisleeren Bild vom Menschen, das nur einen reinen Bedürfnismenschen zeigt, einen Menschen ohne Sehnsucht, das heißt aber auch ohne Fähigkeit zu trauern und darum ohne Fähigkeit, sich wirklich trösten zu lassen und Trost anders zu verstehen denn als reine Vertröstung" (Gern. Synode, Unsere Hoffnung 1, 1). Sehr wirksam ist gegenwärtig das Menschenbild der marxistischen Weltanschauung: der Mensch als "Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse", als Produkt und Produzent der Gesellschaft, gerade so viel wert, als er der Gesellschaft und ihrem Fortschritt dient. Alle diese Antworten enthalten einen richtigen Teilaspekt; durch ihre Einseitigkeit verfehlen sie aber die komplexe Wirklichkeit des Menschen, dessen Geheimnis man nicht kurzschlüssig in eine einzige Antwort einfangen kann. Doch noch bedenklicher als solche einseitigen Auffassungen ist die Tatsache, daß heute viele Menschen die Frage nach dem Sinn ihres Menschseins gar nicht mehr stellen, daß sie sich selbst davon laufen und verlieren. Darin besteht vielleicht die tiefste Krise des gegenwärtigen Menschen. Denn der Mensch ist vor allen anderen Lebewesen dasjenige, das nach sich selbst fragen kann und das sich in dieser Frage einem ihm selbst unauflösbaren Geheimnis begegnet. Alle noch so reichen und tiefen Antworten auf die Frage nach dem Geheimnis des Menschen bleiben bruchstückhaft, wenn sie den Menschen nicht von diesem seinem letzten Grund und Ziel her verstehen. 3.2 Geschöpflichkeit des Menschen Die fundamentale Antwort der Bibel auf die Frage "Was ist der Mensch?" lautet: Der Mensch ist Geschöpf Gottes; er verdankt sein Dasein und Sosein Gott. Er ist von Gott in seinem Dasein gewollt und gehalten; er ist, weil Gott ihn beim Namen gerufen hat: Ich will, daß du bist. Der Grundakt seinesDaseins ist darum Dank und Vertrauen.
- "Ich danke dir,
- daß du mich so wunderbar gestaltet hast.
- Ich weiß: Staunenswert sind deine Werke.
- Als ich geformt wurde im Dunkeln,
- kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde,
- waren meine Glieder dir nicht verborgen.
- Deine Augen sahen, wie ich entstand,
- in deinem Buch war schon alles verzeichnet;
- meine Tage waren schon gebildet,
- als noch keiner von ihnen da war.
- Wie schwierig sind für mich, o Gott, deine Gedanken,
- wie gewaltig ist ihre Zahl!
- Wollte ich sie zählen, es wären mehr als der Sand.
- Käme ich bis zum Ende,
- wäre ich noch immer bei dir." (Ps 139,14-18)
Lassen sich solche Aussagen von der unmittelbaren Schöpfung des Menschen durch Gott halten angesichts der modernen Evolutionstheorie? Im Prinzip ist auf diese Frage dieselbe Antwort zu geben wie bei der Frage nach der Evolution der anderen Lebewesen: Gottes Schöpfermacht als die alles umfassende Ursache schließt von ihm ermächtigte "Zweitursachen" nicht aus, sondern ein.
Die kirchliche Lehre macht jedoch einen Unterschied zwischen der Entstehung des Menschen und der der übrigen Lebewesen. Sie gibt die Abstammung des menschlichen Leibes aus vormenschlichen Lebewesen der wissenschaftlichen Diskussion frei, hält aber an der unmittelbaren Erschaffung der menschlichen Seele durch Gott fest (vgl. DS 3896; NR 332). Damit ist gesagt, daß der Mensch mehr ist als das Ergebnis einer biologischen Evolution. Er ist kein Zufallsprodukt der Entwicklung, vielmehr ist jeder einzelne Mensch in einmaliger und ganz persönlicher Weise von Gott gewollt. Jeder Mensch ist ein einmaliger schöpferischer Gedanke Gottes und die persongewordene Antwort auf einen persönlichen Anruf Gottes. Hier liegt der tiefste Grund der Würde des Menschen als Person, die mit einer Geistseele begabt ist. Auch bei der Verwirklichung dieses seines schöpferischen Anrufs nimmt Gott Zweitursachen in Dienst. Dies gilt sowohl vom Entstehen des ersten Menschen aus vormenschlichen Lebensformen (Hominisation) wie vom Werden jedes einzelnen Menschen im Akt der Zeugung. Die Eltern wirken bei der Weitergabe des Lebens bei der Liebe Gottes, des Schöpfers, mit und sind gleichsam Interpreten dieser Liebe (vgl. GS 50).
Die Glaubensaussage von der besonderen Schöpfung des Menschen durch Gott bringt die besondere Stellung des Menschen innerhalb der übrigen Geschöpfe zum Ausdruck und begründet seine einmalige Würde. Fragen wir deshalb: Worin ist sie begründet?
3.3 Gottebenbildlichkeit des Menschen
Die Bibel unterscheidet die Schöpfung des Menschen von der Schöpfung der übrigen Lebewesen. Das kommt dadurch zum Ausdruck, daß die ältere, die zweite Schöpfungserzählung, die Erschaffung der übrigen Kreatur nur knapp andeutet, die Erschaffung des Menschen dagegen ausführlich beschreibt und dabei den Menschen in die Mitte der übrigen Kreatur rückt. Der Mensch (adam) ist von der Erde (adamah) genommen; den Lebensatem aber bläst Gott unmittelbar in seine Nase (vgl. Gen 2,7). Der erste und jüngere Schöpfungsbericht betrachtet die Erschaffung des Menschen als den Höhepunkt der Schöpfung. Er leitet sie mit besonderer Feierlichkeit ein und nennt dann das Auszeichnende des Menschen gegenüber der übrigen Wirklichkeit seine Gottebenbildlichkeit.
- "Dann sprach Gott: Laßt uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie." (Gen 1,26-27)
Worin besteht diese Gottebenbildlichkeit? Vielerlei Antworten werden gegeben: Der Mensch unterscheidet sich durch seinen aufrechten Gang, Zeichen seiner Erhabenheit, von den übrigen Lebewesen. - Der Mensch ist eingesetzt zum Herrn der Erde und der übrigen Lebewesen; sie sind ihm zum Nutzen und zur Pflege übergeben; er ist berufen, die Herrschaft Gottes als "Statthalter Gottes" in der Welt zu repräsentieren. - Der Mensch unterscheidet sich durch seine Geistseele, er ist mit Verstand und freiem Willen begabt (vgl. Weish 2,23). Alle diese Deutungen enthalten etwas Richtiges. Das Entscheidende ist freilich: Die Sonderstellung des Menschen ergibt sich für die Bibel nicht aus dem Vergleich mit dem Unten, den Tieren, sondern mit dem Oben, aus dem Vergleich mit Gott. Von allen Lebewesen ist der Mensch das einzige Wesen, das Gott entspricht, das Gott hören und antworten kann. Der Mensch ist geschaffen als Partner Gottes, berufen zur Gemeinschaft mit Gott. Erst in der Hinwendung zu Gott und in der Anerkennung der Herrschaft Gottes ist er ein wirklich menschlicher Mensch. Der Sinn und die Erfüllung seines Daseins ist die Verherrlichung Gottes, mit der er der stummen Kreatur Stimme verleihen soll. Diese Deutung kommt in den Psalmen in herrlicher Weise zum Ausdruck:
- "Herr, unser Herrscher,wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde; über den :Himmel breitest du deine Hoheit aus... Was ist der Mensch, daß du an ihn :denkst, des Menschen Kind, daß du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur :wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über das Werk deiner Hände, hast ihm alles zu Füßen gelegt... Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde!" (Ps 8,2.5-7.10; vgl. Sir 17,1-10)
Die Gottebenbildlichkeit des Menschen ordnet den Menschen ein in ein vierfaches Geflecht von Beziehungen, woraus sich eine vierfache Bestimmung des Menschen ergibt: Gott zu loben, den Nächsten zu lieben, in der Welt zu leben und sie zu pflegen, sich selbst und auf sich selbst zu achten.
1. Der Mensch ist das Wesen, das in Beziehung zu Gott steht. Diese Beziehung kommt nicht äußerlich und nachträglich zum Menschsein hinzu, sie konstituiert den Menschen in seinem ganzen Dasein und Sosein. Sie bedeutet, daß der Mensch ein zutiefst gottbezogenes Wesen ist. Er entspricht Gott und ist deshalb von und für Gott ansprechbar. Er kann seine Gottesbeziehung vergessen, verdrängen, verkehren, aber er kann sie nie abschütteln. Das ganze Leben des Menschen ist, ob er es weiß oder nicht, eine Frage und Suche nach Gott. Das macht seine Größe und Würde, aber auch den Grund für seine geschöpfliche Demut aus. Aufgrund dieser Spannung steht er in der Versuchung zwischen Hochmut und Kleinmut (Verzweiflung). Seine wahre Würde aber findet er in der Demut und in der Großmut, Gott zu dienen und ihn zu verherrlichen.
2. Die Beziehung zu Gott und die Partnerschaft des Menschen mit Gott spiegeln sich im partnerschaftlichen Wesen des Menschen. Das hat zur Folge, daß der Mensch kein Einzelwesen ist, sondern "aus seiner innersten Natur ein gesellschaftliches Wesen; ohne Beziehung zu den anderen kann er weder leben noch seine Anlagen zur Entfaltung bringen" (GS 12). Dazu gehört vor allem, daß Gott den Menschen partnerschaftlich, als Mann und als Frau geschaffen hat (vgl. Gen 1,27). Als Gottes Bild sind beide in ihrer Verschiedenheit ebenbürtig und gleichwertig. Jede Diskriminierung wegen des Geschlechts widerspricht deshalb dem christlichen Glauben. Beide finden ihre Erfüllung aber nur im Zueinander und Miteinander. Der Bund zwischen Mann und Frau ist darum in der Bibel ein Bild des Bundes Gottes mit den Menschen (vgl. Hos 1-3; Jes 54; Eph 5,21-33).
Ihre gegenseitige Liebe ist zugleich Dienst am Leben. In der Vereinigung von Mann und Frau darf der Mensch teilhaben am Schöpfertum Gottes. "Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch" (Gen 1,28). Diesen Auftrag zum Dienst am Leben haben die Eheleute, wie es dem Wesen der Liebe entspricht, in persönlicher, menschlicher und christlicher Verantwortung vor Gott und voreinander zu erfüllen (vgl. GS 50-51; FC).
3. Durch seine Sonderstellung steht der Mensch der übrigen Schöpfung gegenüber. Der Mensch soll und darf sich die übrige Kreatur dienstbar machen und sich ihrer erfreuen. Seine Herrschaft über die Welt bedeutet indes nicht die Freiheit zu willkürlicher und egoistischer Ausbeutung der Natur, sondern schließt Fürsorge und Verantwortung für das Leben ein. Die Bibel sieht die Herrschaft des Menschen über die Welt darin verwirklicht, daß der Mensch den Dingen und der Welt einen Namen gibt (vgl. Gen 2,19-20). Durch diese Namengebung anerkennt der Mensch die Dinge und die Tiere in dem, was sie sind, und er bringt sie damit zu sich selbst. Auch die übrige Kreatur hat ja ihren von Gott gegebenen Eigenwert und ihre Eigengesetzlichkeit, die der Mensch respektieren muß, will er seine Lebenswelt nicht zerstören.
4. Schließlich ist der Mensch das Wesen, das auch in Beziehung zu sich selbst steht. Die Bibel spricht in diesem Zusammenhang vom Herzen des Menschen. Damit ist nicht nur ein zentrales leibliches Organ gemeint; das leibliche Herz wird vielmehr als Symbol für die personale Mitte des Menschen verstanden. Es ist das Innere, der Ort, wo der Mensch Gott vernehmen, ihm gehorchen, sich ihm aber auch verweigern kann. In unserer Sprache können wir sagen: Das Herz ist das Selbst, die Person des Menschen. Personalität besagt, daß der Mensch bei und in aller Offenheit für Gott, die Menschen und die Welt bei sich selbst ist, so daß er je einmaligen Wert und je einmalige Würde in sich selbst besitzt und Verantwortung trägt für sein eigenes Tun und Lassen. Er hat nicht nur einen Außenraum; er ist in seinem Innern mit sich selbst beschäftigt und kann auf sich selbst reflektieren. Er kann über sich lachen, sich über sich ärgern, sich schämen, mit sich zufrieden oder unzufrieden sein. Wir kennen uns und die anderen Menschen erst, wenn wir wissen, was im Innersten vorgeht. Der Mensch, der als Person auf sich selbst bezogen und sich selbst konfrontiert ist, ist zugleich auf Gott bezogen. Seine personale Bestimmung ist darum die Gemeinschaft mit Gott, die in und durch Jesus Christus ihre Erfüllung findet.
Die Aussage von der Gottebenbildlichkeit des Menschen hat wichtige praktische Folgen:
Die Würde jedes Menschen vor Gott begründet die Würde des Menschen vor anderen Menschen. Sie ist der letzte Grund für die fundamentale Gleichheit und Brüderlichkeit aller Menschen, unabhängig von ihrer Rasse, ihrem Volk, ihrem Geschlecht, ihrer Herkunft, Bildung, Klasse. In der alten Welt war dies eine revolutionäre Aussage, und sie ist es noch heute, wenn man an die Unterschiede und Diskriminierungen denkt, die auch in der gegenwärtigen Welt zwischen den Menschen bestehen. Weil auf jedes Menschen Antlitz etwas widerstrahlt von der Herrlichkeit Gottes, ist vor allem das Leben des Menschen heilig und unantastbar (vgl. Gen 9,6). Das fünfte Gebot "Du sollst nicht morden" (Ex 20,13; Dtn 5,17) gilt, weil Gott seine Hand auf jeden Menschen, besonders auf die Machtlosen, Kleinen, Armen gelegt hat und weil er allein Herr über Leben und Tod ist. Ebenso gilt: "Was immer die Unantastbarkeit der menschlichen Person verletzt, wie Verstümmelung, körperliche oder seelische Folter und der Versuch, psychischen Zwang auszuüben; was immer die menschliche Würde angreift, wie unmenschliche Lebensbedingungen, willkürliche Verhaftung, Verschleppung, Sklaverei, Prostitution, Mädchenhandel und Handel mit Jugendlichen, sodann auch unwürdige Arbeitsbedingungen, bei denen der Arbeiter als bloßes Erwerbsmittel und nicht als freie verantwortliche Person behandelt wird: all diese und andere ähnliche Taten sind an sich schon eine Schande; sie sind eine Zersetzung der menschlichen Kultur, entwürdigen weit mehr jene, die das Unrecht tun, als jene, die es erleiden. Zugleich sind sie in höchstem Maße ein Widerspruch gegen die Ehre des Schöpfers" (GS 27). Der Mensch darf den anderen Menschen also nie als Sache benutzen, er muß ihn vielmehr als eigenständiges und eigenverantwortliches Wesen achten und ihm Respekt bezeugen.
Aus der Würde des Menschen vor Gott folgt auch die Würde des Menschen vor sich selbst, das Recht und die Pflicht zur Selbstachtung und Selbstliebe. Wir sollen ja den Nächsten lieben wie uns selbst (vgl. Mk 12,31). Wir dürfen und sollen uns also etwas wert sein und sollen auf unsere Gesundheit ebenso achten wie auf unsere Ehre und unseren Ruf. Dies alles entspricht freilich nur dann der Würde des Menschen, wenn der Mensch seine Erfüllung nicht zuerst in dem sucht, was er hat, sondern in dem, was er ist. "Der Wert des Menschen liegt mehr in ihm selbst als in seinem Besitz" (GS 35). Gerade in der Hast und Hetze des modernen Alltags besteht die Gefahr, daß wir uns selbst vergessen und verlieren und nicht mehr zur Besinnung auf uns selbst kommen. Auch dies ist gegen Wert und Würde des Menschen.
3.4 Wesen des Menschen
Aufgrund der Bestimmung und der Würde des Menschen stellt sich nochmals die Frage: Was ist der Mensch? Was ist der Wesensstand des Menschen? Die Antwort der Bibel kommt unserer heutigen Erfahrung und Erkenntnis sehr entgegen. Wir erfahren den Menschen nicht als Zusammensetzung aus zwei Teilen, aus einem materiellen Leib und einer geistigen Seele; wir verstehen den Menschen vor allem als eine Einheit und Ganzheit. Wenn etwa der Leib krank und leidend ist, leidet der ganze Mensch; umgekehrt können leibliche Krankheiten seelische Ursachen haben. Ähnlich meint die Bibel, wenn sie vom Menschen als Ebenbild Gottes spricht, immer den einen und ganzen Menschen. Sie beschreibt ihn mit Hilfe einzelner leiblicher Organe wie Lebensatem, Fleisch, Herz, Nieren, Seele, die neben ihrer unmittelbaren Bedeutung alle eine übertragene Bedeutung haben und den ganzen Menschen bezeichnen. Wenn das Neue Testament vom ewigen Wort sagt, es sei Fleisch geworden (vgl. Joh 1,14), dann heißt das nichts anderes als: Jesus Christus ist Mensch geworden. So müssen wir sagen: Der Mensch hat nicht Leib und Seele, er ist Leib und er ist Seele und Geist.
Entsprechend hat die kirchliche Glaubenslehre sowohl gegen eine einseitig materialistische wie gegen eine einseitig spiritualistische Deutung des Menschen immer wieder die Einheit des Menschen in Seele und Leib verteidigt (vgl. DS 800; 3002; NR 918; 316). Im Anschluß an die Lehre des hl. Thomas von Aquin (13. Jh.) lehrte die Kirche, die Geistseele sei die Wesensform des Leibes (vgl. DS 902; NR 329). Damit ist gemeint: Leib und Seele sind nicht zwei getrennte Elemente, die erst nachträglich vereinigt werden. Der Leib kann gar nicht ohne die Seele existieren; er ist Ausdrucksgestalt und Daseinsform der Seele. Umgekehrt ist die menschliche Geistseele wesentlich im Leib, und sie ist nicht ohne Leibbezogenheit zu denken. Das II. Vatikanische Konzil faßt diese Lehre zusammen: Der Mensch ist "in Leib und Seele einer" (GS 14).
Auch das Heil gilt dem einen und ganzen Menschen. Das Reich Gottes ist für Jesus keineswegs nur eine innere, geistige Wirklichkeit. Zur Reich-Gottes-Verkündigung Jesu gehören auch seine Krankenheilungen. "Blinde sehen wieder, und Lahme gehen; Aussätzige werden rein, und Taube hören; Tote stehen auf, und den Armen wird das Evangelium verkündet" (Mt 11,5). Deshalb sollen wir Gott in unserem Leib verherrlichen (vgl. 1 Kor 6,20; Röm 12,1). Zwar wird der Leib sterben; aber die Hoffnung des Christen geht doch darauf, daß er in einen neuen Leib der Herrlichkeit verwandelt werden wird (vgl. 1 Kor 15,35-49, Phil 3,21).
Innerhalb dieser Einheit von Leib und Seele können und müssen wir zwischen Leib und Seele unterscheiden. Auch das entspricht unserer alltäglichen Erfahrung. Der Mensch kann geistig seinem Leib gegenübertreten und sich ihm beobachtend und reflektierend zuwenden; er kann aber auch geistig abwesend sein. Er kann den Leib und seine Bedürfnisse unterdrücken; er kann sich von ihnen aber auch überwältigen lassen und dabei seine personale Freiheit und Würde verlieren. Schließlich kann der Leib des Menschen alt und schwach, sein Geist aber noch jung und frisch sein. Der Mensch hat offenbar viele Seiten, die man nicht auf ein einziges Prinzip zurückführen kann.
Durch seine Leiblichkeit vereinigt er die Elemente der stofflichen Welt in sich; "durch ihn erreichen diese die Höhe ihrer Bestimmung und erheben ihre Stimme zum freien Lob des Schöpfers" (GS 14). Aber der Mensch ist nicht nur ein Teil der Natur oder ein anonymes Element in der menschlichen Gesellschaft, denn durch seine Geistigkeit übersteigt er die Gesamtheit der Dinge und dringt in die geistig-tiefere Struktur der Wirklichkeit ein. "Wenn er daher die Geistigkeit und Unsterblichkeit seiner Seele bejaht, wird er nicht zum Opfer einer trügerischen Einbildung, die sich von bloß physischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen herleitet, sondern erreicht er im Gegenteil die tiefe Wahrheit der Wirklichkeit" (GS 14).
"Die verborgenste Mitte und das Heiligtum im Menschen" ist das Gewissen, "wo er allein ist mit Gott, dessen Stimme in diesem seinem Innersten zu hören ist". "Im Innern seines Gewissens entdeckt der Mensch ein Gesetz, das er sich nicht selbst gibt, sondern dem er gehorchen muß und dessen Stimme ihn immer zur Liebe und zum Tun des Guten und zur Unterlassung des Bösen anruft und, wo nötig, in den Ohren des Herzens tönt: Tu dies, meide jenes" (GS 16).
"Aber nur frei kann der Mensch sich zum Guten hinwenden." Diese Freiheit ist ein Zeichen der Gottebenbildlichkeit des Menschen. "Die Würde des Menschen verlangt daher, daß er in bewußter und freier Wahl handle, das heißt personal, von innen her bewegt und geführt und nicht unter blindem innerem Drang oder unter bloßem äußerem Zwang" (GS 17). Mit Recht wird diese Freiheit heute hoch geschätzt und leidenschaftlich erstrebt. Denn zur Würde des Menschen gehört seine freie Selbstbestimmung (Autonomie); der Mensch will und muß sein persönliches und gesellschaftliches Leben eigenverantwortlich selbst gestalten.
Diese Autonomie steht nicht im Gegensatz zur geschöpflichen Abhängigkeit des Menschen von Gott. Gott und Mensch verhalten sich nicht wie zwei Konkurrenten, wo man dem einen nimmt, was man dem anderen gibt. Die geschöpfliche Freiheit des Menschen ist vielmehr von der schöpferischen Freiheit Gottes getragen und ermächtigt. Als geschenkte Freiheit kann sie deshalb niemals absolute Freiheit sein. Wir erlangen unsere Freiheit nur dann, wenn wir uns aus der Knechtschaft unserer Leidenschaften befreien und unser Ziel in freier Wahl des Guten beharrlich verfolgen. Freiheit von innerer und äußerer Abhängigkeit ist nur durch Freiheit für das Gute möglich. Ihren höchsten Ausdruck findet sie dort, wo einzelne Christen und christliche Gemeinschaften, wie etwa Franz von Assisi und seine Ordensbrüder, ohne materielle Absicherung ganz im Vertrauen auf Gottes Fürsorge zu leben versuchen.
Auch die Lehre vom Wesen des Menschen enthält wichtige Impulse für das sittliche Handeln des Menschen:
Das Grundaxiom ist die größtmögliche Einheit und gegenseitige Durchdringung von Seele und Leib. Dies ist eine ständige Aufgabe. Der Mensch muß seine leiblichen Bedürfnisse ins Ganze seiner Person und ihrer Sinnperspektive integrieren, wie umgekehrt seinen Verstand und Willen in konkreten Taten realisieren und seiner Seele in Sport, Spiel, Kunst, Lebenskultur Ausdruck verleihen. Solche Körperkultur ist aber zu unterscheiden von Körper-, Gesundheits-, Schönheitskult. Es gilt, den Vorrang des Geistes zu wahren und sich um Weisheit, die alles auf das letzte Ziel des Menschen hinordnet, zu bemühen (vgl. 387 GS 15). Wo sich etwa die Sexualität verselbständigt und nicht mehr ins Ganze personaler Partnerschaft eingeordnet wird, wo Triebbefriedigung und Lustgewinn maßgebend werden, da kann von einer wirklichen Liebe nicht mehr die Rede sein. Sexuelle Betätigung ist vielmehr in dem Maße gut, als sie Ausdrucksgestalt der Liebe ist. Wie es eine geistfeindliche Leiblichkeit gibt, gibt es auch eine leibfeindliche Geistigkeit. Leider ist auch die Kirche, nicht in ihrer offiziellen Lehre, aber doch in ihrer pastoralen, pädagogischen und aszetischen Praxis dieser Leibfeindlichkeit nicht selten erlegen. Oft wurden die leiblichen Bedürfnisse und die Fähigkeiten des Menschen abgewertet und unterdrückt, statt daß man sie kultivierte. Innerhalb des ursprünglichen christlichen Menschenbildes ist für solche Leibesverachtung kein Platz. Wahre Seelsorge muß deshalb auch Leibsorge und konkrete Lebenshilfe sein. Sie darf sich nicht nur des Wortes, abstrakter Begriffe und moralischer Prinzipien bedienen, sondern muß Bilder, Symbolik, Lieder in ihren Dienst nehmen, um so den ganzen Menschen anzusprechen und ins Heilsgeschehen einzubeziehen.
Die Einheit von Geist und Leib zeigt sich vor allem in der Sprache, durch die wir unsere Gedanken, Absichten und unser Innerstes ausdrücken und anderen Menschen mitteilen. Die Wahrheit ist deshalb eine Wesensdimension des Menschen. In der Lüge dagegen werden die innere Einheit des Menschen und die Grundlagen eines vertrauensvollen Zusammenlebens in der menschlichen Gemeinschaft zerstört. Auch im 8. Gebot: "Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen" (Ex 20,16; vgl. Dtn 5,20) geht es also um Wesen und Würde des Menschen wie um das Zusammenleben der Menschen untereinander.
Bei seinem Bemühen um Integration stößt der Mensch freilich auch an die Grenzen seiner Freiheit. Sie ist begrenzt durch die Natur, die Freiheit des anderen, die eigene Lebensgeschichte, das gesellschaftliche Milieu. Sie verhalten sich oft widerspenstig gegenüber unserem noch so guten Willen. Wir haben unsere Freiheit nicht einfach, sie ist in vielfältiger Weise gefangen und muß erst freigemacht werden. Freiheit ist letztlich ein Geschenk. In dieser Situation werden wir erneut auf Jesus Christus verwiesen. "Wenn euch also der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei" (Joh 8,36). Das führt uns weiter zum nächsten Kapitel.
3.5 Die gnadenhafte Berufung des Menschen zur Gemeinschaft mit Gott
Wir Menschen sind merkwürdige Wesen: durch unseren Leib ganz hineingebunden in die Bedingungen und Begrenzungen dieser Welt und doch zugleich voller Träume, Sehnsüchte und Hoffnungen, die durch nichts und durch niemand in der Welt erfüllt werden können. Der Mensch ist das Wesen einer unendlichen Hoffnung. Das Herz des Menschen ist so groß und so weit, daß Gott allein groß genug ist, um es auszufüllen.
- "Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser,
- so lechzt meine Seele, Gott, nach dir.
- Meine Seele dürstet nach Gott,
- nach dem lebendigen Gott.
- Wann darf ich kommen
- und Gottes Antlitz schauen?" (Ps 42,2-3)
Erst in Jesus Christus erschließt sich uns das Geheimnis des Menschen voll. Nur wer Jesus Christus kennt, kennt auch den Menschen ganz. Er ist das Bild Gottes (vgl. 2 Kor 4,4; Kol 115-120 1,15), das uns die Gottebenbildlichkeit des Menschen erst ganz erschließt und erfüllt. So ist er als der Sohn Gottes zugleich der neue Adam, der neue Mensch (vgl. 1 Kor 15,47-49; Röm 5,14). "Christus, der neue Adam, macht eben in der Offenbarung des Geheimnisses des Vaters und seiner Liebe dem Menschen den Menschen selbst voll kund und erschließt ihm seine höchste Berufung" (GS 22). In ihm sind wir von Gott "dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben, damit dieser der Erstgeborene von vielen Brüdern sei" (Röm 8,29). Das Loblied, mit dem der Epheserbrief beginnt, faßt alles zusammen:
- "Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus: Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott; er hat uns aus Liebe im voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen, zum Lob seiner herrlichen Gnade ...Er hat beschlossen, die Fülle der Zeiten heraufzuführen, in Christus alles zu vereinen, alles, was im Himmel und auf Erden ist. Durch ihn sind wir auch als Erben vorherbestimmt und eingesetzt...Wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt, die wir schon früher auf Christus gehofft haben."(Eph 1,3-6.10-12)
Das Neue, das Jesus Christus uns schenkt, ist unserer Menschennatur nicht äußerlich aufgepfropft. Es ist vielmehr dasjenige, auf das wir als Menschen aufgrund der schöpfungsgemäßen Gottebenbildlichkeit zutiefst je schon angelegt sind, das wir aber aus eigener Kraft nicht erreichen können: die Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Sie ist in Jesus Christus, dem menschgewordenen Sohn Gottes, in einmaliger Weise verwirklicht. Durch seinen Geist werden wir als Kinder Gottes angenommen (vgl. Röm 8,14-17; Gal 4,4-6). Dadurch, daß wir durch Christus Anteil erhalten an der göttlichen Natur (vgl. 1 Petr 1,4), schenkt Gott uns unendlich viel mehr, "als wir erbitten oder uns ausdenken können" (Eph 3,20). Dabei ist, was wir jetzt schon erhalten, nur das Angeld und der Vorgeschmack (vgl. 2 Kor 1,22; Eph 1,13-14), es findet seine Vollendung erst, wenn wir Gott schauen von Angesicht zu Angesicht (vgl. 1 Kor 13,12). Denn "das ist das ewige Leben: dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast" (Joh 17,3).
Die Theologie hat später unterschieden zwischen der schöpfungsgemäßen natürlichen und der gnadenhaft geschenkten übernatürlichen Gottebenbildlichkeit des Menschen. Sie hat diese Unterscheidung ursprünglich mit dem Unterschied der Begriffe "Bild und Gleichnis" (vgl. Gen 1,26.28) begründet. Auch wenn diese Schriftauslegung vom heutigen Schriftverständnis her nicht haltbar ist, so entspricht sie doch voll der Gesamtperspektive der Heiligen Schrift. Denn für die Schrift ist die Schöpfung nur der Anfang und die Grundlage, die durch die Heilsgeschichte nicht aufgehoben, wohl aber überboten wird. Wenn die Theologie dabei vom übernatürlichen Charakter der Heilsordnung spricht, dann deshalb, weil wir aufgrund der schöpfungsmäßigen Verwiesenheit auf Gott dieses Heil, die Gemeinschaft mit Gott, zwar - bewußt oder unbewußt - ersehnen und erhoffen, aber aus den Kräften unserer Natur nicht erreichen können. Es ist weder evolutiv noch revolutionär leist- und machbar. Die personale Lebensgemeinschaft mit Gott kann uns nur von Gott aus reiner Gnade, d. h. ohne jedes Verdienst, frei und ungeschuldet, über unsere Natur hinaus geschenkt werden. Doch gerade als Geschenk ist es die alles überbietende Erfüllung des Menschen. Das Verhältnis von Natur und Gnade ist also nicht etwa nach Art von zwei aufeinandergesetzten Stockwerken oder zwei Ordnungen zu denken, die nichts miteinander zu tun haben. In beiden geht es um die Verwirklichung des einen Heilsplans in Jesus Christus.
Die Unterscheidung zwischen natürlicher und übernatürlicher Gottebenbildlichkeit begründet einen Unterschied zur reformatorischen Lehre. Diese bezieht im allgemeinen den Begriff der Gottebenbildlichkeit nur auf die gnadenhafte Gemeinschaft mit Gott, aber nicht auf die mit der Natur des Menschen gegebene Bestimmung zur Partnerschaft mit Gott. Das hat Folgen für das Verständnis der Sünde als Abbruch und Verlust der gnadenhaften Gemeinschaft mit Gott wie für die Frage der menschlichen Mitwirkung bei der Rechtfertigung und Heiligung des Sünders. Ein Ansatz zur Überwindung dieses Unterschieds ist heute darin gegeben, daß die natürliche Gottebenbildlichkeit deutlicher als Bestimmung von Jesus Christus her und auf ihn und die gnadenhafte Teilnahme an seiner Wirklichkeit hin verstanden wird.
Die Zusammengehörigkeit von Natur und Gnade kommt in dem berühmten scholastischen Grundsatz zum Ausdruck: Die in Jesus Christus geschenkte Gnade setzt die Natur voraus und bringt sie zur Erfüllung. Die Gnade setzt ja einen Adressaten voraus, der frei ist, zur Gnade ja oder nein zu sagen; insofern setzt die Gnade eine relativ in sich stehende Natur, besser: die menschliche Person und ihre Freiheit, voraus. Sie setzt diese Person aber als "etwas" voraus, das offen ist und dynamisch über sich selbst hinausweist und allein in Gott seine Erfüllung findet.
So erschließt uns Jesus Christus, warum der Mensch das Wesen ist, das sich um ein Unendliches überschreitet (B. Pascal), das immer wieder neu unterwegs ist, das nirgends stehenbleiben kann, dem sich vielmehr immer wieder neue Horizonte erschließen, das an nichts in der Welt endgültig sein Genügen finden kann, das vielmehr rast- und ruhelos ist. Er lehrt uns den Menschen verstehen als ein Wesen der unendlichen Hoffnung und Sehnsucht, aber auch der bodenlosen Angst, sich zu verfehlen. Der Mensch, schwankend zwischen Hoffnung und Angst, das ist die Signatur des Menschen nicht nur heute, sondern im Grunde zu allen Zeiten. "Denn geschaffen hast Du uns zu Dir, und ruhelos ist unser Herz, bis es seine Ruhe hat in Dir" (Augustinus).
4. Woher kommt das Böse? - Vom Sinn der Geschichte
4.1 Eine schwere Frage und viele Antworten
Alles bisher über die Größe und Schönheit der Schöpfung und über die Berufung des Menschen Gesagte scheint unrealistisch und naiv optimistisch zu sein. Wie soll man denn angesichts der Hölle von Auschwitz, von Hiroshima, des Archipel Gulag - um nur ein paar Orte des Grauens in unserem Jahrhundert zu nennen - den Gott loben, "der alles so herrlich regieret" (Gotteslob 258)? Schon die Psalmen kennen die Erfahrung, daß es den Bösen gut, den Gerechten aber schlecht geht (vgl. Ps 73,3-12). Die Frage "Warum muß der Gerechte leiden?" beschäftigt vor allem das Buch Ijob. Ijob ist nicht nur der große Dulder, der das oft zitierte Wort spricht: "Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen; gelobt sei der Name des Herrn" (Ijob 1,21). Ijob kämpft und streitet mit Gott. Er bäumt sich auf und verflucht den Tag seiner Geburt (Ijob 3,2-3). "Zum Ekel ist mein Leben mir geworden" (Ijob 10,1). Er verwirft die allzu einfachen Antworten, die seine Freunde ihm auf das Problem des ungerechten Leidens geben. Ihm geht Gott als der je größere und als der ganz andere auf, dessen Wege dem Menschen unergründlich sind und dessen Weisheit unerforschlich ist (vgl. Ijob 40,2-4; 42,2-4).
Dennoch haben sich die Menschen immer wieder bemüht, Einsicht zu gewinnen in das Auf und Ab der Geschichte. Zwei Grundmodelle der Geschichtsdeutung wurden entwickelt. Das erste Modell: die Geschichte als ein großer Kreislauf. Am Anfang steht die gute alte Zeit, das goldene Zeitalter; ihm folgen das silberne, das bronzene und das eiserne Zeitalter. Die Geschichte ist also ein großer Verfallsprozeß, aber am äußersten Tiefpunkt ereignet sich ein Umschlag. Am Ende kehrt der Anfang zurück; der Kreis hat sich geschlossen. Das zweite Modell sieht die Geschichte als eine aufsteigende Linie, als Fortschrittsgeschichte auf dem Weg zum Besseren und Höheren. Die Geschichte ist nicht die ewige Wiederkehr des Gleichen wie im Kreislaufmodell, sondern das Kommen des Neuen und einer bisher nicht dagewesenen Zukunft. Ansätze zu dieser Sicht finden sich in der Zukunftshoffnung der alttestamentlichen Propheten. In säkularisierter Gestalt begegnet uns diese Sicht im modernen Fortschrittsglauben und in der marxistischen Utopie von einem künftigen Reich der Freiheit in einer klassenlosen, herrschaftsfreien Gesellschaft.
Man wird fragen, ob diese beiden Geschichtsdeutungen der Leidenserfahrung der Menschheit wirklich gerecht werden. Denn, läßt sich das Leiden des Menschen in irgendein allgemeines Schema verrechnen? Wird man mit solchen Deutungen dem Leiden des je einzelnen gerecht?
Ihrem Grundanliegen gemäß will uns die Heilige Schrift keine innerweltliche Geschichtsdeutung geben. Die Bibel sagt uns zwar: Alles kommt von Gott, und alles kehrt zu ihm zurück. Aber der Geschichtsverlauf selbst läßt sich in kein Schema pressen, weder in ein Verfallsschema noch in ein Fortschrittsschema. Die Geschichte ist, wie Augustinus in seinem "Gottesstaat" gezeigt hat, ein ständiger Kampf zwischen zwei Reichen: dem Reich Gottes und dem Reich des Bösen (des Satans). Sie unterscheiden sich durch zweierlei Liebe: Gottesliebe und Selbstliebe. Meist ist beides miteinander vermischt. Deshalb darf man einzelne geschichtliche Ereignisse nicht vorschnell als Zeichen Gottes oder als Ausgeburt des Bösen deuten. Man muß vielmehr wissen, daß Gott ein verborgener Gott ist, der uns allein in Jesus Christus eindeutig erschienen ist. Allein von Jesus Christus her haben wir den Maßstab, um die Geschichte und das Leben zu beurteilen. "Durch Christus und in Christus also wird das Rätsel von Schmerz und Tod hell, das außerhalb seines Evangeliums uns überwältigt" (GS 22). Die volle christliche Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Leidens wird uns deshalb erst später bei der Behandlung des Kreuzes Jesu Christi voll deutlich werden.
4.2 Der Ursprung: Urstand und Paradies
Die Grundaussage biblischer Geschichtsdeutung lautet: Gott hat die Welt nicht so gewollt und nicht so gemacht, wie sie uns konkret begegnet. Er wollte und will das Leben und nicht den Tod; er verabscheut Unrecht, Gewalt und Lüge. Er will nicht, daß Menschen leiden, er will das Glück des Menschen in der Gemeinschaft mit ihm. Um diesen ursprünglichen Willen und diesen ursprünglichen Plan Gottes auszudrücken, erzählt die Bibel die Geschichte vom Paradies.
- "Dann legte Gott, der Herr, in Eden, im Osten, einen Garten an und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte ...Gott, der Herr, nahm also den Menschen und setzte ihn in den Garten von Eden, damit er ihn bebaue und hüte. Dann gebot Gott, der Herr, dem Menschen: Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen; denn sobald du davon ißt, wirst du sterben."(Gen 2,8.15-17)
Um diese Erzählung richtig zu verstehen, müssen wir wissen, daß die Heilige Schrift vom geheimnisvollen Wirken Gottes nicht so sehr in begrifflichen Aussagen als in Bildern redet. Diese sind aus dem menschlich-diesseitigen Bereich genommen und zum Teil den Mythen der damaligen Zeit entlehnt. Gott spricht ja zu uns in einer menschlichen Sprache, die die jeweiligen Menschen mit ihren Vorstellungen verstehen können. Da es sich um Bildersprache handelt, darf man sie nicht als eine Art historische Reportage über die Anfänge der Menschheitsgeschichte verstehen. Schon gar nicht darf man die - im Vergleich mit den Mythen sehr zurückhaltenden - Bilder zusätzlich phantasievoll ausmalen und sich das Paradies als eine Art Schlaraffenland vorstellen. Auf der anderen Seite kann man die mythologisch geprägte Bildersprache nicht als für uns heute bedeutungslos abtun oder sie rein geistig und rein symbolisch deuten, als ob es in ihnen um keinerlei geschichtliche Wirklichkeit ginge. Es geht ja eben um Aussagen über den geschichtlichen Ursprung des Üblen und Bösen in der Welt (ätiologische Aussagen). Gesagt werden soll: Gott hat die Welt gut geschaffen. Das Üble und das Böse in der Welt gehen nicht auf Gott zurück, sie sind erst in der Geschichte entstanden. Sie sind nicht Gottes, sondern der Menschen Schuld. So geht es in der Paradiesgeschichte um eine großangelegte Rechtfertigung Gottes (Theodizee) angesichts des konkreten Zustands der Welt.
Was die Paradiesgeschichte in Bildern ausdrückt, das hat die kirchliche Glaubensverkündigung in der Lehre vom Urstand begrifflich erläutert. In Aufnahme älterer Formulierungen stellt das Konzil von Trient (1545-1563) fest: Adam, der erste Mensch, hat durch die Übertretung des Gebotes Gottes "die Heiligkeit und Gerechtigkeit, in die er eingesetzt war", verloren (DS 1511; NR 353). Mit "Heiligkeit und Gerechtigkeit" meint das Konzil die ursprüngliche Gemeinschaft und Freundschaft des Menschen mit Gott, das Auf-du-und-du-Sein mit Gott und den vertrauten Umgang mit ihm, von dem die Paradiesgeschichte berichtet. Der Kern der Paradieserzählung wie der Urstandslehre ist also keine paläontologische (vorgeschichtliche), sondern eine theologische Aussage: Gott hat den Menschen nicht nur gut, ja sehr gut erschaffen; er hat ihn darüber hinaus teilnehmen lassen an seinem Leben.
Die gnadenhafte Erfüllung des Menschen hatte nach der Heiligen Schrift wie nach der kirchlichen Lehre Auswirkungen auf das Heilsein des ganzen Menschen. Die ursprüngliche "Heiligkeit und Gerechtigkeit" strahlte sozusagen aus auf die verschiedenen Bereiche des menschlichen Daseins. In der theologischen Fachsprache spricht man von den außernatürlichen Urstandsgaben als Folgen der übernatürlichen Urstandsgnade. Dazu gehört, daß der Mensch nicht in sich gespalten war, Leib und Seele waren ganz integriert. Der Mensch war also frei von dem, was man Begierlichkeit (Konkupiszenz) nennt, d. h. frei von der Widerspenstigkeit einzelner Schichten und Antriebskräfte des Menschen gegen die personale Grundausrichtung. Deshalb war der Mensch zweitens auch frei von der Verfinsterung und der Verwirrung seiner geistigen Kräfte. Das heißt nicht, daß er mehr Wissen gehabt hätte als wir heute, wohl aber, daß er größere und tiefere Weisheit besaß. Er konnte alles von Gott her und auf ihn hin verstehen; in ihm nagte noch nicht die Erfahrung der Sinnlosigkeit und der Absurdität des Daseins. Eins mit sich und mit Gott war der Mensch drittens auch eins mit der Welt. Er kannte kein fremd auf ihn eindringendes Leiden. Die Arbeit war nicht die Last und Plage, als die wir sie jetzt oft empfinden (vgl. Gen 3,17-18).
Der Mensch war schließlich und vor allem frei vom Tod als einer anonym über den Menschen waltenden Macht, gegen die sich der ganze Lebenswille des Menschen aufbäumt und die er als etwas Dunkles und Fremdes, als Abbruch und Einschnitt erfährt. Nach dem Apostel Paulus ist der Tod durch die Sünde in die Welt gekommen (vgl. Röm 5,12). Der Tod ist das drastischste Zeichen dafür, daß der Mensch aufgrund der Sünde von Gott, der Quelle des Lebens, entfremdet ist. Über das Wie eines Lebens ohne Tod sagen uns die Heilige Schrift und die kirchliche Glaubenslehre nichts. Spekulationen darüber sind unnütz. Denn ein solches paradiesisches Leben war zwar eine Verheißung, die Gottes ursprünglichen Plan und Willen für den Menschen offenbart. Der Mensch hat jedoch diese Verheißung bereits am Anfang ausgeschlagen und damit Gottes Plan zunächst vereitelt.
Wozu erzählt die Bibel dies alles? Nicht um unsere historische Neugier zu befriedigen. Die Aussagen über Paradies und Urstand des Menschen sind nicht um ihrer selbst willen wichtig. Sie stellen lediglich den Hintergrund dar, vor dem wir die gegenwärtige Situation der Menschheit erst richtig begreifen können: als Zustand der Entfremdung, den Gott nicht gewollt und nicht geschaffen hat. Woher also das Böse?
4.3 Ursünde und Erbsünde der Menschheit
"Durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod" (Röm 5,12). Das ist die lapidare Feststellung des Apostels Paulus. Sie faßt zusammen, was auf den ersten Seiten der Bibel in der Erzählung vom Fall des Menschen anschaulich berichtet wird:
Der Mensch läßt sich von der Schlange verführen. Gegen Gottes Gebot greift er nach dem Baum des Lebens und verfällt damit dem Schicksal des Todes. Bei dieser ersten Sünde geht es nicht um die Bagatelle, daß der Mensch nach einer verbotenen Frucht gegriffen und sie unerlaubterweise gegessen hätte. Auch deutet nichts auf eine sexuelle Verfehlung hin. Es geht um mehr! Es geht nicht um das sechste, sondern um das erste Gebot: Gott allein ist der Herr des Menschen und die Quelle seines Lebens. Der Mensch aber hat seine geschöpfliche Grenze überschritten. Er hat Gott mißtraut und wollte selbst nach dem Leben greifen; er wollte es gleichsam selbst in die Hand und in die Regie nehmen, und er hat damit den Tod gewählt. Die Sünde besteht also im Ungehorsam (vgl. Röm 5,19). Die Folgen der Entfremdung von Gott sind groß. Der Mensch wird nun seinem Mitmenschen entfremdet; Mann und Frau, die sich ursprünglich in Liebe gegenseitig Hilfe und Stütze sein sollten, werden sich zur Versuchung und zum Verderben. Der Mensch wird auch sich selbst entfremdet; er schämt sich, weil er nackt und bloß dasteht. Der Mensch wird dem Leben entfremdet; die Geburt des neuen Lebens geht unter Schmerzen vor sich. Er wird schließlich seiner Umwelt entfremdet; im Schweiß seines Angesichts muß er sein Brot essen (vgl. Gen 3,1-24).
Die Bibel erzählt nicht nur diese eine Geschichte vom Sündenfall. Die eine Geschichte löst vielmehr die ganze Lawine der weiteren Geschichte der Sünde aus, in der die soziale Dimension der Sünde zur Geltung kommt. In der Geschichte von der Ermordung Abels durch Kain überschreitet der Mensch die Grenze zum Mitmenschen. Er gönnt dem anderen nicht die Liebe und das Wohlwollen Gottes, er wird eifersüchtig, und diese Eifersucht ist für den anderen tödlich (vgl. Gen 4). Es kommt zu dem Teufelskreis von Schuld und Rache zwischen den Menschen (vgl. Gen 4,23-24). - In der stark mythisch geprägten Erzählung von der Vermählung von Menschen mit Göttersöhnen und der daraus hervorgehenden Geburt der "Helden der Vorzeit" kommt zum Ausdruck, daß der Mensch ganz allgemein das Maß des Menschlichen verliert; er überschreitet die Grenze zum Übermenschlichen, Heroischen, Heldenhaften. Die Folge ist das Hereinbrechen des Chaos in der Sündflut (vgl. Gen 6). - In der Geschichte vom Turmbau zu Babel schließlich überschreitet der Mensch seine Grenzen auch im kulturellen Bereich. Die Folge ist ein Babel, d. h. ein Wirrsal, wo keiner keinen mehr versteht, die Völker sich auseinanderleben und oft genug gegeneinanderstehen und jeder vereinzelt und zerstreut leben muß (vgl. Gen 11).
Im Neuen Testament nimmt Paulus diese Erzählung auf. Dabei setzt er den ersten Adam in Beziehung zum zweiten, neuen Adam, Jesus Christus.
- "Durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod, und auf diese Weise gelangte der Tod zu allen Menschen, weil alle sündigten ... Adam aber ist die Gestalt, die auf den Kommenden hinweist... Sind durch die Übertretung des einen die vielen dem Tod anheimgefallen, so ist erst recht die Gnade Gottes und die Gabe, die durch die Gnadentat des einen Menschen Jesus Christus bewirkt worden ist, den vielen reichlich zuteil geworden ... Ist durch die Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft gekommen, durch diesen einen, so werden erst recht alle, denen die Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit reichlich zuteil wurde, leben und herrschen durch den einen, Jesus Christus..." (Röm 5,12.14.15.17)
Dieser Text geht über die Aussagen des Alten Testaments hinaus. Erst durch Jesus Christus wird uns nämlich die Universalität und Radikalität der Sünde erschlossen; erst er deckt uns unsere wahre Situation im Heil wie im Unheil auf. So wird jetzt ausdrücklich die Universalität der Sündenmacht, welche über die Menschheit als Todesmacht herrscht, festgestellt. Doch die Erkenntnis der Universalität der Sünde ist nur die negative Formulierung der Universalität des Heils in Jesus Christus. Weil wir wissen, daß uns in Jesus Christus das Heil für alle gegeben ist, können wir erkennen, daß außerhalb von Jesus Christus Unheil ist. Die Aussage von der Sünde hat also keine eigenständige Bedeutung. Sie veranschaulicht die Universalität und die Überschwenglichkeit des Heils, das Jesus Christus gebracht hat. Die heillose und hoffnungslose Situation der Menschheit ist umgriffen von der größeren Hoffnung und der Gewißheit, daß uns in Jesus Christus überreiches Heil geschenkt ist. Ja, das Heil in Christus überbietet die ursprüngliche Berufung und Gnade. Deshalb kann die Liturgie der Osternacht sogar von einer "felix culpa", einer glückseligen Schuld sprechen.
Die dogmatische Lehre von der Ur- und Erbsünde wurde im 5. Jahrhundert geklärt. Dies geschah in der Auseinandersetzung des hl. Augustinus mit dem Pelagianismus, der behauptet hatte, jede Sünde sei nur eine einzelne, in freier Entscheidung begangene Tat und wirke nur durch schlechtes Beispiel und dessen Nachahmung. Grundsätzlich sei der Mensch frei, sich für die Sünde oder für Gott zu entscheiden. Damit war auch die Notwendigkeit der Gnade in Frage gestellt. Gegen diese Lehre richtete sich der hl. Augustinus, der "Lehrer der Gnade". In seinem Sinn entschieden verschiedene Synoden, zusammenfassend die zweite Synode von Orange (529) (vgl. DS 371-372; NR 350-351).
Diese Klärungen wurden in der Auseinandersetzung mit den Reformatoren und ihrem Sündenverständnis neu aufgegriffen. Nach den Reformatoren führt die Abkehr von Gott zur radikalen Verkehrung des Menschen. Das Wesen der Erbsünde ist die böse Lust und Neigung, d. h. die Abneigung gegen Gott, der Mangel an wahrer Gottesfurcht und wahrem Glauben (vgl. CA 2). Dadurch verliert der Mensch die ursprüngliche Gottebenbildlichkeit (vgl. Apol. 2). In Rechtfertigung und Taufe wird der Mensch zwar wiedergeboren, aber die böse Lust und Neigung bleiben bestehen. So sind die Gerechtfertigten "Sünder und Gerechte zugleich".
Demgegenüber lehrte das Konzil von Trient (1545-1563): Adam hat aufgrund der Sünde, durch die er das Gebot Gottes übertreten hat, "die Heiligkeit und Gerechtigkeit, in die er eingesetzt war", verloren. Dadurch ist er aus der Gemeinschaft mit Gott herausgefallen und der Macht des Teufels verfallen. Er wurde nicht total verkehrt, sondern "an Leib und Seele zum Schlechteren gewandelt". Diese eine Sünde, die Ursünde, wurde auf das ganze Menschengeschlecht übertragen, und zwar "durch Abstammung, nicht durch Nachahmung", so daß sie "allen innewohnt und jedem zu eigen ist". Durch das Verdienst Jesu Christi wird die Erbsünde im Sakrament der Taufe wirklich getilgt. Die Taufe ist eine wirkliche Wiedergeburt, durch die wir den alten Menschen ausziehen und den neuen, der nach Gott geschaffen ist, anziehen (vgl. Eph 4,22; Kol 3,9-10). Die nach der Taufe zurückbleibende Begierlichkeit ist nicht die Sünde selbst, sondern deren Folge. Sie stammt aus der Sünde und macht wieder zur Sünde geneigt. Es war freilich erklärtermaßen nicht die Absicht des Trienter Konzils, die Jungfrau und Gottesmutter Maria in diese allgemeine von der Erbsünde bestimmte Unheilssituation miteinzubeziehen (vgl. DS 1511-1516; NR 353-358).
Die böse Begierlichkeit (Konkupiszenz), von der die Tradition in diesem Zusammenhang spricht, darf nicht auf die sexuelle Begierlichkeit eingeschränkt werden. Es gibt auch die geistige Begierlichkeit, den Hochmut. Gemeint ist die Desintegration des Menschen, das Auseinanderstreben der verschiedenen Antriebskräfte, die Widerspenstigkeit des Leibes wie des Geistes gegen die Grundausrichtung der Person, die Geneigtheit zum Bösen.
Die Lehre des Alten und Neuen Testaments von der Universalität der Sünde, welche in der kirchlichen Überlieferung in der Lehre von der Ursünde und von der Erbsünde entfaltet wurde, begegnet vielen Mißverständnissen und bereitet heute vielen Christen keine geringen Schwierigkeiten. Eine erste Schwierigkeit besteht darin, daß heute viele Wissenschaftler annehmen, am Anfang der Menschheitsgeschichte stehe nicht nur ein einziges Menschenpaar (Monogenismus), das menschliche Leben habe sich im Prozeß der Evolution vielmehr etwa gleichzeitig an mehreren Stellen herausgebildet (Polygenismus oder gar Polyphyletismus). Das kirchliche Lehramt vertrat demgegenüber die Überzeugung, es sei nicht ersichtlich, wie die letztere Meinung mit der Lehre von der Ur- und Erbsünde vereinbar sei (vgl. DS 3897; NR 363). Die Lehre von dem einen am Anfang stehenden Menschenpaar will auch die Einheit und Gleichheit aller Menschen ausdrücken. Heute weist man freilich oft darauf hin, daß Adam im biblischen Sprachgebrauch nicht nur der Name eines einzelnen Menschen ist, sondern eine Kollektivbezeichnung für "den" Menschen und "die" Menschheit. Auch das II. Vatikanische Konzil hat in dieser Frage einen sehr zurückhaltenden Standpunkt eingenommen. Es spricht davon, daß die Menschen "in Adam" gefallen sind (vgl. LG 2), formuliert aber auch offener, indem es nur von "dem" Menschen und seiner Sünde spricht (vgl. GS 13). Der Sinn der kirchlichen Lehre ist also gewahrt, wenn festgehalten wird, daß die Menschheit, welche eine Einheit bildet, bereits an ihrem Anfang das Heilsangebot Gottes ausgeschlagen hat und daß die daraus resultierende heillose Situation eine universale Wirklichkeit ist, aus der sich keiner aus eigener Kraft befreien kann. Wird dies festgehalten, dann ist die Frage, ob Monogenismus oder Polygenismus, eine rein wissenschaftliche Frage, aber keine Frage des Glaubens.
Schwieriger und zugleich weiterführend ist ein zweiter Einwand. Seine Beantwortung ermöglicht uns eine Hinführung und einen Zugang zum Verständnis der Erbsündenlehre. Das Wort Erbsünde scheint nämlich vielen ein Widerspruch in sich zu sein. Denn das Erbe ist etwas, das man ohne eigenes Verdienst durch Abstammung übernimmt, die Sünde dagegen ist eine persönliche Tat, für die man verantwortlich ist. Das scheint in ein Dilemma zu führen: Entweder ist der sündige Zustand durch ein Erbe übernommen, dann ist er keine Sünde; oder aber er ist Sünde, dann aber ist das Wort Erbe fehl am Platz. Die Schwierigkeiten lösen sich, wenn wir das individualistische Menschenbild, das hinter dem Einwand steht, aufgeben und uns auf die Solidarität aller Menschen besinnen: Keiner fängt ja jemals ganz von vorne an, keiner beginnt gleichsam am Punkt Null. Jeder ist zuinnerst durch seine eigene Lebensgeschichte, die Geschichte seiner Familie, seines Volkes, seiner Kultur, ja der ganzen Menschheit geprägt. Dabei findet er eine Situation vor, die durch Schuld bestimmt ist. Wir werden in eine Gesellschaft hineingeboren, in der Egoismus, Vorurteile, Ungerechtigkeit, Unwahrhaftigkeit herrschen. Das prägt uns nicht nur im Sinn eines äußerlichen schlechten Beispiels, das bestimmt unsere Wirklichkeit. Denn keiner lebt für sich; alles, was wir sind, sind wir mit anderen zusammen. So wohnt die allgemeine Sündhaftigkeit allen inne; sie ist je dem zu eigen. Unsere Sünde wirkt wieder auf die anderen ein. Es gibt also ein Netz gemeinsamer Schuldverstrickung und einer allgemeinen Solidarität in der Sünde, aus der sich keiner lösen kann. Das gilt auch und gerade für die kleinen Kinder. Sie sind persönlich unschuldig; sie haben aber ihr Leben nur in Form der Teilhabe am Leben der Erwachsenen, besonders der Eltern; deshalb sind sie noch mehr als die Erwachsenen in deren Geschichte hineinverflochten.
Die allgemeine Situation der Heillosigkeit prägt und bestimmt jeden Menschen zutiefst in dem, was er ist, und in dem, was er tut. So verwirklicht sich der erbsündliche Zustand in Einzelsünden (Personsünden). In ihnen macht sich der Mensch die vorgegebene allgemeine Heillosigkeit zu eigen und sündigt sozusagen in sie hinein. Diese Verflechtung und dieses Ineinander von Personsünde und Erbsünde läßt sich nie ganz aufhellen. Da die Sünde die innere Logik der Welt und des Menschen zerstört, hat sie immer etwas Widersprüchliches an sich. Ähnlich wie Gott und wie der Mensch und wie das Verhältnis Gott und Mensch, ist auch die Zerrüttung dieses Verhältnisses ein Geheimnis.
Was ergibt sich daraus für das Verständnis der Erbsünde? Nach katholischer Lehre besteht die Erbsünde im Zustand allgemeiner Heillosigkeit des Menschen und der Menschheit. Die Herkunft des Menschen aus dem Generationszusammenhang kann seine wahre Zukunft, die Gemeinschaft mit Gott, nicht mehr vermitteln. So ermangelt der Mensch seiner wahren Erfüllung, der Heiligkeit und Gerechtigkeit, der Teilhabe am Leben Gottes. Die Folge der Entfremdung von Gott ist die Entfremdung des Menschen von der Welt, den Mitmenschen und von sich selbst, also der Verlust der paradiesischen Urstandsgaben. Der Apostel Paulus hat den inneren Zwiespalt, in den die Situation der Sünde führt, in bewegenden Worten beschrieben:
- "Denn ich begreife mein Handeln nicht: Ich tue nicht das, was ich will, sondern das, was ich hasse ... Dann aber bin nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die in mir wohnende Sünde... Das Wollen ist bei mir vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will ... Denn in meinem Innern freue ich mich am Gesetz Gottes, ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das mit dem Gesetz meiner Vernunft im Streit liegt und mich gefangenhält im Gesetz der Sünde, von dem meine Glieder beherrscht werden. Ich unglücklicher Mensch!" (Röm 7,15.17-19.22-24)
Nach dieser Darlegung der katholischen Lehre von der Ur- und Erbsünde fragen wir: Bestehen in diesen Fragen die dargestellten kirchentrennenden Lehrunterschiede fort, oder sind sie inzwischen ökumenisch aufgearbeitet? Wir können auf diese Frage erst später ausführlich eingehen, wenn vom Zentrum der Kontroverse zwischen den Reformatoren und der katholischen Kirche, von der Rechtfertigungslehre, die Rede ist. Soviel ist aber schon an dieser Stelle deutlich: Das unterschiedliche Verständnis der Ursünde und der Erbsünde sowie die Frage, ob die natürliche Gottebenbildlichkeit nach der Sünde erhalten blieb oder nicht, haben Konsequenzen für die Frage der Mitwirkung des Menschen bei der Rechtfertigung und Heiligung.
Dies ist jedoch nicht nur ein lehrhaftes Problem, sondern führt zu einer unterschiedlichen lebensmäßigen Einstellung zur Wirklichkeit. Dem Pelagianismus entspricht ein Optimismus, wie er vor allem im Zusammenhang der Aufklärung und ihres Fortschrittsglaubens wieder aufkam. Die Abgründigkeit des Bösen und die Notwendigkeit der Erlösung werden dabei leicht verkannt. Die reformatorische Lehre von der radikalen Verderbtheit des Menschen durch die Sünde und vom Verlust der natürlichen Gottebenbildlichkeit des Menschen führt dagegen oft zu einer pessimistischeren Beurteilung der menschlichen Natur und Kultur. Die katholische Lehre, nach der die menschliche Natur durch den Verlust der gnadenhaften Gemeinschaft mit Gott zwar verwundet, aber nicht total zerstört wurde, geht gewissermaßen einen realistischen Mittelweg. Sie stimmt mit der reformatorischen Lehre darin überein, daß der Mensch hinsichtlich seines Heils ohne die rettende Gnade absolut nichts vermag. Trotzdem setzt sie ein größeres Vertrauen in die natürlichen und kulturellen Möglichkeiten des Menschen. Zumindest diese unterschiedlichen lebensmäßigen Einstellungen wirken bis heute nach und bestimmen die Atmosphäre in den getrennten Kirchen und zwischen ihnen.
Die Lehre von der Universalität der Sünde hat eine vielfache praktische Bedeutung. Sie sagt: Jeder Mensch ist Sünder. "Wenn wir sagen, daß wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre, und die Wahrheit ist nicht in uns" (1 Joh 1,8). Diese Lehre zerstört die Illusionen, die wir uns selber machen und führt uns dazu, nicht länger unserer Schuld auszuweichen, sie zu bagatellisieren und immerzu nur fremde Sündenböcke zu suchen: die anderen, das Milieu, das Erbe und die Anlagen, die Strukturen und die Verhältnisse. Die Lehre von der Erbsünde sagt uns aber auch, daß wir bei der konkreten Zuweisung von persönlicher Schuld vorsichtig sein müssen und nicht vorschnell urteilen und verurteilen dürfen. Letztlich sieht nur Gott ins Herz des Menschen. Er aber will nicht verurteilen, sondern vergeben. Erst im Wissen um die Vergebung ist das Eingeständnis der Sünde möglich. So dürfen wir die Lehre von der Universalität der Sünde nicht aus dem Zusammenhang lösen, in dem sie bei Paulus steht: die Universalität des Heils in Jesus Christus. Wird sie davon isoliert, kommt es zu falscher Sündenangst, zu einer pessimistischen Betrachtung der Welt und des Lebens bis hin zu einer dualistischen Abwertung und Verachtung des menschlichen Leibes und der kulturellen Leistungen des Menschen. Der Christ ist realistisch genug, die Abgründe der Sünde zu sehen, aber er sieht sie im Licht der je größeren Hoffnung, die uns in Jesus Christus geschenkt ist. Die wichtigste Funktion der Lehre von der Erbsünde ist es, uns auf Jesus Christus als unser einziges Heil hinzuweisen.
4.4 Die Heilshoffnung der Menschheit
Die Sünde hat in der Bibel weder das erste noch das letzte Wort. Der Mensch kann durch seinen Ungehorsam und seine Gewalttat zwar den Plan Gottes durchkreuzen, Gottes Heilswille aber ist stärker als alle Macht der Sünde. Er ist von allem Anfang an wirksam. So endet die biblische Sündenfallgeschichte nicht mit einem Straf- und Fluchwort, sondern mit einer Heilsverheißung, dem Urevangelium.
Lange Zeit sah man dieses Urevangelium in dem Wort Gottes an die Schlange: "Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinen Nachwuchs und ihren Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf, und du triffst ihn an der Ferse."(Gen 3,15) Bei diesem Wort handelt es sich ursprünglich um ein Fluchwort und nicht um ein Segenswort. Es wird der Kampf zwischen den Arten, zwischen dem Menschen und der Schlange geschildert. Dabei zeigt sich, daß sich das menschliche Leben nicht endgültig unterkriegen läßt. So konnten die Kirchenväter das ursprüngliche Fluchwort als ein Verheißungswort deuten und als Hinweis auf Jesus Christus verstehen. Er ist jetzt der "Nachwuchs", welcher der Schlange den Kopf zertreten und die Menschheit vom Fluch der Sünde befreien wird. Diese Deutung hat die bildende Kunst wie die Kirchenliederdichtung nachhaltig beeinflußt: "Jakobs Stern ist aufgegangen, stillt das sehnliche Verlangen, bricht den Kopf der alten Schlangen und zerstört der Höllen Reich" (Kirchenlied "Quem pastores laudavere" ; vgl. Gotteslob 139).
Die Urverheißung des Heils hängt selbstverständlich nicht von dieser einzelnen Stelle und ihrer Auslegung ab. Alle Sündenfallgeschichten der Bibel enden mit einer Heilsverheißung. Sie alle zeigen: Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern sein Leben. Schon die Sündenfallgeschichte im Paradies zeigt, daß Gott Gnade walten läßt. Obwohl dem Menschen für den Fall seines Ungehorsams der Tod angedroht war (vgl. Gen 3,3), darf er durch Gottes Langmut weiter leben. So ist Adam ein Vorausbild des kommenden neuen Adam (vgl. Röm 5,14). Daß das Leben weitergeht und weitergegeben werden kann, drückt sich auch in dem Ehrennamen für die Frau aus. Sie ist die Eva, d. h. die Mutter aller Lebendigen (vgl. Gen 3,20). Daß Gott sich weiterhin um das Leben und Überleben der Menschen sorgt, zeigt sich auch darin, daß er ihnen Röcke aus Fellen gibt und sie gegen die Widrigkeiten der Natur schützt (vgl. Gen 3,21). So sucht Gott von Anfang an, das gestörte Verhältnis von Mensch und Welt wenn nicht zu versöhnen, so doch erträglich zu gestalten. Nach dem Brudermord Kains an Abel erklärt sich Gott ausdrücklich als Schützer des Lebens, und dieser Schutz gilt selbst noch für Kain, den ruchlosen Mörder (vgl. Gen 4,15). Schließlich stiftet Gott nach dem Chaos der Sündflut in mehrfacher Hinsicht eine neue Ordnung des Lebens: Der Bestand, die Ordnung und der Rhythmus der Natur werden garantiert (vgl. Gen 8,21). Die Natur soll den Menschen als "Lebensmittel" dienen. Das Leben des Menschen, Gottes Ebenbild, ist heilig und unverletzlich; seinem Schutz soll die menschliche Rechtsgemeinschaft dienen (vgl. Gen 9,1-7). So wird in den Ordnungen der Natur und der Kultur etwas deutlich vom Heilswillen Gottes für alle Menschen.
Auch nach dem Neuen Testament steht die Schöpfung insgesamt und die ganze Menschheit im Advent auf den kommenden Erlöser. Das Neue Testament weiß, daß der Mensch in den Ordnungen der Natur, besonders in der Stimme seines Gewissens Gott erkennen kann. Es sagt, daß alle geschöpflichen Ordnungen in Jesus Christus und auf ihn hin geschaffen wurden (vgl. Kol 1,16) und daß das Wort, das in Jesus Christus Mensch wurde, schon immer Leben und Licht des Menschen war und jeden Menschen erleuchtet (vgl. Joh 1,4.9). Gott will in dem einen und einzigen Mittler Jesus Christus das Heil aller Menschen (vgl. 1 Tim 2,4-5). Darum ist die Welt wie eine Frau, die ein Kind erwartet, guter Hoffnung. Auch noch die gefallene, der Vergänglichkeit unterworfene Schöpfung streckt hoffnungsvoll den Kopf aus, um unter Seufzen und Geburtswehen sehnsüchtig ihre Befreiung von der Knechtschaft und der Verlorenheit zu erwarten (vgl. Röm 8,18-22).
Die Universalität dieser Hoffnung zeigt auch das bekannte Adventslied im Anschluß an den Propheten Jesaja, nach dem nicht nur die Menschen aller Völker, sondern auch Himmel und Erde in diese Hoffnung einbezogen sind:
- "Taut, ihr Himmel, von oben,
- ihr Wolken, laßt Gerechtigkeit regnen!
- Die Erde tue sich auf und bringe das Heil hervor,
- sie lasse Gerechtigkeit sprießen.
- Ich, der Herr, will es vollbringen." (Jes 45,8)
Die Kirchenväter fanden in aller Wirklichkeit Spuren und Fragmente des Logos, der in Jesus Christus in seiner Fülle erschienen ist. Sie sprechen von einer großen, die ganze Menschheitsgeschichte durchziehenden Heilspädagogik Gottes und von einer Vorbereitung auf das Evangelium auch unter den Heiden. Das II. Vatikanische Konzil hat diese Überlegungen aufgegriffen und gegenüber mancherlei Verengungen in der Vergangenheit ausdrücklich vom allgemeinen Heilswillen Gottes gesprochen, der sogar den Atheisten nicht ausschließt:
- "Wer nämlich das Evangelium Christi und seine Kirche ohne Schuld nicht kennt, Gott aber aus ehrlichem Herzen sucht, seinen im Anruf des Gewissens erkannten Willen unter dem Einfluß der Gnade in der Tat zu erfüllen trachtet, kann das ewige Heil erlangen. Die göttliche Vorsehung verweigert auch denen das zum Heil Notwendige nicht, die ohne Schuld noch nicht zur ausdrücklichen Anerkennung Gottes gekommen sind, jedoch, nicht ohne die göttliche Gnade, ein rechtes Leben zu führen sich bemühen. Was sich nämlich an Gutem und Wahrem bei ihnen findet, wird von der Kirche als Vorbereitung für die Frohbotschaft und als Gabe dessen geschätzt, der jeden Menschen erleuchtet, damit er schließlich das Leben habe." (LG 16)
Aus den Aussagen der Heiligen Schrift und den kirchlichen Glaubensüberlieferungen ergibt sich:
1. Die Sünde hat die Welt und den Menschen verdorben und innerlich zerrissen; sie hat sie verstört, aber nicht einfachhin zerstört. Der Mensch ermangelt der Gemeinschaft mit Gott, auf die er zuinnerst angelegt ist, aber er bleibt auch im Zustand der Sünde Gottes Ebenbild. Auch noch in seiner tiefsten Erniedrigung bewahrt er seine Würde als Mensch. Das schließt jede rein pessimistische oder gar dualistische Weltsicht aus.
2. In den natürlichen Ordnungen wirkt von Anfang an Gottes Heilswille in Jesus Christus. Gottes Wollen ist immer ein wirksames Wollen, das vollbringt, was es will. Deshalb wirkt sich der allgemeine Heilswille Gottes in einem allgemeinen Heilsverlangen und in einer allgemeinen Heilshoffnung aus. Diese kann sich bewußt ausdrücken; dies ist etwa in den Religionen der Menschheit der Fall. Die Heilshoffnung der Menschheit kann sich auch unbewußt äußern, etwa in kulturellen und künstlerischen Gestaltungen und in gesellschaftlichen Utopien, vor allem aber im Suchen und Forschen nach der Wahrheit und im Streben nach dem Guten und nicht zuletzt im Lebens- und Überlebenswillen der Menschen.
3. Die gefallene Welt gleicht einem zerbrochenen Spiegel (Kardinal J. H. Newman). Sie strahlt noch etwas wider von Gottes Herrlichkeit, aber sie verzerrt das Bild Gottes auch bis dahin, daß es dämonische Züge annehmen kann und dem Menschen statt Hoffnung und Vertrauen Angst und Grauen einflößt. Die Religionen wie die menschliche Kultur bleiben zutiefst ambivalent. Deshalb ist die Menschheit, bewußt oder unbewußt, auf der Suche nach einem eindeutigen und endgültigen Zeichen des Heils, das die vielen anderen Zeichen reinigt und zur Erfüllung bringt. Der Christ kann sagen: "Was ihr verehrt, ohne es zu kennen, das verkünde ich euch" (Apg 17,23). Denn in Jesus Christus sind alle diese Verheißungen in Erfüllung gegangen, in ihm ist die Fülle der Zeit gekommen (vgl. Gal 4,4).
Zweiter Teil: Jesus Christus
I. Jesus Christus - Unser Herr und Gott
1. Das Bekenntnis und sein Anspruch
Das Bekenntnis "Wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus" ist schon äußerlich die Mitte des christlichen Glaubensbekenntnisses. Es ist das nach allen Seiten hin ausstrahlende und allen anderen Aussagen ihren Ort anweisende Zentrum.
Das geht schon aus dem Namen Jesus Christus hervor. Jesus (hebr. jeschua, jehoschua) war bei den Israeliten ein sehr beliebter Name und bedeutet "Jahwe ist Heil". Das griechische Wort Christus (der Gesalbte) ist die Wiedergabe der hebräischen Bezeichnung für Messias (maschiach). Ursprünglich war der Name Jesus Christus also ein Bekenntnis: Jesus ist der Christus, der von Gott gesandte und mit dem Heiligen Geist gesalbte Messias, die Erfüllung der alttestamentlichen Hoffnung; in ihm hat Gott seine Verheißung wahr gemacht und den Retter der Welt gesandt. "Denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen" (Apg 4,12).
Mit dieser Botschaft von Jesus dem Christus wird ein großer Anspruch erhoben. Schon Paulus wußte, daß die Verkündigung von Jesus Christus vielen als Torheit und als Ärgernis erscheint (vgl. 1 Kor 1,18-20). In ganz anderer Weise stellt sich uns heute die Frage: Ist dieser Anspruch überhaupt haltbar? Denn ohne Zweifel hat sich unsere Perspektive seit den Zeiten der Bibel enorm erweitert. Wir wissen heute besser Bescheid über das Alter der Menschheit vor dem Kommen Jesu Christi. Wir wissen um die vielfältigen Religionen und hohen Kulturen der vorchristlichen alten Welt. Wir kennen riesige Kulturräume Asiens, Afrikas, Amerikas und Ozeaniens, die erst sehr spät mit dem Christentum in Kontakt gekommen sind und teilweise bis heute nur wenig christianisiert sind. Wie kann man angesichts dieser unbestreitbaren Tatsachen sagen, allein in Jesus Christus sei Heil? Ist ein solcher Absolutheitsanspruch nicht entweder Anmaßung oder aber eine Naivität? Wie kann man, so fragen andere, angesichts des modernen evolutiven Weltbilds Jesus Christus zum Haupt und Zentrum des Kosmos erklären?
Das alles sind sehr ernste Fragen. Sie lassen sich freilich nicht dadurch lösen, daß man den Anspruch, den das Christusbekenntnis an uns stellt, relativiert. Denn soviel ist bereits deutlich geworden: Mit der Beantwortung dieser Fragen steht und fällt für den christlichen Glauben schlechterdings alles. Christ ist, wer an Jesus Christus glaubt, nur von ihm her und auf ihn hin lebt, wer sich in der Nachfolge Jesu und in der Freundschaft mit ihm in seinem Denken, Wollen und Tun ganz auf den Gott Jesu Christi einläßt im Dienst an den Menschen. Christ ist, wer glaubt, daß in Jesus Christus die Fülle der Zeit erschienen ist und wer von ihm her und auf ihn hin das Ganze der Wirklichkeit betrachtet. Das Christentum ist deshalb nicht zuerst eine Summe von Lehren und Geboten, Institutionen und Strukturen. Das alles ist an seiner Stelle auch von Bedeutung. Zuerst aber gilt: Christentum ist Jesus Christus und Gemeinschaft mit ihm. Um so dringlicher stellt sich die Frage: Wer ist Jesus Christus? Was können wir von ihm wissen? Was bedeutet sein einmaliger und universaler Anspruch für unser Verständnis der Welt und der Geschichte?
2. Der irdische Jesus
2.1 Was können wir von Jesus wissen?
Die weitaus wichtigste Quelle für das Leben, Wirken und den Weg Jesu ist das Neue Testament. Ausführlich berichten uns die vier Evangelien. Dabei gehören die drei ersten Evangelien, das Markus-, Matthäus- und Lukasevangelium, Synoptiker genannt, eng zusammen; das Johannesevangelium dagegen hat einen eigenen Charakter. Daneben kennen wir noch einzelne Herrenworte, die das Neue Testament nicht überliefert, die uns aber durch frühe Kirchenväter bezeugt sind. Die außerbiblischen Nachrichten über Jesus sind später, spärlich und wenig ergiebig (Flavius Josephus, Tacitus, Plinius d. J., Sueton, Talmud). Trotzdem bestreitet heute kein ernsthafter Forscher mehr, daß Jesus wirklich in Palästina gelebt hat und daß er um das Jahr 30 n. Chr. unter dem römischen Statthalter Pontius Pilatus in Jerusalem am Kreuz gestorben ist.
Ein schwieriges Problem wurde durch die moderne historische Jesusforschung aufgeworfen. Ihr schien das biblische und kirchliche Bekenntnis zu Jesus dem Christus, unserem Herrn, weithin eine spätere Übermalung des ursprünglichen, des "historischen" Jesus von Nazaret zu sein. So machte sie sich daran, das Jesusbild des kirchlichen Bekenntnisses von den "Fesseln des Dogmas" zu befreien und den "schlichten Jesus der Geschichte" wieder herauszustellen. Doch was dabei herauskam, war meist "der Herren eigener Geist". Das jeweilige Jesusbild entsprach nur zu gut dem Geschmack der jeweiligen Zeit: Jesus, der politische Messias, der Moralprediger, der Apostel der Innerlichkeit, der Armenfreund, der Hippie und der Superstar. Die Entstehung des späteren Christusbekenntnisses erklärte man entweder als absichtlichen Betrug seiner Jünger (Reimarus), als absichtslos dichtende Sage und Legende (D. F. Strauß), oder man leitete es religionsgeschichtlich aus der alttestamentlich-jüdischen Frömmigkeit, aus der zeitgenössischen hellenistischen Umwelt oder aus dem sozialen Milieu der Zeit ab. Zwischen dem "irdischen Jesus" und dem "Christus des Glaubens" entstand so eine Kluft, die nicht mehr überbrückbar zu sein schien.
Zu Beginn unseres Jahrhunderts setzte sich die Einsicht durch, daß eine zureichende Rekonstruktion des Lebens Jesu und ein genaues Bild seiner Persönlichkeit unmöglich sind. Die immer wieder neu erscheinenden oder neu aufgelegten romanhaften Darstellungen oder entsprechenden Verfilmungen des Lebens Jesu sind deshalb historisch wertlos. Die Evangelien sind nämlich keine historischen Berichte im modernen Sinn des Wortes, sie sind Glaubenszeugnisse der ersten Gemeinden und der Evangelisten. Sie sehen das irdische Wirken Jesu im Licht der tieferen Einsichten aufgrund von Karfreitag, Ostern und Pfingsten. Die sogenannte formgeschichtliche Methode hat gezeigt, daß die Evangelien ihren "Sitz im Leben" in den frühen Gemeinden, ihrer Verkündigung, Katechese, Liturgie, Apologetik, Gemeindeordnung u. a. haben. Die sogenannte redaktionsgeschichtliche Methode hat außerdem gezeigt, daß die vier Evangelisten nicht nur die Schreiber der Gemeinden waren, daß sie vielmehr die ihnen vorgegebenen mündlichen und schriftlichen Überlieferungen nach ihrer eigenen literarischen und theologischen Konzeption redigierten. Glaubenszeugnis und geschichtlicher Bericht sind also in den Evangelien engstens miteinander verbunden. Löst man Jesus aus der Glaubens-, Bekenntnis- und Lebensperspektive der Urkirche, dann löst sich alles in Aussagen auf, die über einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit nicht hinauskommen. Wir "haben" Jesus gar nicht anders als im Bekenntnis der Kirche.
Auf dem Trümmerfeld der liberalen Leben-Jesu-Forschung versuchte vor allem die Schule von R. Bultmann einen Neuansatz. Sie war am Leben und an der Persönlichkeit Jesu theologisch uninteressiert und wollte den Glauben ausschließlich auf die Verkündigung (Kerygma) des auferweckten und als gegenwärtig geglaubten Christus gründen. Alles kam ihr auf das vom Christuskerygma ausgelöste neue Selbstverständnis des Menschen an. Doch damit war verkannt, daß die Evangelien ihr Kerygma bezeugen, indem sie die Geschichte Jesu und Geschichten von Jesus erzählen. Löst man den Christusglauben von der Jesusgeschichte, dann macht man aus dem Glauben eine allgemeine Weltanschauung oder einen Mythos, der nicht mehr den konkreten Jesus Christus als Herrn bekennt. Schon die Urkirche mußte der Tendenz, das Menschliche an Jesus Christus abzuwerten, entgegentreten: "Jeder Geist, der bekennt, Jesus Christus sei im Fleisch gekommen, ist aus Gott. Und jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, ist nicht aus Gott" (1 Joh 4,2-3). Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es ja eben, an Jesus, sein Wort und sein Werk zu erinnern (vgl. Joh 14,26; 16,13).
Solche Einsichten führten seit den fünfziger Jahren zu einer Rückbesinnung und zu einer neuen Frage nach dem historischen Jesus. Man erkannte zunehmend: Zu Resignation und Skepsis hinsichtlich der Tragfähigkeit historischer Erkenntnis ist kein Anlaß. Es lassen sich geeignete Kriterien entwickeln, um Jesu "ureigene Worte, Taten und Intentionen" zu erheben. Auch wenn wir kein "Leben Jesu" im Sinn einer Biographie schreiben und kein Persönlichkeitsbild Jesu zeichnen können, auch wenn man über Einzelheiten historisch immer unterschiedlicher Meinung sein kann, so tritt uns der Jesus der Geschichte in den Evangelien doch so frisch und unverwechselbar entgegen, daß heute über die Grundzüge seiner Verkündigung und seines Wirkens unter den Forschern ein breiter Konsens besteht. Es ist wieder deutlich geworden, daß die Evangelien die Botschaft und das Wirken Jesu zuverlässig und treu überliefern. Es gibt jedoch keinen anderen Weg zu einem wirklichen Verständnis Jesu als den Weg, den die Urkirche selbst gegangen ist: Rückblick von Ostern her auf den irdischen Jesus und Darstellung seines irdischen Auftretens und Wirkens im Vorblick auf Ostern und im Licht der Auferstehung und Erhöhung.
Das II. Vatikanische Konzil hat die wichtigsten Ereignisse aus der Entwicklung der Jesusforschung aufgegriffen und bestätigt. Es hält in den Evangelien drei Schichten fest (DV 19):
1. Der irdische Jesus: "Unsere heilige Mutter, die Kirche, hat entschieden und unentwegt daran festgehalten und hält daran fest, daß die vier genannten Evangelien, deren Geschichtlichkeit sie ohne Bedenken bejaht, zuverlässig überliefern, was Jesus, der Sohn Gottes, in seinem Leben unter den Menschen zu deren ewigem Heil wirklich getan und gelehrt hat bis zu dem Tag, da er aufgenommen wurde (vgl. Apg 1,1-2)".
2. Die Apostel und die apostolische Kirche: "Die Apostel haben nach der Auffahrt des Herrn das, was er selbst gesagt und getan hatte, ihren Hörern mit jenem volleren Verständnis überliefert, das ihnen aus der Erfahrung der Verherrlichung Christi und aus dem Licht des Geistes der Wahrheit zufloß."
3. Die Evangelisten: "Die biblischen Verfasser aber haben die vier Evangelien redigiert, indem sie einiges aus dem vielen auswählten, das mündlich oder auch schon schriftlich überliefert war, indem sie anderes zu Überblicken zusammenzogen oder im Hinblick auf die Lage in den Kirchen verdeutlichten, indem sie schließlich die Form der Verkündigung beibehielten, doch immer so, daß ihre Mitteilungen über Jesus wahr und ehrlich waren."
2.2 Die Botschaft Jesu
Im Mittelpunkt des Auftretens Jesu steht seine Botschaft vom Kommen des Reiches Gottes. Der Evangelist Markus faßt diese Frohe Botschaft folgendermaßen zusammen:
- "Nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa; er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, und glaubt an das Evangelium!" (Mk 1,14-15)
Mit dieser Botschaft verkündet Jesus die Erfüllung der alttestamentlichen Hoffnung. Schon der Ruf "Der Herr ist König" (Ps 93,1; 96,10; 97,1; 99,1; vgl. Jes 52,7) sagt das endzeitliche Reich Gottes an, durch welches Israel und der Völkerwelt die Fülle des Lebens geschenkt werden soll. Nach den messianischen Texten des Alten Testaments wird dieses göttlich gewährte Heil durch den durch Gott dafür bestellten endzeitlichen Idealkönig dem Gottesvolk vermittelt. Vor allem in der religiös wie politisch bedrängten Situation der Spätzeit wird die Hoffnung auf das Kommen der königlichen Herrschaft Gottes zum zentralen Inhalt der Erwartung des Volkes von der Verwirklichung des auf Erden nie erfüllten Ideals eines gerechten Herrschers (vgl. Dan 2,44; 7,27). Dabei besteht Gerechtigkeit für die Vorstellung der Völker des alten Orients nicht primär in unparteiischer Rechtsprechung, sondern in Hilfe und Schutz für die Hilflosen, Schwachen und Armen. So muß Jesu Botschaft vom Kommen der Herrschaft Gottes verstanden werden im Horizont der Menschheitsfrage und Menschheitssehnsucht nach Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit und Leben.
Das Entscheidende an Jesu Botschaft vom Kommen der Herrschaft Gottes ist, daß die Erfüllung dieser Menschheitshoffnung nicht Tat und Leistung des Menschen, sondern ausschließlich und allein Gottes Tat und Gottes Geschenk ist. Letztlich meint das Kommen der Herrschaft Gottes das Kommen Gottes selbst. Für Jesus ist das Reich Gottes also keine innerweltliche (politische, gesellschaftliche, soziale, kulturelle) Größe, keine Zukunftsutopie und kein Reformprogramm. Es beinhaltet eine Verheißung, die weder durch Technik noch durch Ökonomie oder Wissenschaft erfüllt werden kann. Hinter dieser Botschaft steht ein Existenzverständnis, das zwar darum weiß, daß der Mensch an diese Welt gebunden und auf sie verwiesen ist, das aber ebenso weiß, daß sich darin der Sinn seines Daseins nicht erschöpft. Seine letzte Erfüllung findet der Mensch nur in der Gemeinschaft mit Gott, dem Urgrund und dem Ziel seines Lebens. Die Erfüllung dieser Hoffnung kann sich der Mensch nicht selbst geben. Deshalb können wir als Menschen das Reich Gottes nicht "bauen" und erst recht nicht mit Gewalt herbeizwingen, nicht durch moralische, soziale, wissenschaftliche, kulturelle oder politische Anstrengung. Wir können um sein Kommen nur beten: "Dein Reich komme" (Mt 6,10). So ist bei Jesus der hoffnungsvolle Ausblick in die Zukunft unlösbar verbunden mit dem Aufblick zu Gott. Deshalb gilt für den Menschen: "Zuerst das Reich Gottes!" (vgl. Mt 6,33), es gilt Gott zu geben, was Gottes ist (vgl. Mk 12,17). Im endgültigen Reich Gottes wird "Gott alles in allem" sein (vgl. 1 Kor 15,28).
Der Gott, dessen herrscherliches Kommen Jesus verkündet, ist zugleich sein Vater und unser aller Vater. Auch hier steht Jesus in der Tradition des Alten Testamentes (vgl. Hos 11,9; 14,5). Jesus wagt es aber, Gott in einer gegenüber dem Alten Testament ganz ungewohnt vertraulichen Weise als abba - Vater anzureden. Er verkündet den Gott, der Güte, Gnade, Erbarmen ist. Im Namen Gottes und an Gottes Stelle spricht er den Sündern die Vergebung ihrer Sünden zu (vgl. Mk 2,5; Lk 7,48). Das Neue Testament faßt Jesu Botschaft in dem Satz zusammen: "Gott ist Liebe" (1 Joh 4,8.16b).
Für den Menschen ist die Botschaft vom Kommen des Reiches Gottes frohe Botschaft, Heilsbotschaft. In seiner "Antrittspredigt" in seiner Heimat Nazaret nimmt Jesus die Erwartung des Alten Testaments auf:
- "Der Geist des Herrn ruht auf mir;
- denn der Herr hat mich gesalbt.
- Er hat mich gesandt,
- damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe;
- damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde
- und den Blinden das Augenlicht;
- damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze
- und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe." (Lk 4,18-19)
So soll jetzt mit dem Kommen der Herrschaft Gottes die den Menschen versklavende Herrschaft der gottfeindlichen, bösen Mächte und Gewalten abgetan werden und das Reich des Lebens, der Freiheit, des Friedens und der Liebe endgültig anbrechen. Anders als Johannes der Täufer sieht Jesus das Kommen der Herrschaft Gottes nicht primär im Zeichen des Gerichts, sondern des Erbarmens, der Freude und der Gnade. Er vergleicht das Reich Gottes mit einer Hochzeit (vgl. Mt 22,1-14) oder mit einer großen und reichen Ernte (vgl. Mk 4,26-29; Mt 9,37-38). Das sind gewiß Bilder, aber nach der Schrift können wir anders als in Bildern und und Gleichnissen vom Reich Gottes nicht sprechen. "Wir können sie nicht einfach ,übersetzen`, wir können sie eigentlich nur schützen, ihnen treu bleiben und ihrer Auflösung in die geheimnisleere Sprache unserer Begriffe und Argumentationen widerstehen, die wohl zu unseren Bedürfnissen und von unseren Plänen, nicht aber zu unserer Sehnsucht und von unseren Hoffnungen spricht" (Gern. Synode, Unsere Hoffnung I,6).
Diese Botschaft mag inmitten dieser Welt mit ihren bedrückenden Nöten wirklichkeitsfremd erscheinen. Für Jesus ist das Reich Gottes eine Realität, deren vollendete Wirklichkeit er erst für die Zukunft verheißt, die aber verborgen, klein, unansehnlich und unscheinbar schon jetzt beginnt und sich durch Gottes Macht in der Welt durchsetzen wird. In diesem Sinn beschreibt Jesus das Kommen des Reiches Gottes in den Gleichnissen vom Sämann, vom Wachsen der Saat, vom Senfkorn, vom Sauerteig u. a. (vgl. Mk 4, Mt 13). Vor allem ist das Reich Gottes dort schon jetzt Wirklichkeit, wo Gottes vergebende und versöhnende Liebe geschieht. Deshalb hat der Evangelist Lukas in der Mitte seines Evangelienbuches drei Gleichnisse von Verlorenem zusammengestellt: vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Drachme und vom verlorenen Sohn (vgl. Lk 15). Im letzten Gleichnis wird die ganze Brüchigkeit des Menschen geschildert: Er verfällt der Verführung vergänglicher Güter und verfehlt seine eigentliche Berufung. Er hat sich selbst verloren und ist, auf sich selbst gestellt, ein Verlorener. Aber jetzt, in dieser Stunde des Evangeliums verkündet Jesus: Gott erbarmt sich des Sünders und zieht ihn voll Liebe an sich. Zugleich verteidigt Jesus dieses Evangelium gegen die Herzensenge anderer Menschen, die Gottes Erbarmen nicht sehen und nicht verstehen wollen. "Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern; denn dein Bruder war tot und lebt wieder; er war verloren und ist wiedergefunden worden" (Lk 15,32). So fordert das Evangelium jeden Menschen heraus, vor Gott über sich selbst und sein Verhältnis zu den anderen Menschen nachzudenken. Es will ihm Mut und Hoffnung schenken. Weil Gott jeden Menschen annimmt, darf auch der Mensch sich selbst und alle anderen annehmen. Wo solche Liebe geschieht, da bricht die Herrschaft Gottes in verborgener Weise im Heute an.
Daß die Hoffnung auf das Kommen des Reiches Gottes sich schon jetzt hier und heute erfüllt, kommt bei Jesus vor allem dadurch zum Ausdruck, daß er diese seine Botschaft an seine Person bindet. Mit seinem Kommen ist das Reich Gottes im Kommen. Deshalb gilt:
- "Selig sind die, deren Augen sehen, was ihr seht. Ich sage euch: Viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und wollten hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört."(Lk 10,23-24).
Das Bewußtsein Jesu, in der Vollmacht Gottes zu handeln, schimmert durch nicht wenige seiner Worte durch und kommt in seinen Taten zum Ausdruck. Zweiflern an seiner Botschaft sagt er: "Hier aber ist einer, der mehr ist als Salomo ... der mehr ist als Jona" (Lk 11,31-32). In seinen Dämonenbannungen, mit denen die Macht des Bösen gebrochen wird, manifestiert sich das Kommen der Gottesherrschaft (vgl. Lk 11,20). Auch in seiner Lehre, die anders ist als die der Schriftgelehrten, erkennt das Volk seine göttliche Vollmacht (vgl. Mk 1,22.27).
Dieser Vollmachtsanspruch Jesu drückt sich auch in der geheimnisvollen Rede vom Menschensohn aus. Sie begegnet uns sehr oft bei Jesus und hat sich der Urkirche tief eingeprägt. Sie erfaßte darin den verborgenen Heils- und Richteranspruch Jesu. Der Menschensohn hat Vollmacht, auf Erden Sünden zu vergeben (vgl. Mk 2,10), er ist "Herr auch über den Sabbat" (Mk 2,27). Wer sich zu Jesus bekennt, "zu dem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen"; wer ihn vor den Menschen verleugnet, "wird auch vor den Engeln Gottes verleugnet werden" (Lk 12,8-9). Der geheimnisvoll klingende Titel stammt aus jüdischer Erwartung und bezeichnet ursprünglich die Hoheit des kommenden Heilbringers und Richters, wird aber in den Worten Jesu auch auf seine Niedrigkeit (vgl. Lk 7,34; 9,58), ja sein Leiden und Sterben (vgl. Mk 8,31; 9,31; 10,33), seine Hingabe in den Tod "für viele" (Mk 10,45) angewendet. Aber der Menschensohn wird einst auch mit "Macht und Herrlichkeit auf den Wolken kommen" (Mk 13,26; vgl. 14,62; Dan 7,13) und alle Völker richten (vgl. Mt 25,32). In der verhaltenen Rede Jesu vom Menschensohn hat die Urkirche seine verborgene Vollmacht auf Erden, seinen von Gott bestimmten Weg über das Kreuz zur Auferstehung und sein künftiges Erscheinen in göttlicher Herrlichkeit erkannt. Dies ist auch der Weg des Reiches Gottes: von verborgener Gegenwart im irdischen Wirken Jesu über die Zeit des Wachsens, in der die Menschen geprüft werden, zur Vollendung am Ende der Weltzeit.
Wo Gottes Herrschaft, Gottes Erbarmen und Gottes Liebe offenbar werden, da ist der Mensch aufgerufen, in allem ganz den Willen Gottes zu tun (vgl. Mt 7,21). Jesus verkündet den Willen des Vaters "mit Vollmacht". Bei aller Radikalität seiner Botschaft ist diese aber durch eine eigentümliche Freiheit in der Auslegung des Gesetzes charakterisiert. Jesus stößt durch die Fülle von Einzelbestimmungen immer wieder zum ursprünglichen Willen Gottes durch. Der Mensch soll sich nicht hinter der korrekten Erfüllung des Gesetzes verschanzen; er soll seinen Blick auf den Menschen richten, der seiner Hilfe bedarf. Neben die Seligpreisungen der Armen und Unterdrückten (vgl. Mt 5,3-12; Lk 6,20-26) treten die Warnungen an die Reichen (vgl. Mt 6,24; Mk 10,23.25; Lk 16,19-31) und die Anklage der Mächtigen, die ihre Macht mißbrauchen (vgl. Mk 10,42). Den Einflußreichen und Herrschenden in seinem Volk hält er entgegen: "Zöllner und Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als ihr" (Mt 21,31).
Von grundlegender Bedeutung sind die Seligpreisungen der Bergpredigt. Das Lukasevangelium berichtet vier Seligpreisungen: "Selig, ihr Armen", "selig, die ihr jetzt hungert", "selig, die ihr jetzt weint", "selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen... um des Menschensohnes willen" (Lk 6,20-22). Diese Umkehr aller irdischen Wertmaßstäbe ist gerade bei Lukas durchaus realistisch gemeint. Dennoch geht es nicht um eine irdische Umwälzung, um ein soziales oder politisches Programm. Die Seligpreisungen der Bergpredigt stehen vielmehr im Gesamtzusammenhang der Verkündigung Jesu von der herangekommenen Herrschaft Gottes. Das Matthäusevangelium hat die Seligpreisungen aus dem Geist der Botschaft Jesu "vergeistigt" und erweitert. Es spricht von denen, "die arm sind vor Gott", und es preist die selig, "die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit". Es fügt hinzu die Seligpreisungen der Gewaltlosen, Barmherzigen, Herzensreinen und Friedensstifter (vgl. Mt 5,5-10). Mit alledem sind die gemeint, die von der Welt nichts zu erwarten haben, aber alles von Gott erwarten, die sich also auf die Botschaft von der Herrschaft Gottes und seine Barmherzigkeit und Liebe einlassen und aus ihr leben. Diese schon im Alten Testament bezeugte Armut und dieser Dienst am Frieden aus dem Geist des Evangeliums, die hier von den Jüngern Jesu gefordert werden, sind nicht ein neues Gesetz, welches man ohne weiteres auf die ganze Gesellschaft übertragen kann. Die Seligpreisungen der Bergpredigt appellieren vielmehr an das Herz des Menschen, sich von Gottes Erbarmen und Liebe ergreifen zu lassen. Damit setzen sie indirekt auch Maßstäbe für das innerweltliche Verhalten. Ihre konkrete Anwendung im Bereich der Gesellschaft und der Politik ist freilich nicht ohne menschlichen Sachverstand möglich.
Jesus faßt seine sittliche Forderung zusammen in dem Doppelgebot der Gottes- und der Nächstenliebe. Dabei bindet er zwei Einzelgebote des Alten Testaments zusammen (vgl. Dtn 6,5; Lev 19,18.34).
- "Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben
- mit ganzem Herzen und ganzer Seele,
- mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft.
- Als zweites kommt hinzu:
- Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
- Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden." (Mk 12,30-31)
Diese und andere Worte Jesu, die unmittelbar auf eine Veränderung des menschlichen Verhaltens, indirekt aber auch der gesellschaftlichen Verhältnisse hindrängen, finden ihre letzte Zuspitzung in der Forderung der Feindesliebe (Lk 6,27-36). Sie hat ihre tiefste Begründung in dem Wort: "Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist!" (Lk 6,36). Die Radikalität der Forderungen Jesu erklärt sich also aus der Botschaft von der jetzt anbrechenden Gottesherrschaft und der darin erfahrenen Liebe Gottes, die zu gleicher Liebe bis zum Äußersten gegenüber den Mitmenschen verpflichtet. Mit dieser sittlichen Botschaft hat Jesus keine unmittelbaren Handlungsanweisungen gegeben, aber Maßstäbe gesetzt, die für die Begegnung der Menschen und das Zusammenleben der Völker unübersehbare Signale setzen. "Denn die Verheißungen des Reiches Gottes sind nicht gleichgültig gegen das Grauen und den Terror irdischer Ungerechtigkeit und Unfreiheit, die das Antlitz des Menschen zerstören" (Gern. Synode, Unsere Hoffnung I,6). Die Hoffnung auf das Reich Gottes macht nicht indifferent, sondern vielmehr sensibel für die Fragen des Friedens, der Gerechtigkeit und der Freiheit in der Welt.
Jesus fordert nichts, was er nicht selbst vorlebt. Er geht den Weg voran. Sein eigenes Verhalten ist gekennzeichnet durch Liebe, Barmherzigkeit, Treue, Friedfertigkeit, Vergebungsbereitschaft. Er ist "nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen" (Mk 10,45). So gehört zur Botschaft Jesu der Ruf in die Nachfolge:
- "Kommt her, folgt mir nach!" (Mk 1,17)
- "Wer mein Jünger sein will,
- der verleugne sich selbst,
- nehme sein Kreuz auf sich
- und folge mir nach.
- Denn wer sein Leben retten will,
- wird es verlieren;
- wer aber sein Leben um meinetwillen
- und um des Evangeliums willen verliert,
- wird es retten." (Mk 8,34-35)
Dieser Ruf mit allem, was er umschließt und bedeutet, was er fordert und verheißt, gehört zum Eigentümlichsten, was uns vom irdischen Jesus überliefert ist. Dieser Ruf erging zunächst an einzelne, die auch seine Begleiter und Boten während seines irdischen Wirkens sein sollten. Die Urkirche nach Ostern hat diesen Ruf auf alle an Jesus Christus Glaubenden bezogen. Alle sollen zu Jüngern Jesu werden und ihm je nach ihrer besonderen Veranlagung und Berufung, nach ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten, aber mit der gleichen Entschlossenheit und Radikalität folgen. Solche "Übertragung" der Worte Jesu auf das Leben der späteren Gläubigen und Gemeinden ist für die Urkirche keine Verfälschung der Absichten Jesu, vielmehr lebendige Aufnahme seiner nie verhallenden Stimme.
2.3 Das Verhalten und die Taten Jesu
Jesus wirkte nicht nur durch Worte, sondern auch durch sein Aufsehen, Staunen und Widerspruch hervorrufendes Verhalten. Zu den ursprünglichsten Gegebenheiten der Jesusüberlieferung gehören seine Tischgemeinschaft mit Zöllnern, der Zuspruch der Vergebung für Dirnen und andere öffentliche Sünder (vgl. Mk 2,13-17; Mt 11,19), die Verletzung von Sabbats-und Reinheitsvorschriften (vgl. Mk 2,23 -3,6; 7,1-23), die Tempelreinigung (vgl. Mk 11,15-19). Es handelt sich wie auch bei der Aufstellung des Zwölferkreises (vgl. Mk 6,7-13) um Zeichenhandlungen, die seine Botschaft und Intention verdeutlichen und zugleich seine persönliche Art enthüllen. Diese Art, durch Gesten und Zeichen, die dann durch Worte gedeutet werden, den Menschen nahezubringen, was die Herrschaft Gottes bedeutet und fordert, erinnert an die alttestamentlichen Propheten mit ihren Symbolhandlungen. In diesem Zusammenhang ist auch die Feier des Letzten Mahles zu verstehen, das Jesus vor seinem Tod mit seinen Jüngern gehalten hat und das den "Neuen Bund" Gottes anzeigt (vgl. Mk 14,17-25). Jesu ganzes Leben und Wirken macht die verborgene Wirklichkeit Gottes, seine machtvolle, heilschaffende Gegenwart und seinen Anruf an die Menschen offenbar. Deshalb kann Jesus im vierten Evangelium sagen: "Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen" (Joh 14,9).
Von besonderer Bedeutung sind die außergewöhnlichen Taten Jesu, die wir Wunder nennen. In ihnen erfüllte sich etwas von der Verheißung der Propheten:
- "Blinde sehen wieder, Lahme gehen,
- und Aussätzige werden rein;
- Taube hören, Tote stehen auf,
- und den Armen wird das Evangelium verkündet."
- (Lk 7,22; vgl. Jes 35,5-6 u. a.)
Diese Wunderberichte der Evangelien sind für uns heute mit vielen Problemen behaftet. Freilich ist der uns geläufige Wunderbegriff, der am naturwissenschaftlichen Denken der Zeit orientiert ist und nach der Möglichkeit einer Durchbrechung der Naturgesetze fragt, der Bibel fremd. Ihr geht es um den Glauben an Gott, den Schöpfer der Welt und den Herrn der Geschichte, der in allen seinen Werken "wunderbar" ist, aber auch in außergewöhnlichen Taten seine Macht offenbaren kann. Über das Wie solchen Geschehens, besonders über das Verhältnis zu den natürlichen Ursachen und Kräften, die Gott benutzen kann, macht sich die Bibel noch keine Gedanken, so daß ihre Darstellung auf uns unreflektiert und naiv wirkt. Hinzu kommen historische Probleme. Die biblischen Wunderberichte sind nämlich nach bestimmten Erzählmustern entworfen, die in der damaligen Zeit üblich waren. So liegen über jenen Darstellungen für uns mehrere Decken, die uns das Verständnis erschweren: ein uns fremd gewordenes Denken, das ein anderes Verhältnis zur Natur hatte und eine andere Auffassung von "geschichtlichen" Berichten, eine andere Darstellungsweise, die mehr das Typische als das Konkrete der Vorgänge herausstellt.
Trotz dieser Schwierigkeiten wagt auch streng historische Kritik nicht zu bezweifeln, daß durch Jesus außerordentliche, unerklärliche Ereignisse, besonders Heilungen, geschehen sind. Die Heilungsberichte enthalten nicht selten genaue Angaben über die beteiligten Personen, mit Namen und Umständen. Der Zulauf der Menschen, der Ruf, der sich von Jesus verbreitet, die Hilflosigkeit der Gegner, die seine Taten nicht abstreiten können, die schon früh nach Ostern einsetzende Überlieferung der Wunderberichte zu einer Zeit, in der die Augen- und Ohrenzeugen des Auftretens Jesu noch lebten: das alles läßt sich anders nicht begreifen. Die moderne Naturwissenschaft beschränkt sich bei ihrer Wirklichkeitsbetrachtung bewußt auf die innerweltlichen Faktoren; sie sieht von der Frage nach Gott bewußt ab. Das ist von den methodischen Voraussetzungen der Naturwissenschaften her durchaus berechtigt. Aber die Betrachtung der Welt unter dem Gesichtspunkt von Naturgesetzen ist nur eine, nicht die einzige Weise, die Wirklichkeit zu verstehen. Der Glaube kann sich mit einer solchen Betrachtungsweise, würde sie verabsolutiert, nicht zufriedengeben. Der Glaube an den lebendigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, würde seinen Inhalt verlieren, würde er nicht mehr mit der Möglichkeit und Wirklichkeit rechnen, daß Gott auch in außergewöhnlicher Weise in Zeit und Geschichte hineinwirkt. Ein solcher Glaube wäre ein hölzernes Eisen.
Die Wundertaten Jesu waren keine spektakulären Schauwunder; "Zeichen vom Himmel" hat Jesus stets abgelehnt (vgl. Mk 8,11-13; Lk 11,29; Joh 6,30). Die Wunder sollen zum Nachdenken bringen und zum Glauben hinführen. Andererseits vermögen nur gläubige Augen und Ohren zu erfassen, was im Wirken Jesu geschieht (vgl. Mt 11,4-6; Lk 10,23-24). So sind seine Wunder Zeichentaten, die Gottes Heils- und Rettungswillen verdeutlichen und Anzeichen der hereinbrechenden Gottesherrschaft sein sollen. "Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist doch das Reich Gottes schon zu euch gekommen" (Lk 11,20, vgl. Mt 12,28). Die Totenerweckungen sollen die lebenweckende Macht Gottes, die für damalige Menschen auch schon bei Krankenheilungen wirksam war, in höchster Steigerung zeigen. Die Stillung des Sturms auf dem See Gennesaret (vgl. Mk 4,35-41) ist ein Rettungswunder, das die in Jesus gegenwärtige Macht göttlichen Beistands veranschaulicht. Die große Speisung, mit vielerlei Motiven angereichert, ist im Kern ein Spendewunder, das Gottes reiche Güte, das Austeilen seiner Gaben, wie einst beim Wüstenzug Israels, so auch jetzt durch seinen Messias, die Mahlgemeinschaft Jesu mit Jüngern und Volk vor Augen führt (vgl. Mk 6,34-44; 8,1-10). Darin soll deutlich werden, daß Gott Sieger über Krankheit und Leid, über den Tod und das Böse ist. In alledem soll auch die Vollmacht Jesu und seine im irdischen Leben noch verborgene Herrlichkeit aufleuchten. Es soll deutlich werden, daß in Jesus "die Güte und Menschenliebe Gottes" erschienen ist (Tit 3,4).
3. Jesus Christus - der Mensch gewordene Sohn Gottes
3.1 Jesus Christus - unser Bruder
Die kraftvolle, ansprechende und in vielem so neue Verkündigung Jesu und sein Aufsehen erregendes Auftreten, vor allem seine Wundertaten, führten schon damals und führen bis heute zu der Frage: Wer ist dieser? Viele Antworten wurden gegeben: der wiederauferstandene Johannes der Täufer, der wiedergekommene Elija, einer von den Propheten (vgl. Mk 6,14-15; 8,28). Wie wir gesehen haben, ist die Liste der Antwortversuche inzwischen noch viel länger geworden. Entscheidend ist freilich nicht, was die Leute über Jesus sagen; Jesus fragt seine Jünger, jeden von uns: "Ihr aber, für wen haltet ihr mich?" (Mk 8,29).
Sicherlich werden wir zuerst sagen müssen: Jesus ist ein Mensch, ein wirklicher Mensch wie wir alle. Die Evangelien beschreiben ihn in seiner ganzen Menschlichkeit: Er wird von einer menschlichen Mutter geboren, wächst und reift heran, erlernt ein Handwerk, hat Hunger und Durst, wird versucht, wird müde, stellt Fragen, empfindet Mitleid, er freut sich an anderen Menschen, besonders an den Kindern, er wird aber auch zornig über die Hartherzigkeit der Menschen, er hat Angst und leidet Schmerzen und stirbt schließlich am Kreuz. Er ist ein Mensch mit Leib und Seele. Er hat die Höhen und Tiefen des Menschseins durchlebt und durchlitten. Er ist unser Bruder (vgl. Joh 20,17; Röm 8,29; Hebr 2,11). Der Hebräerbrief faßt das Zeugnis der Evangelien zusammen:
- "Wir haben ja nicht einen Hohenpriester, der nicht mitfühlen könnte mit unserer Schwäche, sondern einen, der in allem wie wir in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat." (Hehr 4,15)
Er war uns also als Mensch in allem gleich, die Sünde allein ausgenommen. Im Unterschied zu allen anderen Menschen stand er nicht unter dem Gesetz der Sünde. Er war vielmehr ganz offen für den Willen des Vaters und für den Dienst an den Menschen. Er sagt von sich, er sei "nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen" (Mk 10,45). Er ist der Mensch für die anderen Menschen, der am Ende im Gehorsam gegen den Vater sein Leben "für viele", d. h. für alle dahingibt (Mk 10,45). Dieses Gesetz der Stellvertretung, welches das ganze Leben Jesu und erst recht sein Sterben bestimmte, bringt er selbst beim Letzten Abendmahl zum Ausdruck: Mein Leib für euch - mein Blut für euch (vgl. 1 Kor 11,24-25; Lk 22,19-20). In diesem Für-euch, Für-uns und Für-alle ist Jesus Christus in leibhaftiger menschlicher Gestalt die Erscheinung der Güte und Menschenliebe Gottes (vgl. Tit 3,4).
Die wahre Menschheit Jesu ist dem Glauben des Neuen Testaments und der Kirche ebenso wichtig wie der Glaube an die wahre Gottheit Christi. Der Glaube an Jesus als eine Art Gott-Wesen wäre für die Zeit des Neuen Testaments gar nicht unbedingt etwas Besonderes und Außerordentliches gewesen. Aber der Glaube an den Sohn Gottes, der wie ein Verbrecher am Kreuz stirbt, war "für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit" (1 Kor 1,23). Für den 1. und 2. Johannesbrief fällt die Entscheidung mit dem Bekenntnis, "daß Jesus Christus im Fleisch gekommen ist". Wer sich dazu nicht bekennt, der ist der Antichrist (2 Joh 7; vgl. 1 Joh 4,3). Schon früh traten nämlich Irrlehren auf, die behaupteten, Jesus habe nur einen Scheinleib gehabt und er habe nur zum Schein gelitten. Dagegen schrieb der Märtyrer-Bischof Ignatius von Antiochien bereits um das Jahr 110 in seinem Brief an die Gemeinde von Smyrna: Wenn Jesus nur zum Schein gelebt und gelitten hat, dann sind wir auch nur zum Schein erlöst. Dann würde sich alles am Christentum in eine Scheinwirklichkeit auflösen.
Daß Jesus, der Sohn Gottes, zugleich wahrer und ganzer Mensch ist, stellt also nicht nur eine Tatsachenwahrheit, sondern eine Heilswahrheit dar. Denn nur wenn Gott leibhaftig in unser menschliches Fleisch und Blut eingegangen ist, hat er uns auch in unserer Menschlichkeit erlöst. Dann hat er in Jesus Christus unser ganzes Menschsein zusammengefaßt (Irenäus von Lyon), dann gibt es seither keine menschliche Dimension mehr, die grundsätzlich gottlos und gottfern wäre. Dann hat Gott in Jesus Christus alles Menschliche angenommen und geheiligt. Heil und Erlösung sind dann nie nur innerliches Seelenheil, sondern zielen auf das Heil- und Ganzsein des Menschen. Zur Menschlichkeit des Heils gehört ebenso, daß es uns von Jesus Christus auf eine menschliche Weise geschenkt wird. Jesu Menschheit ist für Gott nicht eine Verkleidung oder ein totes Instrument, schon gar nicht eine Art Marionette in der Hand Gottes. Er wirkt das Heil durch seinen menschlichen Gehorsam und Dienst. Durch seinen Gehorsam macht er den Ungehorsam Adams wieder gut. Nur wenn Jesus Christus nicht nur wahrer Gott, sondern auch wahrer Mensch ist, kann er uns erlösen (Anselm von Canterbury).
3.2 Jesus Christus - unser Herr
An Jesu Menschlichkeit wird auch das Mehr-als-Menschliche deutlich. Es kommt vor allem, wie bereits ausführlich gezeigt wurde, darin zum Ausdruck, daß Jesus ein ganz einmaliges und unübertragbares inniges Verhältnis zu Gott, seinem Vater, hat. Deshalb beansprucht er mit einer sonst unerhörten Vollmacht, das Wort Gottes zu sagen und an der Stelle Gottes zu handeln. Im Ruf zur Nachfolge verlangt er von seinen Jüngern unbedingte Gefolgschaft. Durch die Auferweckung und die Erhöhung Jesu hat Gott diesen Anspruch bestätigt und Jesus zum Herrn (Kyrios) eingesetzt.
Das Bekenntnis zu Jesus Christus als dem Herrn gehört zum ältesten Bestand der biblischen Überlieferung und der christlichen Bekenntnisbildung. Paulus fand dieses Bekenntnis, wie das Christuslied im Philipperbrief zeigt, bereits in den christlichen Gemeinden vor, als er sich zu Christus bekehrte. Dort heißt es: "Jesus Christus ist der Herr" (Phil 2,11; vgl. 1 Kor 12,3). Im Römerbrief zitiert er ein ähnliches Bekenntnis der frühen christlichen Gemeinden:
- "Denn wenn du mit deinem Mund bekennst: ,Jesus ist der Herr` und in deinem Herzen glaubst: Gott hat ihn von den Toten auferweckt`, so wirst du gerettet werden." (Röm 10,9)
Vermutlich handelt es sich bei diesem Bekenntnis um eine gottesdienstliche Formel. Schon im ältesten palästinischen Gemeindegottesdienst riefen die zur Eucharistiefeier versammelten Christen "Marána tha" (1 Kor 16,22; vgl. Offb 22,20; Did 10,6). Dieser Ruf kann übersetzt werden: "Unser Herr ist gekommen" oder: "Unser Herr, komm!", und dies dürfte der ursprüngliche Sinn sein. Bis heute spielt das Bekenntnis zu "unserem Herrn Jesus Christus" in der Liturgie eine zentrale Rolle. Wir brauchen dabei nur an den Ruf "Kyrie eleison", "Herr, erbarme dich" zu denken. Alle liturgischen Gebete schließen mit der Formel "durch Christus, unseren Herrn". Das Neue Testament nennt die Eucharistie insgesamt das "Herrenmahl" (vgl. 1 Kor 11,20) und den Tag, an dem wir uns dazu versammeln, den "Herrentag" (vgl. Offb 1,10).
Mit dem Bekenntnis "Ich glaube an den einen Herrn Jesus Christus" stehen wir also bei den Anfängen unseres christlichen Glaubens wie in seiner innersten Mitte. Um so dringlicher ist die Frage: Was meint dieses Bekenntnis? Wie können wir es heute verstehen?
Wenn wir heute jemanden als Herrn anreden, verbinden wir damit keinen tieferen Sinn. "Herr" ist für uns eine geläufige Höflichkeitsform, die jedem erwachsenen oder auch schon heranwachsenden Mann zusteht und deshalb nichts Besonderes und Auszeichnendes beinhaltet. Anders in früheren Zeiten! Die Herren waren die Freien, die Adeligen und die Höhergestellten, die Maßgebenden, die sich von den Sklaven und den Knechten wie vom gemeinen Mann und vom gewöhnlichen Volk unterschieden. Unserem modernen demokratischen Empfinden ist solches Herrschaftsdenken und -gebaren verpönt. Selbst wenn es im gesellschaftlichen Leben auch heute noch vielerlei Unterordnungen gibt, gelten doch vor dem Gesetz alle grundsätzlich als gleich. Wo man, wie im Sozialismus, von der Vorstellung einer grundsätzlich herrschaftsfreien Gesellschaft ausgeht, ersetzt man deshalb die Anrede "Herr" durch "Genosse". Das Christentum spricht von der Brüderlichkeit aller Menschen. Diese wenigen Beobachtungen zeigen, daß das Bekenntnis zu Jesus Christus als dem Herrn alles andere als eine nichtssagende Floskel darstellt. Hier wird ein Anspruch formuliert, der eine Antwort verlangt. Es geht im Bekenntnis zu Jesus Christus als dem Herrn um die Frage nach dem Maßstab und der Orientierung in unserem Leben.
Im Alten Testament ist "Herr" eine Würdebezeichnung, die allein Gott gebührt. Der neutestamentliche Titel "Herr" ist die Übersetzung des alttestamentlichen Gottesnamens Jahwe. Wenn nun die frühe Kirche diesen Titel für Jesus Christus in Anspruch nimmt, sagt sie damit: In Jesus Christus bricht Gottes Herrschaft an, in ihm tritt Gott selbst auf den Plan, ja, er ist selbst göttlichen Wesens. Das Bekenntnis zu Jesus Christus, dem Herrn, bedeutet deshalb: Jesus Christus ist die Erfüllung der alttestamentlichen Hoffnung, ja, in ihm ist, was Grund und Ziel aller Wirklichkeit ist, in Raum und Zeit greifbar und sichtbar geworden. Damit hat die rast- und ruhelose, immer wieder verrinnende Zeit ihre Fülle erreicht; es ist das erschienen, worauf der Mensch und mit ihm die Welt zutiefst angelegt ist: Gott selbst und die Gemeinschaft mit ihm. Wer also wissen will, wer Gott ist und was der Mensch ist, der muß auf Jesus Christus schauen und an ihm Maß nehmen. Er muß ihn als seinen Herrn bekennen; er muß ihm nachfolgen, um so Leben und Heil zu erlangen.
In der Antike war "Herr" außerdem der Titel und die Ehrenbezeichnung, die dem römischen Kaiser als dem Herrscher der Welt zustand. Der Titel drückte aus, daß der Kaiser göttlicher Art war, daß er über die Menschen und Völker herrschte, um Leben, Ordnung und Frieden zu garantieren. Wenn das frühe Christentum diesen Titel für Jesus Christus in Anspruch nimmt, sagt es: Nicht der Kaiser, sondern Jesus Christus garantiert Leben, Ordnung und Frieden. Er ist der wahre Weltbeherrscher. Wegen dieses Bekenntnisses kamen die ersten Christen in Konflikt mit dem römischen Staat und dem Kaiserkult der damaligen Zeit. In den Christenverfolgungen der ersten Jahrhunderte mit ihren zahlreichen Märtyrern wurde der Ernst des Bekenntnisses zu Jesus Christus, unserem Herrn, deutlich. Auch für uns heute hat dieses Bekenntnis eine kritisch-befreiende Bedeutung gegenüber allen, die sich als Heilbringer und Menschheitsbeglücker aufspielen und dafür Macht und Ansehen beanspruchen. Das Bekenntnis zum einen Herrn ist also der Grund der christlichen Freiheit von den vielen Herren. Es ist darum nicht nur ein Anspruch, sondern noch mehr ein Zuspruch, eine Heilsbotschaft.
3.3 Jesus Christus - Sohn Gottes im Fleisch
Das Bekenntnis zu Jesus Christus, unserem Herrn, leitet von selbst über zur wichtigsten Bekenntnisformel: Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Davon war bereits ausführlich die Rede. Jetzt muß noch davon gesprochen werden, daß Jesus, der ewige Sohn Gottes, in der Zeit Mensch geworden ist. Dieses Bekenntnis findet sich schon in einem der ältesten Texte des Neuen Testaments, in dem Christuslied des Philipperbriefes:
- "Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen, er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz." (Phil 2,6-8)
Das Johannesevangelium sagt in seinem Prolog dasselbe:
- "Und das Wort ist Fleisch geworden
und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater." (Joh 1,14)
Das Glaubensbekenntnis der Kirche faßt dieses Zeugnis der Heiligen Schrift zusammen:
- "Für uns Menschen und zu unserem Heil
- ist er vom Himmel gekommen,
- hat Fleisch angenommen...
- und ist Mensch geworden."
Die Aussagen der Heiligen Schrift und des Glaubensbekenntnisses der Kirche wurden in der kirchlichen Lehrüberlieferung weiterentfaltet zu der Glaubenslehre von Jesus Christus als wahrem Gott und wahrem Mensch. Diese grundlegende Wahrheit unseres Heils wurde vom vierten allgemeinen Konzil, dem Konzil von Chalkedon (451), zusammenfassend formuliert. Zuvor hatte das Konzil von Ephesus (431) gegen die Irrlehre der Nestorianer die Einheit von Gottheit und Menschheit in Jesus Christus gelehrt. Die neuerliche Klärung war notwendig geworden, weil der Mönch Eutyches und seine Anhänger die Einheit einseitig und falsch verstanden und dabei den bleibenden Unterschied der beiden Naturen leugneten. Sie behaupteten nämlich, die Menschheit Jesu gehe in seiner Gottheit auf wie ein Tropfen Honig im Meer. Sie sprachen deshalb nur von einer Natur in Jesus Christus. Dagegen wandte sich vor allem Papst Leo d. Gr. Als sein Schreiben an den Patriarchen Flavian von Konstantinopel auf dem Konzil von Chalkedon verlesen wurde, riefen die Konzilsväter: "Das ist der Glaube der Väter, das ist der Glaube der Apostel! ... Petrus hat durch Leo gesprochen." Das Konzil selbst formulierte den Glauben an Jesus Christus so:
- "Der eine und selbe ist vollkommen der Gottheit und vollkommen der Menschheit nach, wahrer Gott und wahrer Mensch..., wesensgleich auch uns seiner Menschheit nach... Wir bekennen einen und denselben Christus, ... der in zwei Naturen unvermischt, unverwandelt, ungetrennt und ungesondert besteht."
(DS 301-302; NR 178)
Das fünfte allgemeine Konzil, das zweite Konzil von Konstantinopel (553), prägte schließlich die Formel von der einen göttlichen Person in zwei Naturen (vgl. DS 424-425, NR 183-184). Das dritte Konzil von Konstantinopel (680-681) machte deutlich, daß diese Einheit von Gott und Mensch in Jesus Christus dem Menschsein Jesu nichts wegnimmt, es nicht verletzt, verringert oder verkürzt; die Aufnahme des menschlichen Wollens in den Willen Gottes hebt die menschliche Freiheit nicht auf, sondern entbindet und vollendet sie (vgl. DS 556; NR 220). Der hl. Maximos Confessor, der bedeutendste Theologe des 7. Jahrhunderts, dem für sein mutiges Bekenntnis des rechten Glaubens Zunge und Hand abgeschnitten wurden, hat den tiefen Sinn dieser Lehre am besten erfaßt: Je größer die Einheit von Gott und Mensch, um so mehr wird auch der Unterschied beider gewahrt.
Das sind keine rein theoretischen Formeln, sie haben vielmehr eine tiefe Bedeutung für unser Heil. Sie wollen festhalten, daß Gottes Sohn "für uns Menschen und zu unserem Heil" Mensch geworden ist. Sie sagen nämlich, daß die Einheit mit Gott, auch die höchstmögliche und völlig einzigartige Einheit in Jesus Christus dem Menschen nichts wegnimmt und nichts Menschliches unterdrückt und vergewaltigt, sondern vielmehr das Menschliche freisetzt: unvermischt und unverwandelt. Zugleich bedeutet das Heil innigste Gemeinschaft von Gott und Mensch, wechselseitige Durchdringung, ja einen wechselseitigen "wunderbaren Austausch": Gott wird Mensch, damit wir seiner göttlichen Natur teilhaftig werden. "Darum ist der Erlöser der Sohn eines Menschen geworden, damit wir Söhne Gottes werden könnten" (Leo d. Gr.). Deshalb heißt es in der Eucharistie bei der Gabenbereitung:
- "Wie das Wasser sich mit dem Wein verbindet zum heiligen Zeichen, so lasse uns dieser Kelch teilhaben an der Gottheit Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat."
So ist in Jesus Christus für alle Menschen ein neuer Anfang gemacht. Was in seiner Menschwerdung auf einmalige Weise geschehen ist, das soll allen Menschen zuteil werden. Wir sollen durch die Gemeinschaft mit Gott zur Erfüllung unseres Menschseins gelangen.
Das grundlegende Dogma des Konzils von Chalkedon wurde in der Folgezeit weiterentfaltet. Aus der Wahrheit von der wahren menschlichen Natur Jesu Christi wurde abgeleitet, daß Jesus Christus als wahrer Mensch auch eine wahre menschliche Geistseele und einen wahren menschlichen Willen besitzt, der freilich der Gottheit im freien Gehorsam ganz untergeordnet ist. Dies wurde gegen die Irrlehre vom einen Willen in Jesus Christus (Monotheletismus) vom sechsten allgemeinen Konzil zu Konstantinopel (680-681) feierlich erklärt (vgl. DS 556; NR 220). Die damit ausgesagte menschliche Freiheit Jesu ist die Grundlage und Voraussetzung seines Gehorsams, durch den er uns erlöst hat. So zeigt auch dieses Dogma die Menschlichkeit des Heils Gottes durch Jesus Christus.
So wie Jesus Christus wahre menschliche Willensfreiheit zukommt, so auch eine wahre menschliche Erkenntnis. Die Heilige Schrift sagt uns, daß seine Weisheit zunahm (vgl. Lk 2,52) und daß er durch Leiden den Gehorsam lernte (vgl. Hebr 5,8). So besaß Jesus ein menschliches Erfahrungswissen und ein menschliches Ich-Bewußtsein. Darin wußte sich Jesus nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift freilich ganz eins mit Gott, seinem Vater. Diese einmalige innige Verbundenheit des Wissens und der Gewißheit ist gemeint mit der Lehre von der unmittelbaren Gottanschauung Jesu bereits in seinem irdischen Leben (vgl. DS 3812; NR 245). Diese Lehre muß so verstanden werden, daß sie das normale Erfahrungswissen und vor allem die Leidenserfahrung Jesu, sein Ringen mit dem Willen des Vaters (vgl. Mk 14,33-36) und seinen Ruf "Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" (Mk 15,34) nicht verdrängt, verdeckt und letztlich unwirklich erscheinen läßt. Die grundlegende und durchhaltende Gottesgewißheit Jesu hat sich vielmehr gerade in solchen menschlichen Erfahrungen immer wieder neu bewährt. Nur so ist Jesus "Urheber und Vollender des Glaubens" (Hebr 12,2). Nur so ist in ihm schon jetzt inmitten der Geschichte die Fülle der Zeit angebrochen.
3.4 Jesus Christus - die Fülle der Zeit
Schon das Bekenntnis und der Name Jesus Christus sagen, daß in Jesus Christus die messianische Zeit, die von Gott verheißene Erfüllung der Geschichte angebrochen ist. Der Apostel Paulus führt dieses Bekenntnis aus:
- "Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit wir die Sohnschaft erlangen." (Gal 4,4-5)
In Jesus Christus ist also auf eine ganz einmalige und alles Erwarten übersteigende Weise Wirklichkeit geworden, was die Menschheit schon immer ersehnt und was jeder einzelne Mensch bewußt oder unbewußt hofft. Das Herz des Menschen ist ja so weit, daß nur Gott groß genug ist, um es auszufüllen. Dies ist durch die Menschwerdung des Sohnes Gottes in Jesus Christus ein für allemal geschehen. In Jesus Christus ist die ganze Fülle Gottes erschienen (vgl. Kol 1,19), um alles zu erfüllen und zu vereinen (vgl. Eph 1,10).
Das Neue Testament gebraucht vielfältige Bilder und Begriffe, um Jesus Christus als die Fülle der Zeit zu verkünden. In ihm ist das Leben und das Licht, das schon immer in der Welt leuchtete, voll aufgestrahlt (vgl. Joh 1,4.9). In ihm sind die vielfältige Weisheit und das ewige Geheimnis Gottes erschienen (vgl. Eph 3,9-10), so daß in ihm "alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen" sind (Kol 2,3). In ihm hat Gott in der Fülle der Zeit alles zusammengefaßt und alles vereint, was im Himmel und auf Erden ist (vgl. Eph 1,10). Ja, das Neue Testament geht noch einen Schritt weiter: In ihm und auf ihn hin ist alles geschaffen (vgl. 1 Kor 8,6; Hebr 1,2; Joh 1,3). Er ist der Erste und der Letzte (vgl. Offb 1,17; 22,13).
- "Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes,
- der Erstgeborene der ganzen Schöpfung.
- Denn in ihm wurde alles erschaffen
- im Himmel und auf Erden,
- das Sichtbare und das Unsichtbare,
- Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten;
- alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen.
- Er ist vor aller Schöpfung,
- in ihm hat alles Bestand." (Kol 1,15-17)
Die frühen Kirchenväter haben immer wieder davon gesprochen, daß sich in aller Wirklichkeit, in der Natur wie in der Kultur, in den Religionen der Menschheit wie in den Philosophien Spuren, Samenkörner, Fragmente des Logos (Vernunft, Geist, Weisheit) finden, der in Jesus Christus in seiner ganzen Fülle gekommen ist. Deshalb ist Jesus Christus Haupt und Zusammenfassung der gesamten Wirklichkeit (Irenäus von Lyon). Das II. Vatikanische Konzil sagt, Jesus Christus sei "der Schlüssel, der Mittelpunkt und das Ziel der ganzen Menschheitsgeschichte" (GS 10). An einer anderen Stelle sagt das Konzil: "Der Herr ist das Ziel der menschlichen Geschichte, der Punkt, auf den hin alle Bestrebungen der Geschichte und der Kultur konvergieren, der Mittelpunkt der Menschheit, die Freude aller Herzen und die Erfüllung ihrer Sehnsüchte" (GS 45). In ihm leuchtet vor allem "das Geheimnis des Menschen wahrhaft auf" (GS 22).
Das sind keine abstrakten Spekulationen oder gar leere Phrasen. Aus solchen Aussagen ergeben sich vielmehr konkrete Konsequenzen. Paulus drückt sie so aus:
- "Alles gehört euch; ihr aber gehört Christus, und Christus gehört Gott." (1 Kor 3,22-23)
Weil alles in Jesus Christus Bestand hat, gehört dem Christen alle Wirklichkeit. Nichts ist für ihn "tabu"; er darf alles gebrauchen und sich an allem freuen. Weil er nur einen Herrn hat, ist er gegenüber allem anderen frei (vgl. 1 Kor 8,6). Diese christliche Freiheit muß er freilich in der Weise gebrauchen, wie es Jesus Christus entspricht, der ganz von Gott, seinem Vater, her und auf ihn hin lebt, der nichts für sich, sondern alles für die andern will. So wird Jesus Christus für den Christen zum Schlüssel für das Verständnis der Welt und für die Praxis in der Welt. In Jesus Christus darf und soll der Christ ganz weltoffen sein, aber nicht um sich der Welt anzupassen (vgl. Röm 12,2), sondern um alles auf Jesus Christus hinzuordnen und mit seinem Geist zu erfüllen. Damit wird niemand und nichts vergewaltigt. Im Gegenteil, in Jesus Christus leuchtet erst der tiefste Sinn aller Wirklichkeit auf. Ohne Jesus Christus kann man weder den Menschen noch die Welt voll verstehen. Durch den Bezug aller Wirklichkeit auf Jesus Christus erhält auch die menschliche Arbeit ihren letzten Sinn. Sie ist nicht nur Teilnahme am Werk des Schöpfers, sondern hat auch Bedeutung für das Reich Gottes (vgl. GS 39).
Um das universale Heil der Welt zu verwirklichen und alles in Jesus Christus zur Erfüllung zu bringen, braucht Gott Menschen, die sich ganz in den Dienst dieser Aufgabe stellen. Wie sehr diese menschliche Vermittlung zur Menschwerdung Gottes gehört, kommt nicht zuletzt in Maria, der Mutter des Herrn, zum Ausdruck.
II. Geboren von der Jungfrau Maria
1. Maria gehört ins Evangelium
Das Evangelium bezeugt uns Maria als Mutter Jesu. Sie wurde von Gott auserwählt als Mutter seines Sohnes. Deshalb bekennt sie die Kirche als Mutter Gottes und als unsere Mutter. Viele Christen haben heute jedoch große Schwierigkeiten mit der Aussage des Glaubensbekenntnisses "geboren von der Jungfrau Maria". Die Schwierigkeiten beziehen sich nicht allein auf die vielen nur schwer verständliche oder gar unverständliche jungfräuliche Geburt Jesu durch Maria, sondern betreffen viel grundsätzlicher die Tatsache, daß Maria überhaupt im Credo vorkommt. Vor allem evangelische Christen haben die Sorge, die Marienverehrung könne den Glauben an Jesus Christus, den einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, verdunkeln. In der Tat, man kann nicht bestreiten, daß es Übertreibungen in der Marienfrömmigkeit gegeben hat und gibt. Aber es gibt auch Verengungen und Verkürzungen, die übersehen, daß Maria deshalb ins Credo der Kirche gehört, weil sie ins Evangelium gehört, wie es uns in der Heiligen Schrift bezeugt ist. Von diesem biblischen Bild Marias gilt es auszugehen; von ihm muß sich echte Marienfrömmigkeit immer wieder inspirieren und an ihm sich kritisch messen lassen.
Die Heilige Schrift erwähnt Maria vor allem, weil sie die menschliche Mutter Jesu ist. Auf hebräisch heißt sie Mirjam. Sie ist eine Frau aus dem einfachen Volk, die mit ihrem Volk auf die Ankunft des Erlösers aus dem Hause Davids hofft. In der Stunde der Erfüllung spricht sie das Ja des Glaubens und stellt sich damit bereitwillig in den Dienst am Heil und an der Hoffnung ihres Volkes (vgl. Lk 1,38). Das Zeugnis des Neuen Testaments von Maria beschränkt sich indes nicht auf die Kindheitsgeschichten bei Matthäus und Lukas. Maria begegnet uns auch während des irdischen Lebens Jesu (vgl. Mk 3,20-21; Lk 11,27-28; Joh 2,1-12). Hier ist sie die Suchende und Fragende, der auch schwere Enttäuschungen nicht erspart bleiben. Auch sie wird auf den Weg des Kreuzes gestellt. Aber sie hält ihr ursprüngliches Ja des Glaubens durch und steht zusammen mit dem Jünger, den Jesus liebte, unter dem Kreuz (vgl. Joh 19,25-27). Deshalb wird sie als die Schmerzensmutter verehrt. Schließlich begegnen wir ihr nochmals inmitten der Jerusalemer Urgemeinde im Gebet um das Kommen des Heiligen Geistes (vgl. Apg 1,14).
Wir können diese Erwähnung Marias im Neuen Testament nur verstehen, wenn wir sehen, daß Maria hineingehört in die lange Geschichte großer Frauengestalten im Alten Testament. Ganz am Anfang steht die Gestalt Evas: Nach Gottes Bild geschaffen, ist sie dem Mann ebenbürtig, mit ihm zusammen beauftragt, Gottes Herrschaft in der Schöpfung zu repräsentieren. Doch statt Gehilfin Adams zu sein, wird sie ihm zur Mitverführerin. Trotzdem gilt ihr die Verheißung, Mutter aller Lebenden zu sein (vgl. Gen 3,20). Diese Verheißung setzt sich fort. Sara wird aufgrund der Verheißung noch in hohem Alter ein Sohn, Isaak, geschenkt (vgl. Gen 18,10-14). Ähnlich geschieht es bei der Geburt des Simson (vgl. Ri 13) und des Samuel durch Hanna (vgl. 1 Sam 1). In allen diesen Geschichten schenkt Gott gegen alle menschliche Erwartung und Hoffnung immer wieder neues Leben, um so seine Verheißung wahrzumachen. Gott erwählt das Schwache und Ohnmächtige, um das Starke zu beschämen (vgl. 1 Kor 1,27). Deshalb beruft er in schwierigen Situationen des Volkes Israel Frauen zu Retterinnen Israels: Debora, Judit und Ester.
Maria hat in dieser Geschichte der Verheißung einen einmaligen Platz. Sie steht an der Stelle, da diese Verheißung ihre Erfüllung findet. Ihr Platz ist in der Fülle der Zeit, da Gott seinen Sohn sandte, "geboren von einer Frau" (Gal 4,4). Zu dieser Aufgabe spricht Maria das Ja des Glaubens (vgl. Lk 1,38). So ist sie die wahre Abrahamstocher, von der gilt: "Selig ist die, die geglaubt hat" (Lk 1,45). Deshalb wird sie bei der Ankündigung der Geburt Jesu mit den gleichen Worten angeredet wie im Alten Testament Israel, die Tochter Zion: "Sei gegrüßt!" (Lk 1,28), "Juble, Tochter Zion! Jauchze, Israel! Freu dich, und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem!" (Zef 3,14; vgl. Joël 2,23; Sach 9,9). Maria ist also die Tochter Zion, die Repräsentantin Israels in der Stunde der Erfüllung seiner Hoffnung.
Maria selbst faßt die neutestamentliche Erfüllung der alttestamentlichen Verheißung zusammen in dem Loblied, das wir nach seinem lateinischen Anfangswort das Magnificat nennen (vgl. Lk 1,46-55). Es ist voller Anspielungen auf Texte des Alten Testaments und erinnert vor allem an das Danklied der Hanna nach der Geburt des Samuel (vgl. 1 Sam 2,1-10). In diesem Lied erweist sich Maria als die Prophetin, die neben, ja über den großen Frauen und Männern aus der Geschichte ihres Volkes steht. Wie sie weiß Maria, daß Gott allein Ehre und Ruhm, Preis und Dank gebühren. Deshalb verkündet sie die Umwertung aller irdischen Wertungen. "Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und läßt die Reichen leer ausgehen" (Lk 1,52-53). Mit diesem ganz vom Geist des Alten Testaments geprägten Loblied nimmt Maria zugleich das Evangelium des Neuen Testaments vorweg, vor allem die Seligpreisungen der Bergpredigt für die Armen, Kleinen, Trauernden und Verfolgten. Sie bezeugt mit ihrer ganzen Existenz das Evangelium Jesu Christi: Die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten die Ersten (vgl. Mk 10,31). Nicht umsonst ist das Magnificat ein Teil, ja der Höhepunkt des täglichen feierlichen Gebetsgottesdienstes der Kirche (Vesper) geworden. Damit ist Maria die Repräsentantin des Lobpreises, den die Kirche Gott aufgrund seiner geschichtlichen Großtaten schuldet.
So ist Maria das große Vorbild und Urbild des christlichen Glaubens. Sie ist Vorbild adventlicher Hoffnung, gläubiger Ganzhingabe und des Dienens aus dem Geist der Liebe. Sie ist Urbild des auf Gottes Wort hörenden und zu Gott betenden Menschen. Sie bewahrt und erwägt in ihrem Herzen, was sie von Gott her gehört und gesehen hat (vgl. Lk 2,19.51). In ihrem Glauben bleibt Maria aber die Fragende und Suchende. Sie ist die Schmerzensreiche, die Schmerzensmutter, die sich unter dem Kreuz mit dem Opfer ihres Sohnes verbindet. Nicht zuletzt ist sie die arme, demütige Magd des Herrn.
All das können katholische und evangelische Christen gemeinsam von Maria sagen. Der Evangelische Erwachsenenkatechismus schreibt unter der Überschrift "Maria gehört in das Evangelium": "Maria ist nicht nur ,katholisch`; sie ist auch ,evangelisch`. Protestanten vergessen das leicht. Aber Maria ist ja die Mutter Jesu, ihm näher als seine nächsten Jünger. Mit welcher Menschlichkeit zeichnet das Neue Testament diese Nähe, ohne Marias Abstand von Jesus zu verschweigen! Ein Beispiel für diesen Abstand steht ausgerechnet bei Lukas, der so viel von Maria erzählt. Da sagt eine Frau aus der Menge zu Jesus: Selig ist der Leib, der dich getragen hat, und die Brüste, die du gesogen hast.` Jesus entgegnet: 'Ja, selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren` (11,27-28). Aber gilt nicht genau das für Maria? Sie wird als die beispielhafte Hörerin des Wortes Gottes gezeichnet, als die Magd des Herrn, die ja zu Gottes Willen sagt, als die Begnadete, die aus sich selber nichts, durch Gottes Güte aber alles ist. So ist Maria das Urbild der Menschen, die sich von Gott öffnen und beschenken lassen, der Gemeinschaft der Glaubenden, der Kirche" (S. 392-393).
Die katholische Kirche sieht in diesen gemeinsamen Aussagen über Maria eine tragfähige biblische Grundlage ihrer Marienverehrung und ihrer dogmatischen Aussagen über Maria. Dabei geht es nicht um wilde Wucherungen und isolierte Weiterbildungen eines, wie es scheinen könnte, bescheidenen biblischen Ausgangspunktes. Betrachtet man nämlich die neutestamentlichen Aussagen im Gesamtzusammenhang der Heilsgeschichte, dann wird verständlich, daß die Tradition der Kirche Maria als Typus, d. i. Urbild der Kirche, bezeichnet hat (vgl. LG 53; 63).
Durch ihren Glauben und durch ihre Verbundenheit mit Jesus Christus ist Maria ein anschauliches Bild des durch Jesus Christus erlösten Menschen. Sie verkörpert in einmaliger Weise, was Kirche und was Christus bedeuten. Maria ist indes nicht nur ein strahlendes Vorbild der Kirche, sie ist auch deren Urbild. Sie geht ja der Kirche voraus und macht sie erst möglich. Denn durch ihr Ja, das sie als erste und stellvertretend für alle spricht, wird sie zur Eingangstür Gottes in die Welt. Deshalb nennen die Kirchenväter Maria die neue Eva, die "durch ihren Gehorsam für sich und das gesamte Menschengeschlecht die Ursache des Heils" wurde. "So wurde auch der Knoten des Ungehorsams der Eva durch den Gehorsam Mariens gelöst" (Irenäus von Lyon).
Mit diesen Aussagen soll nichts davon weggestrichen werden, daß Jesus Christus allein das Heil aller Menschen ist. Maria ist nur die demütige Magd. Sie ist von Jesus Christus erlöst wie wir alle. Aber Gott will in der Erlösungstat das freie Ja seines Geschöpfes. Das Fiat, das Ja-Wort Marias, ihr "Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast" (Lk 1,38), bringt programmatisch zum Ausdruck: Gott will einen Bund mit den Menschen schließen, in einen Dialog mit ihnen eintreten und ihnen seine Gemeinschaft und Freundschaft schenken. Die von Gott gnadenhaft ermöglichte Annahme des Heils durch Maria ist darum ein wesentliches Moment am Heilsgeschehen. Maria und ihr Ja gehören konstitutiv in die Vollendung der Heilsgeschichte hinein. Ohne Maria kann der volle Sinngehalt des Christusglaubens nicht gewahrt werden. Würde Maria aus dem Evangelium gestrichen, dann würde das Menschliche zur bloßen Verkleidung des in der Geschichte handelnden und sprechenden Gottes. In Maria dagegen wird die Würde des Geschöpfes vor Gott gewahrt.
Das II. Vatikanische Konzil sagt deshalb mit Recht: "Maria vereinigt, da sie zuinnerst in die Heilsgeschichte eingegangen ist, gewissermaßen die größten Glaubensgeheimnisse in sich und strahlt sie wider" (LG 65). An Maria wird offenbar, wer Jesus Christus ist und was er uns als Heil und Hoffnung bedeutet. Das ist ihre Größe und ihre Demut.
2. Maria, die Mutter des Herrn
2.1 Maria, die Mutter Gottes
Daß Maria die Mutter Jesu ist, wird uns im Neuen Testament an vielen Stellen bezeugt (vgl. Mt 1,18, 2,11.13.20; 12,46; 13,55; Joh 2,1; Apg 1,14). Die Weihnachtsgeschichte sagt sehr anschaulich, daß Maria Jesus wie jede andere Mutter neun Monate unter ihrem Herzen getragen und daß sie ihn, als ihre Zeit gekommen war, geboren hat (vgl. Lk 2,5-7).
Damit ist mehr gemeint als eine physische Mutterschaft und ein rein privates Verhältnis zwischen Jesus und ihr. Sie ist nicht nur leiblich Mutter des Herrn; zu ihrer Mutterschaft gehört wesentlich ihr Glaube. Denn bevor sie Jesus leibhaftig empfing, hatte sie ihn im Glauben aufgenommen und empfangen. Von ihr gilt nicht nur: "Selig die Frau, deren Leib dich getragen und deren Brust dich genährt hat", sondern noch mehr: "Selig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und es befolgen" (Lk 11,27-28; vgl. 8,21). So hat schon Elisabet Maria als Glaubende gepriesen: "Selig ist die, die geglaubt hat" (Lk 1,45). Durch ihr Ja ist Maria als Mutter Jesu zugleich eine Gestalt der Heilsgeschichte. Deshalb gibt ihr Lukas den Ehrentitel Mutter des Herrn (vgl. Lk 1,43).
Die Verkündigungsgeschichte des Lukas sagt uns noch genauer, was dieses Muttersein bedeutet: nicht nur Mutter Jesu und Mutter des Herrn, sondern Mutter des Sohnes Gottes. "Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden" (Lk 1,35; vgl. Gal4,4). Man kann in dieser Aussage einen Anklang an die alttestamentliche Erzählung finden, wonach die Herrlichkeit Gottes in Gestalt einer Lichtwolke vor Israel hergezogen ist (vgl. Ex 13,21), ja inmitten Israels, im heiligen Zelt, Wohnung genommen hat (vgl. Ex 40,34). Die Wolke ist hier Symbol der machtvollen Gegenwart Gottes inmitten seines Volkes. Wenn nun nach dem Neuen Testament Maria von Gottes Geist überschattet wird, dann ist sie die neue Wohnung Gottes, das neue Zelt des Bundes, in dem Gottes Wort unter uns Wohnung aufgeschlagen hat (vgl. Joh 1,14).
Ausgehend von solchen biblischen Aussagen konnte die Kirche auf dem dritten allgemeinen Konzil, dem Konzil von Ephesus (431), lehren: Maria ist die Mutter Gottes. Dieses Bekenntnis ist allen Christen gemeinsam. Auch die Reformatoren des 16. Jahrhunderts haben daran festgehalten. Man darf den Ausdruck Gottesmutter freilich nicht mißverstehen. Selbstverständlich hat Maria nicht Gott als Gott geboren. Das wäre nicht Evangelium, sondern bare Mythologie, wo oft von einem weiblichen Prinzip in der Gottheit oder manchmal von einer Quaternität (Viergottheit) die Rede ist. Maria, wie sie in der Bibel bezeugt und von der Kirche geglaubt wird, ist und bleibt Geschöpf! Sie hat nicht Gott als Gott, sondern Jesus Christus seiner mit der Gottheit wesenhaft verbundenen Menschheit nach geboren. So ist das Bekenntnis zur Gottesmutterschaft letztlich ein Bekenntnis zu Jesus Christus, der in einer Person wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Wenn die Kirche Maria als Gottesmutter verehrt, so will sie damit Jesus Christus, der in Person der eine Mittler zwischen Gott und den Menschen ist, verherrlichen.
2.2 Maria, unsere Mutter
Der Ehrentitel "Gottesmutter" begegnet uns erstmals in einem Gebet, das uns bereits um das Jahr 300 bezeugt ist. In etwas erweiterter Form sprechen wir dieses Gebet noch heute:
- "Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, heilige Gottesmutter. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern errette uns jederzeit aus allen Gefahren, o du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin. Führe uns zu deinem Sohne, empfiehl uns deinem Sohne, stelle uns vor deinem Sohne." (Gotteslob 32,3)
dieses Gebet drückt in schöner Weise aus: Als Mutter Gottes ist Maria auch unsere Mutter. Als unsere Mutter hat sie aber keine andere Aufgabe, als uns zu Jesus Christus, ihrem Sohn, zu führen. Denn als Mutter Jesu Christi ist sie Pforte des Heils für alle, die Jesus Christus angehören. Sie ist Mutter der Glieder des Leibes Christi, dessen Haupt Jesus Christus ist (vgl. LG 53). So trägt sie in mütterlicher Liebe Sorge für die Brüder und Schwestern ihres Sohnes, die noch auf der Pilgerfahrt und Gefahren und Bedrängnissen ausgesetzt sind. Deshalb wird sie "in der Kirche unter dem Titel der Fürsprecherin, der Helferin, des Beistandes und der Mittlerin angerufen" (LG 62).
Diese Überzeugung von der Fürbitte, der Hilfe und dem Beistand Marias ist aus dem Gebetsschatz der Kirche gar nicht wegzudenken. Das zeigt vor allem der Schluß des "Ave Maria", des bekanntesten aller Gebete zu Maria:
- "Heilige Maria, Mutter Gottes,
- bitte für uns Sünder
- jetzt und in der Stunde unseres Todes."
Was in der katholischen Gebets- und Liedtradition völlig selbstverständlich ist, das findet den Widerspruch der reformatorischen Christenheit. Evangelische Christen können Maria (und die Heiligen allgemein) durchaus als Vorbilder im Glauben verehren; sie lehnen es aber ab, sie um ihre Fürsprache und Hilfe anzurufen (vgl. CA 21). Nach katholischem Verständnis ist eine solche Anrufung grundsätzlich zu unterscheiden von der Anbetung, die einzig und allein Gott gebührt und niemals einem Geschöpf, also auch nicht Maria (vgl. LG 66). Die Anrufung bedeutet auch nicht, daß die Wahrheit von Jesus Christus als dem einzigen Mittler des Heils (vgl. 1 Tim 2,5-6) geleugnet oder auch nur verdunkelt werden soll. Schon der hl. Ambrosius sagte, die Fürbitte Marias nehme der Würde und Wirksamkeit des einen Mittlers nichts weg und füge ihr nichts hinzu. Die Fürbitte Marias hängt nämlich ganz von der Erlösungstat Jesu Christi ab und schöpft aus ihrer Wirkkraft (vgl. LG 61-62). Sie ergibt sich letztlich daraus, daß alle Glieder am Leibe Christi einander solidarisch sind. "Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit, wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle anderen mit ihm" (1 Kor 12,26). Nach katholischem Verständnis bringt das Vertrauen in die fürbittende Mittlerschaft Marias in besonderer Weise das Geheimnis zum Ausdruck, daß Gott sich einzelner Menschen bedient, um anderen Menschen das Heil zu schenken. So ist in Maria das Menschengeschlecht insgesamt geehrt.
Um der Verehrung und dem Vertrauen auf die Fürbitte Marias Ausdruck zu geben, gebraucht die katholische Frömmigkeit vielfältige Titel für Maria. Neben den genannten: Mutter, Fürsprecherin, Helferin, Mittlerin, gibt es viele, oft überschwengliche und für nichtkatholische Christen leicht mißverständliche und anstößige Aussagen, die aber, im Gesamtzusammenhang verstanden, durchaus einen richtigen Sinn haben können. Dies gilt vor allem von dem Titel "Mittlerin aller Gnaden". Mit dieser Bezeichnung soll keineswegs ausgeschlossen oder auch nur verdunkelt werden, daß Jesus Christus der einzige Mittler ist; es soll vielmehr zum Ausdruck gebracht werden, daß Maria mit ihrem Ja das Kommen dieses Mittlers aller Gnaden stellvertretend für alle angenommen hat und daß sie Jesu Heilsvermittlung bleibend durch ihre Fürsprache begleitet. - Um zu sagen, daß Maria an Gnadenfülle alle anderen Heiligen überragt, wird sie als Königin des Himmels angerufen und verehrt. Dies geschieht am bekanntesten im "Salve Regina", "Sei gegrüßt, o Königin, Mutter der Barmherzigkeit" (11. Jh.) (Gotteslob 32,1; 570) oder im "Regina caeli", "Freu dich, du Himmelskönigin" (12. Jh.) (Gotteslob 2,8; 574). - Um schließlich die in der Heilsgeschichte begründete einmalige Stellung Marias als Urbild der Kirche auszudrücken, bezeichnet man Maria nicht nur als Mutter der Christen, sondern auch als Mutter der Kirche.
Bei diesen und vielen anderen Formen der Marienverehrung ist auf die Mahnung zu achten, die Papst Paul Vl. in seinem Apostolischen Schreiben über die Marienverehrung (1974) an die Kirche gerichtet hat. Der Papst forderte eine Erneuerung der Marienverehrung, die, biblisch ausgerichtet, trinitarisch und christologisch geprägt, ohne Abstriche zu machen, Rücksicht nimmt auf die Andersgläubigen und die den Ausdrucksformen der jeweiligen Zeit und Kultur entspricht. Ausdrücklich warnt er mit dem II. Vatikanischen Konzil (vgl. LG 67) vor falschen Formen der Marienfrömmigkeit, welche die Grenzen der rechten Lehre überschreiten, leichtgläubig und neugierig an neuesten Wunderberichten interessiert sind, sich mehr in äußeren Praktiken erschöpfen oder sich in oberflächlicher Sentimentalität ergehen. Letztes Ziel aller Marienverehrung muß die Verherrlichung Gottes und die Verchristlichung des Lebens sein. In dieser Hinsicht hat die katholische Marienfrömmigkeit reiche Frucht getragen.
3. Die Jungfrau Maria
3.1 Ein schwieriger historischer Befund
"Geboren von der Jungfrau Maria", dieser Satz aus dem Credo hat ein biblisches Fundament. Die beiden Kindheitsgeschichten bei Matthäus (vgl. 1,18-25) und Lukas (vgl. 1,26-38) decken diese Aussagen. Nach der lukanischen Verkündigungsgeschichte fragt Maria den Engel, der die Menschwerdung des Immanuel in ihrem Schoß ankündigt: "Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne?" (Lk 1,34). Gemeint ist: "da ich mit keinem Mann in ehelicher Gemeinschaft zusammen wohne". Die Antwort des Engels bezeichnet die Empfängnis Jesu Christi durch Maria als schöpferische Wundertat des Geistes Gottes: "Für Gott ist nichts unmöglich" (Lk 1,37). Noch deutlicher ist die Erzählung des Matthäus. Im Traum erklärt ein Engel Josef, dem Verlobten Marias, wie es sich mit deren Mutterwerden verhält: "Das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist" (Mt 1,20). Darin erkennt Matthäus die Erfüllung der alttestamentlichen Verheißung, die er nach griechischer Übersetzung zitiert: "Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn gebären" (Jes 7,14).
So eindeutig die Bekenntnisaussage von der jungfräulichen Geburt Jesu in diesen beiden Texten begründet ist, so viele Schwierigkeiten macht sie heute, wenn wir die biblischen Texte mit Hilfe der modernen historisch-kritischen Methoden auslegen. Drei solcher historischer Schwierigkeiten seien genannt:
1. Die Texte bei Matthäus und Lukas sind keine historischen Berichte in unserem heutigen Sinn. Man kann sie freilich auch nicht als ungeschichtliche Sagen oder Legenden abtun, sondern muß sie eher als fromme erbauliche Erzählungen (Haggada) verstehen, die alttestamentliche Überlieferung im Lichte der neutestamentlichen Erfüllung wiedererzählen. Ereignis und theologische Deutung, Bericht und Bekenntnis sind dabei unauflöslich miteinander verwoben. Solche Erzählungen schließen einen historischen Kern ein. Dennoch darf man sie nicht primär nach historischen Tatsachen befragen, sondern muß sie auf ihre Bekenntnisaussage hin abhorchen. So wird oft die Frage gestellt: Ist das Motiv der jungfräulichen Geburt ein bloßes Aussagemittel für eine Glaubensaussage, oder gehört es selbst mit zur Glaubensaussage hinzu?
2. Es gibt Schichten und Schriften des Neuen Testaments, vor allem die paulinischen Briefe, die im Unterschied zu Matthäus und Lukas das Motiv der Jungfrauengeburt nicht erwähnen. In den Evangelien wird Jesus gelegentlich sogar ausdrücklich als der Sohn des Josef bezeichnet (vgl. Mt 13,55; Lk 4,22; Joh 1,45; 6,42); oder es ist einfach von den Eltern Jesu die Rede (vgl. Lk 2,27.41.43.48). Es scheint sich bei der Jungfrauengeburt also um eine partikuläre und relativ späte Tradition zu handeln. So stellt man oft die Frage:
Wenn schon nicht alle Traditionen des Neuen Testaments die jungfräuliche Geburt Jesu kennen, kann dann der Christusglaube nicht auch heute ohne dieses Motiv auskommen?
3. Das Motiv der Jungfrauengeburt bei Matthäus und Lukas steht in einer größeren Tradition. Das Alte Testament kennt eine Reihe von wunderbaren Geburtsgeschichten großer Rettergestalten: Jakob, Isaak, Simson, Samuel bis hin zu Johannes dem Täufer. Diese Tradition soll durch das Motiv der Jungfrauengeburt aufgegriffen und zugleich überboten werden; Jesus soll dadurch als die überbietende Erfüllung des Alten Testaments verkündet werden. Manche Forscher leiten dieses Motiv sogar aus hellenistischen oder ägyptischen Parallelen ab. So wird die Frage gestellt: Ist das Motiv der Jungfrauengeburt ein damals mehr oder weniger geläufiges literarisches Schema, das als Aussageform für einen theologischen Inhalt verstanden werden muß?
Wir können die Antwort auf diese Fragen hier nur andeuten. Es wurde schon deutlich, daß man aus der literarischen Form der Haggada nicht auf die Nichttatsächlichkeit schließen kann. In dieser Hinsicht sind die beiden neutestamentlichen Texte also für ein tatsächliches Verständnis offen, und es kann keinerlei Zweifel daran bestehen, daß sie selbst ihre Aussagen wörtlich gemeint haben. Das Argument, daß diese Texte in ihrer jetzigen Gestalt einer erst jüngeren Traditionsschicht angehören, besagt sachlich nichts. Denn ob ein Text jünger oder älter ist, entscheidet nicht über seinen Wahrheitsgehalt. Im übrigen enthalten beide Texte, wie aus ihrer stark semitisch gefärbten Sprache hervorgeht, wesentlich ältere Tradition, die in den palästinischen Raum zurückverweist. Ihre Glaubwürdigkeit wird zusätzlich noch dadurch gestärkt, daß Matthäus und Lukas diese ältere Tradition unabhängig voneinander bezeugen. Auch die Tatsache, daß Jesus an manchen Stellen des Neuen Testaments als Sohn Josefs bezeichnet wird, ist kein zwingender Einwand. Denn nach jüdischem Recht trugen sowohl leibliche als auch adoptierte Söhne den Namen des Vaters.
Bleibt also das religionsgeschichtliche Argument. Die Ableitungen aus dem hellenistischen oder ägyptischen Raum halten genauer Nachprüfung nicht stand. Es gibt verwandte Motive, aber keine wirklichen Parallelen; im übrigen sind Analogien keine Genealogien. Anders ist es mit den Entsprechungen im Alten Testament. Sie sind für die beiden neutestamentlichen Texte von grundlegender Bedeutung, freilich so, daß das Neue Testament das Alte Testament nicht nur wiederholt, sondern auch überbietet. Diese Feststellung ist wichtig für die Frage, ob Jes 7,14 im hebräischen Urtext von einer Jungfrau spricht, wie die griechische Übersetzung und die Auslegung der Kirchenväter meinen, oder von einer jungen Frau, d. h. von einem Mädchen im heiratsfähigen Alter, wie die meisten heutigen Exegeten sagen. So oder so bezeugt Jesaja das Wunder eines neuen, von Gott gesetzten Anfangs, auf das der Glaube setzen muß. Dieses Wunder sieht das Neue Testament in der jungfräulichen Geburt Jesu gegeben.
Das kirchliche Dogma spricht nicht nur von der jungfräulichen Geburt Jesu; vielmehr hat bereits das fünfte allgemeine Konzil zu Konstantinopel (553) dieses Bekenntnis ausgeweitet zum Dogma von der immerwährenden Jungfrauschaft Marias. Dieses Dogma besagt, daß Maria nicht nur vor der Geburt, sondern auch in der Geburt wie nach der Geburt Jesu jungfräulich blieb (vgl. DS 422; 427; 437; NR 181; 185; 192). Daran hielt auch Luther fest (Schmalkaldische Artikel), anders freilich die allermeisten heutigen protestantischen Schriftausleger. Sie verweisen auf die Aussage der Schrift, die von den Brüdern und Schwestern Jesu (vgl. Mk 6,3; Mt 27,56; 1 Kor 9,5) wie von einem Herrenbruder Jakobus (vgl. Gal 1,19) sprechen. Katholische Forscher machen demgegenüber geltend, es gebe gute Gründe, entsprechend damaligem Sprachgebrauch darunter nahe Verwandte Jesu, etwa Vettern und Basen, zu verstehen.
Aus alledem folgt nicht, daß man die Bekenntnisaussage von der jungfräulichen Geburt Jesu historisch beweisen kann, sondern nur, daß die historischen Gegenargumente nicht zwingend sind. Wir können also sagen: Die neutestamentlichen Texte lassen, rein historisch betrachtet, die Auslegung der Kirchenväter, die sich im Credo niedergeschlagen hat, zu. Letztlich bleibt über diesen Texten aber ein Geheimnis, das rein historischer Betrachtung gar nicht zugänglich ist. Es erschließt sich uns erst, wenn wir die biblischen Texte mit der Kirche im Licht der kirchlichen Überlieferung, wie sie im kirchlichen Glaubensbekenntnis Ausdruck gefunden hat, lesen. Erst das kirchliche Glaubensbekenntnis schenkt uns hier Eindeutigkeit und Gewißheit.
3.2 Ein tiefer theologischer Sinn
Das Neue Testament bezeugt uns die jungfräuliche Geburt Jesu als von Gott gewirktes Wunder. Die eigentliche Frage ist also, ob man es Gott zutraut, daß er wirklich der allmächtige Vater ist. Würde so etwas wie eine jungfräuliche Geburt grundsätzlich ausgeschlossen, wäre die Gottes- und Glaubensfrage überhaupt gestellt. Dann wäre die Welt als ein hoffnungslos in sich geschlossenes System verstanden. Der eigentliche Einwand, den heute viele gegen das Bekenntnis zur jungfräulichen Geburt hegen, ist deshalb nicht historischer Art, sondern entspringt dem durchschnittlichen heutigen Weltbild. In dieser Perspektive scheint die Jungfrauengeburt wenn nicht ganz unmöglich, so doch äußerst unwahrscheinlich zu sein. Das ist sie in der Tat, und zwar nicht erst heute, sondern auch schon damals. Aber ist das menschlich Unwahrscheinliche auch das für Gott Unmögliche, oder gilt nicht, daß für Gott nichts unmöglich ist (vgl. Lk 1,37)?
Das heißt nicht, der Glaube müsse möglichst viele Wunder postulieren und alle Wunderberichte leichtgläubig übernehmen. Gottes Wundertaten stehen im Dienst für das Kommen der Herrschaft Gottes. Sie ist das schlechterdings unableitbare Wunder Gottes, das mit dem Kommen Jesu Christi angebrochen ist. So ist die jungfräuliche Geburt Jesu ein leibhaftiges Zeichen des neuen Anfangs Gottes. Sie ist ein Zeichen menschlicher Ohnmacht und Unfähigkeit, das Heil selbst herbeizuschaffen. In der Situation, in der die Menschen keinen Ausweg mehr wußten, hat Gott auf wunderbare Weise durch die neuschaffende Macht seines Geistes einen neuen Anfang gesetzt. Nicht umsonst steht im Neuen Testament die Jungfräulichkeit auch sonst im Zusammenhang des Kommens des Reiches Gottes (vgl. Mt 19,12; 1 Kor 7,7.32-34).
Marias Jungfräulichkeit steht auch in engem Zusammenhang mit ihrer Gottesmutterschaft. Wenn Gott bei der Menschwerdung seines Sohnes nicht den normalen Weg der menschlichen Zeugung gegangen ist, so ist dies nicht Willkür; vielmehr steht der Weg der jungfräulichen Geburt in einer zeichenhaften Entsprechung zur Menschwerdung Gottes. Denn die Jungfrauengeburt bringt mit nicht mehr überbietbarer Deutlichkeit zum Ausdruck, daß sich Jesus als Sohn Gottes einzig und allein seinem Vater im Himmel verdankt, daß er alles, was er ist, von ihm her und auf ihn hin ist. Die Jungfrauengeburt ist also ein Zeichen der wahren Gottessohnschaft Jesu.
Auch die Glaubenswahrheit von der immerwährenden Jungfrauschaft Marias, also der Jungfräulichkeit, nicht nur vor, sondern auch in und nach der Geburt Jesu, hat eine tiefe zeichenhafte Bedeutung. Leider hat das Dogma von der Jungfräulichkeit in der Geburt im Anschluß an apokryphe Schriften oft zu unangemessenen Überlegungen über die Art der Geburt Jesu verleitet. Doch gerade damit hat man den tiefen heilsgeschichtlichen Sinn dieser Aussage mißverstanden. Nach Gen 3,16 ist das Gebären unter Schmerzen ein Zeichen der tiefen Störung im Zusammenhang des Lebens, eine Folge der Erbsünde. Jetzt, da das neue Leben erscheint und die Erlösung von der erbsündlichen Verfallenheit einsetzt, kommt das Leben nicht mehr unter dem Vorzeichen des Todes und seines Vorboten, des Schmerzes, zur Welt; jetzt wird die in sich zerrissene Kreatur wieder ganz und heil. Nicht der physiologische Vorgang der Geburt war anders; vielmehr war dieses Geschehen vom personalen Mitvollzug her ein Zeichen des Heils und des Geheiltseins des Menschen. Die Tradition spricht deshalb von der Freude Marias bei der Geburt ihres Sohnes. Das alte Marienlied "Ave maris stella" (9. Jh.) nennt sie die "felix caeli porta", die "glückselige Pforte des Himmels" (Gotteslob 596).
Die Jungfräulichkeit Marias nach der Geburt Jesu meint, daß Maria nach der Geburt Jesu Jungfrau blieb und keinen weiteren Kindern das Leben schenkte. Diese Glaubenswahrheit ist eine letzte Ausstrahlung ihres Ja-Wortes und ihrer bedingungslosen Verfügbarkeit für Gott und seinen Willen. Maria war von ihrer heilsgeschichtlichen Aufgabe ganz in Anspruch genommen. So ist die immerwährende Jungfräulichkeit Marias ein Zeichen ihrer Heiligkeit, d. h. ihres Ausgesondertseins zum Dienst für Gott und sein Volk. Diese Wahrheit des Glaubens war in der Geschichte von großer Bedeutung für das Ideal der frei gewählten Ehelosigkeit. Dieses Ideal bedeutet keine Abwertung der Ehe, vielmehr deren Aufwertung zu einem eigenständigen Dienst in Kirche und Gesellschaft.
Deshalb gehören nach katholischem Verständnis die Hochschätzung der Jungfräulichkeit und die Wertung der Ehe als Sakrament, d. h. als Heilszeichen, unlösbar zusammen.
4. Maria, die Begnadete und Verherrlichte
Erst mit dem Thema der Begnadung und Verherrlichung Marias kommen wir zu den katholischen Mariendogmen im engeren Sinn. Es handelt sich um das Dogma von Maria, der unbefleckt Empfangenen (1854), und um das Dogma von Maria, der in die himmlische Herrlichkeit Aufgenommenen (1950). Der Sache nach sind diese Wahrheiten auch der Ostkirche vertraut; aber sie gehören dort mehr in den Bereich der Liturgie und der Frömmigkeit als in den des Dogmas. Anders verhält es sich mit den reformatorischen Kirchen. Sie können die Frömmigkeit achten, aus denen diese Dogmen erwachsen sind, aber sie können sie von ihren Voraussetzungen her kaum mitvollziehen. Beide Dogmen sind nur indirekt und einschlußweise in der Heiligen Schrift enthalten. Sie ergeben sich aus einer gläubigen Gesamtschau des biblischen Zeugnisses von Maria und ihrer Stellung in der Heilsgeschichte, aber nicht aus einzelnen Bibelworten. Verbürgt wird uns diese Deutung durch das Glaubenszeugnis und die Glaubenspraxis der Kirche. Es ist deshalb die Aufgabe von Verkündigung, Lehre und Unterweisung der katholischen Kirche, diese Dogmen nicht als Sondergut im Sinn von äußeren Zusätzen zum gemeinsamen Glauben, sondern als sachgerechten Ausdruck des gemeinsamen Christusglaubens verstehen zu lehren.
4.1 Maria als Zeichen der Begnadung
"Begnadete" ist ein Titel, der Maria schon im Neuen Testament zugesprochen wird (Lk 1,28). Sie ist "voll der Gnade", weil sie aufgrund von Gottes unergründlicher Erwählung Gnade bei ihm gefunden hat und weil sie sich im Glauben ganz auf Gottes Ruf eingelassen hat. Darin ist Maria zunächst ein Urbild jedes Erwählten, Glaubenden und Begnadeten. Sie sagt uns, daß Gott am Anfang jedes Menschen steht, ja daß er ihn von Ewigkeit her in seine Hand geschrieben und mit Namen gerufen hat. Gott umfaßt das Leben jedes Menschen mit unergründlicher erlösender Liebe. Indem er uns ins Dasein ruft, ruft er uns zugleich zur Gemeinschaft mit ihm.
Maria ist also ein Zeichen, daß Gott und seine Gnade all unserem Sein und erst recht all unserem Tun vorausgehen und ihm zuvorkommen, so daß wir nichts aus uns, alles aber aus Gott und in Gott sind.
Maria ist jedoch nicht nur Urbild der Erwählung und Begnadung jedes Christen; sie ist die Begnadete in einem ganz einmaligen Sinn, der sich aus ihrer einmaligen Stellung in der Heilsgeschichte ergibt. In ihr verdichtet sich in der Fülle der Zeit die Erwählung Israels. Die Israel gegebene Verheißung wird dadurch Wirklichkeit, daß sie an Stelle der ganzen Menschheit durch ihr Ja das Ja Gottes annimmt (Thomas von Aquin). Dieses "mir geschehe, wie du es gesagt hast" (Lk 1,38) ist nicht ihre eigene moralisch-religiöse Höchstleistung; es ist nur als von der Gnade Gottes ermöglichte und getragene Antwort des Glaubens möglich. Maria, die durch ihr Ja das Kommen der Fülle der Gnade ermöglichte, muß also selbst "voll der Gnade" sein.
Auf diesem Hintergrund wird das Dogma verständlich, das Papst Pius IX. im Jahr 1854 verkündete:
- "Die seligste Jungfrau Maria blieb im ersten Augenblick ihrer Empfängnis durch einzigartiges Gnadengeschenk und Vorrecht des allmächtigen Gottes, im Hinblick auf die Verdienste Christi Jesu, des Erlösers des Menschengeschlechts, von jedem Fehl der Erbsünde rein bewahrt." (vgl. DS 2803; NR 479)
Dieses Dogma von der "Unbefleckten Empfängnis" Marias begegnet dem offensichtlich unausrottbaren Mißverständnis, als sei der Akt der Zeugung und der Empfängnis normalerweise etwas Beflecktes oder Befleckendes. Doch abgesehen davon, daß ein solches Mißverständnis der kirchlichen Lehre vom Gutsein der Schöpfung widerspricht, will der Glaubenssatz nichts über den religiös-sittlichen Zustand der Eltern Marias bei ihrer Empfängnis sagen, sondern lediglich etwas über die unbefleckt Empfangene selbst. Es soll gesagt werden, daß sie vom ersten Augenblick ihres Daseins an frei von der Erbsünde war. Sie wurde nicht wie die übrigen Menschen in die Gottesferne hinein empfangen, sondern von allem Anfang an ganz von der Liebe und Gnade Gottes umfangen. Deshalb war sie auch in ihrem späteren Leben ganz ohne persönliche Sünde. Sie ist, wie die Ostkirche sagt, die "Ganz-Heilige". Ganz, d. h. von allem Anfang an und in allen Dimensionen.
Es war ein langer und schwieriger Weg, der zu diesem Dogma führte. Große Heilige und Theologen standen im Für und Wider gegeneinander. Selbst ein Heiliger und glühender Marienverehrer wie Bernhard von Clairvaux wandte sich im 12. Jahrhundert gegen die Einführung des Festes von der Unbefleckten Empfängnis (8. Dezember). Das Grundproblem war: Wie läßt sich diese Glaubenswahrheit damit vereinbaren, daß Maria wie wir alle durch Jesus Christus, in dem allein Heil ist, erlöst wurde? Die Antwort, welche die Theologen aus dem Franziskanerorden, besonders Johannes Duns Scotus, schließlich gaben und die auch in die Dogmatisierung einging, lautete: Die Erlösungstat wirkt bei Maria voraus und hat bei ihr die Gestalt der Bewahrung von der Sünde. Ein solches Vorauswirken finden wir schon im Alten Bund, dort jedoch nur schattenhaft, bei Maria in Fülle. Dem ganzen Ja des Glaubens in der Fülle der Zeit entspricht die Fülle der Erlösungsgnade. Maria ist also ein Glied der erlösungsbedürftigen Menschheit. Sie ist der vollkommene, urbildliche, reine Fall der Erlösung überhaupt. In ihr und in ihr allein ist die Kirche ohne Makel und Runzel (vgl. Eph 5,27), die sonst erst eine endzeitliche Hoffnung ist, schon jetzt verwirklicht. So ist Maria, die Ganz-Heilige, Zeichen der erwählenden, berufenden und heiligenden Gnade für uns Sünder. Darum dürfen wir beten: "Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder..."
4.2 Maria als Zeichen der Hoffnung
Das jüngste marianische Dogma betrifft die leibliche Aufnahme Marias in die himmlische Herrlichkeit. Auch für dieses Dogma gibt es kein direktes biblisches Zeugnis, in der Tradition wird diese Glaubenswahrheit erst vom 6. Jahrhundert an bezeugt, zunächst in legendenhaften Berichten, die, obwohl sie historisch keinen Wert besitzen, dennoch eine Glaubensüberzeugung zum Ausdruck bringen. Wie das seit dem 5. Jahrhundert bekannte Fest "Mariä Heimgang", später: "Mariä Himmelfahrt" (15. August), zeigt, stimmt die Kirche seither über viele Jahrhunderte in dieser Glaubensüberzeugung überein. Insofern handelt es sich inhaltlich nicht um ein neues Dogma, sondern um eine jahrhundertealte Überlieferung. Sie hat indirekt und einschlußweise im Gesamtzusammenhang der Heiligen Schrift ihre Wurzeln. Im Lukasevangelium heißt es von Maria: "Selig ist die, die geglaubt hat" (Lk 1,45). Weil sie die ganz Begnadete und ganz Glaubende war, gelten von ihr auch die Verheißungen des Glaubens in besonderer Weise: die Auferstehung zum ewigen Leben, das dem ganzen Menschen mit Leib und Seele verheißen ist.
In diesem Sinn hat Papst Pius XII. im Jahr 1950 das Dogma verkündet:
- "Es ist eine von Gott geoffenbarte Glaubenswahrheit, daß die unbefleckte, immer jungfräuliche Gottesmutter Maria nach Vollendung ihres irdischen Lebenslaufes mit Leib und Seele zur himmlischen Herrlichkeit aufgenommen worden ist." (DS 3903; NR 487)
In dieser Glaubenswahrheit geht es nicht um eine historische Überlieferung über Zeit, Ort und Umstände des Heimgangs Marias (Jerusalem oder Ephesus?). Über solche historische Einzelheiten wissen wir nichts Zuverlässiges. Es geht allein um eine Glaubensüberlieferung. Anders als bei der Auferstehung und Erhöhung (Himmelfahrt) Jesu Christi, die uns durch die Erscheinungen des Auferstandenen bezeugt werden, gibt es für die Aufnahme Marias in die himmlische Herrlichkeit keine Zeugen. Sie ist ein von Gott gewirktes Geschehen, aber kein historisch datierbares Ereignis. Sie ist nicht wie die Auferwekkung und Erhöhung Jesu Christi der Grund unserer Hoffnung auf Auferweckung, sondern nur deren Frucht und damit eine Bekräftigung unserer eigenen Hoffnung.
Zur Begründung dieses Glaubens kann man vor allem zwei Gesichtspunkte anführen. An erster Stelle kann man auf die besonders enge Verbundenheit Marias mit Jesus Christus, ihrem Sohn, und mit seinem Weg verweisen. Christusgemeinschaft ist Gemeinschaft des Kreuzes und der Auferstehung. Dazu sind grundsätzlich alle Christen berufen. Aufgrund ihrer einmaligen Verbundenheit mit Jesus Christus ist bei Maria bereits vorweggenommen, wozu wir erst berufen sind: die Auferstehung des Leibes. Der zweite Gesichtspunkt sieht Maria als die neue Eva, die neue Mutter des Lebens. Sie hat den Urheber des Lebens geboren und durch ihr Ja in besonderer Weise zum Sieg des Lebens über den Tod beigetragen. Von ihr gilt schon jetzt: "Verschlungen ist der Tod vom Sieg" (1 Kor 15,54). So leuchtet Maria durch ihre Verherrlichung als "Zeichen der sicheren Hoffnung und des Trostes dem wandernden Gottesvolk voran" (LG 68).
Was bedeutet dieses Dogma für uns? In einer Situation, da die einen das Fleisch vergötzen und die anderen es hassen, weil sie sich hoffnungslos in Strukturen und Systeme eingesperrt fühlen, nützte es wenig, würde die Kirche nur Programme, Prinzipien und Appelle verkünden. Sie gibt uns in Maria das leuchtende Urbild genuin christlicher Hoffnung. Es ist eine Hoffnung für den ganzen Menschen. Auch das Fleisch wird gerettet. Aber es ist eine Hoffnung nicht durch Versinnlichung von unten und nach unten, sondern durch Verklärung und Verherrlichung von oben und nach oben. Diese Hoffnung gilt, weil Jesus Christus von den Toten erweckt wurde. Er ist der Anfang und der bleibende Grund. In Maria wird deutlich, daß diese Hoffnung für uns alle fruchtbar wird und daß sie die Vollendung des ganzen Menschen einschließt. So ist Maria Urbild für die Hoffnung aller Christen.
III. Für uns gekreuzigt
1. Der Weg Jesu ans Kreuz
1.1 Wie kam es zum Tod Jesu am Kreuz?
Seit den Tagen des Neuen Testaments gilt das Kreuz als das Zeichen des Heils. Schon bei der Taufe werden wir mit dem Zeichen des Kreuzes bezeichnet; im Zeichen des Kreuzes erhalten wir immer wieder den Segen Gottes, mit ihm bezeichnen wir uns selbst. Das Kreuz ist das christliche Symbol, das wir öffentlich und privat aufstellen. Im Kreuz kommt nämlich die Herablassung Gottes, die in der Menschwerdung Jesu Christi und in seiner Geburt durch Maria begonnen hat, zu ihrem Ziel. Deshalb ist für Paulus das Wort vom Kreuz die Zusammenfassung der ganzen christlichen Heilsbotschaft. Paulus will nichts anderes "wissen außer Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten" (1 Kor 2,2).
Über allen diesen Aussagen dürfen wir freilich den Anstoß des Kreuzes nicht vergessen. Das Heilszeichen des Kreuzes ist zugleich ein Zeichen des Widerspruchs, das sehr viele Fragen aufgibt. Solche Fragen begegnen uns, wenn uns das Kreuz persönlich trifft: in schwerer Krankheit, unheilbarem Leiden, großen Enttäuschungen, Mißerfolgen und Schicksalsschlägen, in Unglück, Katastrophen und in der Begegnung mit dem Tod. Auch das einmalige Kreuz Jesu ist ein schweres Problem. Warum hat Gott gerade diesen Weg der Erlösung gewählt und den unschuldigsten aller Menschen, seinen eigenen Sohn, dem grausamen Tod am Kreuz preisgegeben? Ist Gott so rachsüchtig und grausam, daß er einen "Sündenbock" braucht? Das Kreuz konfrontiert uns also erneut mit der Gottesfrage. Doch damit nicht genug. Vielen ist es auch eine schwere Frage, wie dieses einmalige Leiden und Sterben Jesu uns in unserem Leiden und Sterben, in unserer Schuld erlösen kann. Was heißt das eigentlich: Wir sind erlöst?
Fragen wir zunächst: Wie konnte es, historisch gesehen, zur Hinrichtung eines Mannes kommen, der nichts anderes als die Liebe Gottes verkündete und zur Liebe unter den Menschen aufrief, der Kranke heilte, Arme und Verzweifelte aufrichtete, dabei aber Aufruhr und Gewalt verurteilte? Historisch lassen sich im Kräftespiel gesellschaftlicher Gruppen und politischer Strömungen genügend Gründe nennen, um die Beseitigung eines unbequemen Volksführers und lästigen Mahners begreiflich zu machen. Auch Johannes der Täufer hatte das Schicksal nicht weniger Gottesmänner und Propheten in Israel geteilt. Jesus geriet mit seiner Zuwendung zu unterdrückten Klassen, seiner Kritik an pharisäischer Gesetzesübung und sadduzäischer Tempelverwaltung, durch sein offenes Wort und sein provozierendes Verhalten in Konflikt mit den herrschenden und einflußreichen Kreisen seines Volkes. Doch auch die Menge des Volkes, die ihm als Arzt und Wundertäter zuströmte und seinen Predigten begierig zuhörte, drang nicht zu einem klaren und entschiedenen Glauben vor.
Der Verlauf und die Hintergründe des Prozesses Jesu vor dem Hohen Rat sind historisch nicht klar durchschaubar. Offensichtlich hat einer aus dem engeren Jüngerkreis Jesu, Judas Iskariot, Jesus gegen Geld den Hohenpriestern verraten. Wahrscheinlich haben die politisch einflußreichen Kreise des sadduzäischen Priesteradels dann die Auslieferung an das Gericht des wegen seiner rigorosen und provozierenden Amtsführung den Juden aufs äußerste verhaßten römischen Prokurators Pontius Pilatus betrieben. Der Ausgang des Prozesses ist durch den von allen Evangelien bezeugten überlieferten Kreuzestitel "König der Juden" (Mk 15,26 par.) eindeutig. Während Jesus vom Hohen Rat aus religiösen Gründen verurteilt wurde, ließ ihn Pontius Pilatus als politischen Rebellen am Kreuz hinrichten. Dieses Zusammenspiel zeigt, daß man im Urteil über die "Schuld" der Juden zurückhaltend sein muß. Auf keinen Fall ist das ganze jüdische Volk für die Verwerfung Jesu verantwortlich zu machen, und auch die damaligen jüdischen Autoritäten tragen nicht die Alleinschuld. Jüdische und römische Autoritäten haben Jesus gemeinsam zu Fall gebracht.
Jesus selbst mußte, zumal ihm das Schicksal Johannes des Täufers vor Augen stand, bei der wachsenden Feindschaft der maßgebenden Kreise mit seinem gewaltsamen Tod rechnen. Nach den Evangelien hat er seinen Tod vorausgesehen und in drei Leidensweissagungen als von Gott gewollten Heilstod gedeutet (vgl. Mk 8,31; 9,31; 10,33-34). In diese Leidensweissagungen ist jedoch bereits die Deutung der urkirchlichen Überlieferung eingegangen. Aber es gibt in anderen Sprüchen und Reden Jesu (vgl. Mk 10,38-39; 12,1-8; Lk 12,50; 13,32-33) mancherlei Andeutungen, die eine Todesahnung Jesu nahelegen. Im Zusammenhang des Letzten Abendmahls ist ein Wort Jesu überliefert, das seine Todesgewißheit ebenso zeigt wie seine ungebrochene Überzeugung vom Kommen des Gottesreiches: "Amen, ich sage euch: Ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich von neuem davon trinke im Reich Gottes" (Mk 14,25; vgl. Lk 22,16.18). Dieses Wort zeigt, daß Jesus seinen Tod trotz aller menschlichen Erschütterung nicht als anonymes Schicksal, sondern als Willen seines Vaters angenommen hat: "Abba, Vater..., nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen" (Mk 14,36). Auch wenn, ja gerade wenn Jesus bei seinem Gang ins Leiden und in den Tod die verborgenen Gedanken Gottes noch nicht klar enthüllt waren - auch das gehört zu seiner Selbsterniedrigung -, hat er doch auch noch in diesem Dunkel den Willen des Vaters bejaht: "Obwohl er der Sohn war, hat er durch Leiden den Gehorsam gelernt; zur Vollendung gelangt, ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden" (Hebr 5,8-9).
Es gibt nichts Menschenunwürdiges, das Jesus auf dem Weg des Kreuzes nicht erfahren hätte: grundlose Verhaftung, Verrat aus dem eigenen Kreis, Flucht der engsten Freunde, unmenschliche Verhöre und grausame Folterungen, falsche Anklagen, Meineide, politisches Herumschachern auf dem Rücken eines Unschuldigen und Wehrlosen, Verspottung, Verurteilung als Verbrecher und Krimineller, Verurteilung zum Tod, physischer Zusammenbruch unter dem Kreuz, Lästerungen, gaffende Sensationslüsternheit, Erfahrung der Gottverlassenheit. Hier gilt: "Ecce homo!" "Seht, da ist der Mensch" (Joh 19,5). Seht, was bringen Menschen alles fertig, und was können und müssen Menschen alles leiden!
1.2 Hat Jesus seinen Tod als Heilstod verstanden?
Wichtig für das Verständnis Jesu von seiner Person und von seiner Sendung ist vor allem die Frage, ob und wie Jesus selbst seinem Tod eine Heilsbedeutung beigemessen hat. Diese Frage läßt sich historisch nur schwer beantworten. In alle Überlieferungen sind bereits Deutungen der Urgemeinde mit eingeflossen. Es gibt jedoch schon rein historisch gute Gründe dafür, daß Jesus im Gehorsam gegen seinen Vater bis zum Ende seinen Dienst für die Menschen durchgehalten hat. Von besonderer Bedeutung sind das Abendmahlsgeschehen und die Geschehen deutenden Worte. Zwar sind uns die Deuteworte Jesu nicht einheitlich überliefert; aber sie lassen sich nicht als bloße Rückübertragung aus der Eucharistiefeier in der Urgemeinde erklären. In allen Überlieferungsformen wird vom "Bund" (vgl. Mk 14,24; Mt 26,28) oder von dem "Neuen Bund" (vgl. Lk 22,20; 1 Kor 11,25) gesprochen, den Jesus durch sein Blut begründet. In allen Texten steht auch das wichtige und beziehungsreiche Wort von der Hingabe "für euch" oder "für viele", d. h. im Sprachgebrauch der Heiligen Schrift: "für alle". "Viele" bedeutet die Gesamtheit, für die sich der eine hingibt (vgl. Jes 53,11). Die Abendmahlsworte werden von besonderen Gesten des Mitteilens, des Verschenkens und der Hingabe begleitet. Das alles gibt einen Anhalt für die Überzeugung, daß Jesus seinen Tod als Heilstod verstanden hat und daß er über seinen Tod hinaus an die Jüngergemeinschaft gedacht und ihr ein Gedächtnis seines Todes eingestiftet hat, das zugleich die Verheißung des künftigen Gottesreiches enthielt.
So ergibt sich, daß die Botschaft vom Kommen des Heils der Gottesherrschaft in einem inneren Zusammenhang mit dem Glauben an die Heilsbedeutung des Todes Jesu am Kreuz steht. Denn Jesu Verkündigung von der Nähe, ja vom zeichenhaften Anbruch der Gottesherrschaft verlangt die Annahme des göttlichen Heilsangebots durch die Hörer. Mit der Ablehnung seiner Botschaft und der Verwerfung seiner Person war eine neue Situation eingetreten. Jesus nimmt sie im Gehorsam als seine vom Vater bestimmte "Stunde" an (vgl. Mk 14,35.41; Joh 12,23.27-28, 13,1; 17,1). Die Hartherzigkeit der Menschen vermag Gottes Heilspläne nicht umzustoßen. So eröffnet Gott mit der Hingabe seines Sohnes der Menschheit einen letzten Weg der Rettung.
Nur wenn man diesen äußersten Liebeserweis Gottes als Vollzug seiner strafenden Gerechtigkeit deutet und in Jesus nur den "Sündenbock" für die Menschheit versteht, entsteht eine unerträgliche Spannung zwischen dem Gott, den Jesus verkündigte, und jenem, der seinen Tod zum Heil der Menschheit wollte. Aber eine solche Deutung verfehlt den tiefen Sinn, der im Sterben des Einen für die Vielen liegt: der äußerste Erweis der Liebe Gottes. "Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, daß er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat" (Joh 3,16; vgl. Röm 8,32).
2. Die Heilsbedeutung des Todes Jesu am Kreuz
2.1 Gottes Heilswille
Der schändliche Tod Jesu am Kreuz war für jüdische Menschen ein Gottesgericht, ja ein Fluch (vgl. Gal 3,13), für die Römer eine Schmach und, wie nicht wenige Zeugnisse belegen, ein Grund zu Verachtung und Spott. Paulus schreibt:
- "Die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wir dagegen verkündigen Christus als den Gekreuzigten: für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit." (1 Kor 1,22-23)
Es war deshalb eine schwierige Aufgabe für die urchristliche Verkündigung, mit diesem Skandal des Kreuzes Christi fertigzuwerden. Doch die Urkirche erinnerte sich an Jesu eigene Worte beim Letzten Abendmahl; im Licht der Auferweckung Jesu durch Gott wurde ihr vollends bewußt, daß dieser so anstößige Tod Jesu zwar auf der vordergründigen Ebene der Geschichte durch den Unglauben und die Feindschaft von Menschen bewirkt wurde, daß dahinter aber Gottes Wille, Gottes Heilsplan, ja Gottes Liebe steht. Sie erkannte im Weg Jesu durch Leiden und Tod ein göttliches "Muß" (vgl. Mk 8,31; Lk 24,7.26.44), das bereits im Alten Testament vorgezeichnet ist. Deshalb heißt es bereits in einer der ältesten Überlieferungen des Neuen Testaments, die Paulus in seinen Gemeinden schon vorfand, als er sich bekehrte, Jesus Christus sei gemäß den Schriften für uns gestorben (vgl. 1 Kor 15,3).
Daraus ergaben sich verschiedene Ansätze, um den tieferen göttlichen Sinn des Todesgeschicks Jesu zu deuten: Nach einer frühen Deutung teilt Jesus das Los der Propheten, die von Israel abgelehnt und getötet worden waren (vgl. Lk 13,34; Mt 23,29-31.35). Darum erwartet ihn in Jerusalem, der Gottesstadt, der gewaltsame Tod, "denn ein Prophet darf nirgendwo anders als in Jerusalem umkommen" (Lk 13,33). Der alte, von Markus übernommene Passionsbericht schildert Jesus als den von den Menschen verfolgten unschuldig leidenden Gerechten; er sieht Jesu Schicksal in dem Leidenspsalm 22 vorgezeichnet. Von besonderer Bedeutung wurde das vierte Lied vom leidenden Gottesknecht im Jesajabuch (vgl. Jes 52,13-53,12), das vom Neuen Testament als auf Jesus Christus gerichtete Weissagung gedeutet wurde. So kann Paulus im Tod Jesu die unergründliche Liebe Gottes erkennen, der selbst seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns dahingegeben hat (vgl. Röm 8,32.39; Joh 3,16), um in ihm die Welt mit sich zu versöhnen (vgl. 2 Kor 5,18-19). Das Kreuz ist das Äußerste der sich selbst entäußernden Liebe Gottes.
2.2 Jesu stellvertretender Sühnetod
Der Hingabe Jesu durch Gott entspricht als Antwort Jesu eigene gehorsame Hingabe an den Willen des Vaters "für uns". Diese Deutung des Todes Jesu als stellvertretende Lebenshingabe führt uns in die innerste Mitte des neutestamentlichen Zeugnisses.
Dieser Gedanke ist freilich für uns zunächst nicht leicht nachvollziehbar. Deshalb ist es hilfreich, daran zu erinnern, daß der Stellvertretungsgedanke eine menschliche Grundgegebenheit, nämlich die solidarische Verbundenheit aller Menschen, aufgreift. Die Bibel nimmt diesen Gedanken auf und macht ihn in neuer Weise zu einem Grundgesetz der gesamten Heilsgeschichte: Adam handelt als Repräsentant der ganzen Menschheit und begründet die Solidarität aller in der Sünde, Abraham wird als Segen für alle Geschlechter berufen (vgl. Gen 12,3), Israel als Licht für die Völker (vgl. Jes 42,6). Die Heilige Schrift konkretisiert diese Idee durch den Gedanken vom stellvertretenden Leiden, der sich schon im vierten Gottesknechtlied findet.
- "Er hat unsere Krankheit getragen
- und unsere Schmerzen auf sich geladen...
- Er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen,
- wegen unserer Sünden zermalmt.
- Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm,
- durch seine Wunden sind wir geheilt...
- Denn er trug die Sünden von vielen
- und trat für die Schuldigen ein."
- (Jes 53,4-5.12)
Der für die Bibel so zentrale Stellvertretungsgedanke ist besonders geeignet, um im Glauben verständlich zu machen, wie der Tod Jesu für uns Heilsbedeutung haben konnte. Die Folge der Solidarität der Menschen in der Sünde war ja die Solidarität aller im Todesschicksal. Darin zeigt sich vor allem die heil- und hoffnungslose Situation des Menschen. Indem nun Jesus Christus, die Fülle des Lebens, mit uns im Tod solidarisch wird, macht er seinen Tod zur Grundlage einer neuen Solidarität. Sein Tod wird nun für alle, die unter dem Schicksal des Todes stehen, zur Quelle neuen Lebens.
Wie die Abendmahlsberichte zeigen, geht die Deutung des Todes Jesu als stellvertretendes Leiden und Sterben im Kern auf Jesus selbst zurück. Das zeigt auch das sehr alte Wort:
- "Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele." (Mk 10,45)
Die Deutung des Todes Jesu als stellvertretendes Leiden ist bereits in die älteste Gemeindeüberlieferung eingegangen (vgl. 1 Kor 15,3), und sie wird im Neuen Testament immer wieder aufgegriffen und vertieft (vgl. Joh 10,15; 1 Joh 4,10; 1 Petr 2,21-25, 1 Tim 2,6 u. a.). In besonderer Weise hat Paulus den Stellvertretungsgedanken aufgenommen und sogar von einem Platztausch zwischen Jesus Christus und uns gesprochen. Er geht so weit zu sagen, Jesus Christus sei für uns zum Fluch (vgl. Ga13,13), ja, er, der Sündlose, sei für uns zur Sünde gemacht worden, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden (vgl. 2 Kor 5,21).
- "Er, der reich war, wurde euretwegen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen." (2 Kor 8,9)
Dieser Gedanke vom "wunderbaren Tausch" wurde von den Kirchenvätern immer wieder aufgegriffen und variiert. Irenäus von Lyon sagt um das Jahr 200 von Jesus Christus: "der wegen seiner unendlichen Liebe das, was wir sind, geworden ist, damit er uns vollkommen zu dem mache, was er ist". Nach Irenäus hat Jesus Christus als der neue Adam das ganze Menschengeschlecht in sich zusammengefaßt und es wieder mit Gott vereinigt.
In diesem Zusammenhang sind auch die uns heute so schwer verständlichen Aussagen vom Kreuz als Sühne und Genugtuung zu verstehen. Im Hintergrund der Vorstellung vom Tod bzw. vom Blut Jesu als Sühnemittler für unsere Sünden (vgl. Röm 3,25; 1 Job 2,2; 4,10) steht wiederum die Vorstellung von einem großen solidarischen Ordnungszusammenhang des Volkes bzw. der ganzen Menschheit im Guten wie im Bösen. Weil die Sünde des einzelnen jeweils alle betrifft und die Ordnung des Volkes "vergiftet", bedarf jede Schuld des sühnenden Ausgleichs. Da sich die Sünde gegen Gott richtet, kann jedoch der Mensch selbst diesen Ausgleich nicht leisten. Dies kann, wie vor allem Anselm von Canterbury (11. Jh.) dargelegt hat, nur Gott selbst leisten. Gott ist es, der Versöhnung stiftet und so einen neuen Anfang setzt (vgl. 2 Kor 5,18). So führt das Sühnemotiv zurück zum Stellvertretungsgedanken und zum Motiv der erbarmenden Liebe Gottes. Frömmigkeitsgeschichtlich ist der Stellvertretungs- und Sühnegedanke vor allem in der Theologie des Martyriums und in der Herz-Jesu-Frömmigkeit wirksam geworden.
Ebenfalls schwer verständlich ist für uns heute die biblische Idee vom Opfertod Jesu. Davon spricht schon der Bericht von der Einsetzung des Abendmahls bei Matthäus und Markus, in dem er vom "Blut des Bundes" spricht (Mk 14,24; Mt 26,28). Für Paulus ist Jesus das geopferte Paschalamm (vgl. 1 Kor 5,7), für Johannes das Lamm Gottes, "das die Sünde der Welt hinwegnimmt" (Job 1,29). Wollen wir den tieferen Sinn des Opfergedankens verstehen, dann müssen wir uns klarmachen, daß es beim Opfer nichtprimär auf die äußeren Opfergaben ankommt. Die dargebrachten Opfergaben sind nur als Zeichen der personalen Opferhaltung sinnvoll; diese innere Haltung muß sich freilich äußern und verleiblichen. Bei Jesus wird die personale Selbsthingabe ganz eins mit der Opfergabe; sein Opfer ist ein Selbstopfer; er ist Opferpriester und Opfergabe in einem. So war sein Opfer das vollkommene Opfer, die Erfüllung aller anderen Opfer, die nur schattenhafte Vorausbilder dieses einen, ein für allemal dargebrachten Opfers sind (vgl. Hebr 9,11-28). Deshalb kann der Hebräerbrief sagen, daß es bei diesem Opfer nicht um eine äußere, dingliche Opfergabe geht, sondern um die Selbsthingabe Jesu im Gehorsam gegenüber dem Vater (vgl. Hebr 10,5-10). Durch diese stellvertretende Ganzhingabe wird die Gott entfremdete Menschheit wieder ganz eins mit Gott. So ist Jesus durch sein einmaliges Opfer der eine Mittler zwischen Gott und den Menschen (vgl. 1 Tim 2,5).
In allen diesen vielfältigen Aussagen geht es im Grunde um ein und dasselbe Thema. Sie wollen auf immer wieder neue Weise die zuvorkommende und rettende Liebe Gottes verkünden, die Jesus Christus durch seinen Gehorsam und durch seine Hingabe stellvertretend für uns ein für allemal ergriffen hat, um so Frieden zu stiften zwischen Gott und den Menschen wie zwischen den Menschen untereinander. So kann der Epheserbrief sagen: "Er ist unser Friede" (Eph 2,14). In ihm sind die Entfremdungen, welche die Sünde zwischen Gott und dem Menschen, zwischen den Menschen und im Menschen selbst verursacht hat, wieder geheilt und versöhnt. So ist das Kreuz schließlich Zeichen des Sieges über alle Gott und den Menschen feindlichen Mächte und Gewalten, ein Zeichen der Hoffnung.
2.3 Zeichen der Hoffnung
Die Botschaft vom Kreuz läßt sich nicht trennen von der Auferstehung und Erhöhung des Herrn. Das gilt besonders vom Johannesevangelium, wo die Erhöhung Jesu ans Kreuz zusammen gesehen wird mit seiner Erhöhung und Verherrlichung zur Rechten des Vaters. Kreuzigung, Erhöhung und Verherrlichung sind für Johannes also ein untrennbarer einheitlicher Vorgang (vgl. Joh 3,14; 12,34). Im Augenblick des Todes spricht Jesus das sieghafte "Es ist vollbracht" (Joh 19,30). So ist für Johannes das Kreuz zugleich das Gericht über die Welt und die widergöttlichen Mächte in der Welt (vgl. Joh 12,31). Das Kreuz deckt die Sünde, die Ungerechtigkeit und die Lüge auf und offenbart die größere Liebe, Gerechtigkeit und Wahrheit Gottes. Es ist Gottes Kraft und Weisheit. Durch das Kreuz hat Gott die Fürsten und Gewalten "entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt, durch Christus hat er über sie triumphiert" (Kol 2,15).
Zu diesem sieghaften Charakter des Kreuzes gehört auch das Verständnis des Kreuzestodes Jesu als Lösepreis (vgl. Mk 10,45; 1 Tim 2,6). Der Apostel Paulus sagt: Wir sind um einen teuren Preis erkauft worden (vgl. 1 Kor 6,20; 1 Petr 1,18-19). Damit wird der Tod Jesu als Befreiung aus der Sklaverei der Sünde (vgl. Röm 7, Joh 8,34-36), des Teufels (vgl. Joh 8,44; 1 Joh 3,8), der Weltmächte (vgl. Gal 4,3; Kol 2,20), des Gesetzes (vgl. Röm 7,1; Gal 3,13, 4,5) und vor allem des Todes (vgl. Röm 8,2) beschrieben. Die Freiheit von Mächten, die den Menschen so in Beschlag nehmen, daß sie ihn von seiner wirklichen Erfüllung abhalten, ist zugleich das Geschenk einer neuen Freiheit für Gott und für den Nächsten. Diese christliche Freiheit hat auch Konsequenzen für die politische und psychologische Befreiung; sie geht darin aber keineswegs auf. Die christliche Freiheit meint - wie Papst Paul VI. in seinem Apostolischen Schreiben über die Evangelisierung in der Welt von heute dargelegt hat - eine integrale Befreiung, die den ganzen Menschen in allen seinen Dimensionen umfaßt (vgl. EN 30-34). Eben deshalb ist sie kein rein diesseitiges Befreiungsprogramm. Sie ist vielmehr Befreiung durch Gott; denn ihr Ziel ist die Freiheit in Gott und in der Gemeinschaft mit ihm.
Die Karfreitagsliturgie bringt diesen sieghaften befreienden Charakter der Passion Jesu Christi dadurch zum Ausdruck, daß das Kreuz in feierlicher Prozession in die Kirche getragen, vor der Gemeinde erhoben und von ihr verehrt wird:
- "Seht das Kreuz, an dem der Herr gehangen,
- das Heil der Welt. Kommt, lasset uns anbeten!"
- (Gotteslob 204)
Als Zeichen des Sieges ist das Kreuz auch Zeichen der Hoffnung. Der aus dem 6. Jahrhundert stammende Kreuzeshymnus "Vexilla regis prodeunt" bringt diese Hoffnungsgewißheit zum Ausdruck:
- "Des Königs Fahne tritt hervor,
- das Kreuz steigt aus der Nacht empor,
- an dem das Leben für uns starb
- und Leben durch den Tod erwarb.
- O Kreuz, durch das uns Hoffnung sprießt,
- in deinem Sieg sei uns gegrüßt!
- Vermehr' dem Frommen Gottes Gnad'
- und tilg' der Sünder Missetat."
Der Sieg des Kreuzes, der Sieg der Liebe über den Haß, die Gewalt, der Wahrheit über die Lüge, des Lebens über den Tod ist freilich noch verborgen unter seinem Gegenteil. Noch herrschen in der Welt Haß, Lüge und Gewalt. Das neue Leben ist uns nur in der Gestalt des Kreuzes geschenkt. Die "Hoffnungsgeschichte, in der sich Jesus als der lebendige Sohn Gottes erweist, ist keine ungebrochene Erfolgsgeschichte, keine Siegergeschichte nach unseren Maßstäben" (Gern. Synode, Unsere Hoffnung 1,2). Nur auf dem Weg des Kreuzes ist uns der Sieg des Kreuzes verheißen. Denn gerade die Herablassung Gottes in die ganze Not menschlichen Leidens und Sterbens hat uns in dieser unserer konkreten Situation wieder mit Gott verbunden. So ist das Kreuz Zeichen der Hoffnung auf die endgültige Befreiung und den endgültigen Sieg Gottes. So beten wir bei der Kreuzwegandacht immer wieder:
- "Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst." (Gotteslob 775)
3. Christliches Leben im Zeichen des Kreuzes
Das Kreuz Jesu hat für das christliche Leben eine unmittelbar existentielle Bedeutung. Nachfolge Jesu ist nur als Kreuzesnachfolge möglich.
- "Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach." (Mk 8,34)
Durch die Taufe wird jeder Christ in das Todesleiden Christi hineingenommen, um einmal auch an seinem Leben Anteil zu erhalten (vgl. Röm 6,3-8). In der Feier der Eucharistie wird das Kreuz immer wieder vergegenwärtigt (vgl. 1 Kor 11,26). Das ganze Leben des Christen steht im Zeichen des Kreuzes.
- "Wohin wir auch kommen, immer tragen wir das Todesleiden Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird. Denn immer werden wir, obgleich wir leben, um Jesu willen dem Tod ausgeliefert, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar wird." (2 Kor 4,10-11)
Solche Kreuzesnachfolge kann vielfältige Gestalt annehmen: Verfolgung, Verleumdung, Armut, Gehorsam, selbstloser Dienst, innere und äußere Zucht, Trostlosigkeit und Trauer, Einsamkeit, Krankheit und Leiden, Sterben in seinen vielfältigen Formen.
Durch das Kreuz erhält auch die dunkelste Frage im Menschenleben, die Frage nach dem Sinn des Leidens und der Macht des Todes, eine Antwort. "Durch Christus und in Christus also wird das Rätsel von Schmerz und Tod hell, das außerhalb seines Evangeliums uns überwältigt" (GS 22). Es ist keine Antwort, die alle Dunkelheit rational auflichtet, keine höhere Harmonie und keine pauschale Gesamtlösung. Das Kreuz darf auch nicht als Mittel der Vertröstung mißbraucht werden. Das Mitleiden Gottes am Kreuz verpflichtet den Christen, die Last der anderen mitzutragen und sich aktiv einzusetzen, wo immer es menschenmöglich ist, Leid vermeidbar oder begrenzbar ist. Doch auch wenn wir alles getan haben, was in unseren Kräften steht, bleibt noch genug Leiden, das wir mit bestem Willen nicht verändern können. In dieser Situation vermag das Kreuz den Menschen in der Nacht des Leidens und Sterbens aufzurichten; im Blick auf den gekreuzigten Jesus darf er "gegen alle Hoffnung voll Hoffnung" sein (vgl. Röm 4,18). Denn nichts kann "uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn" (Röm 8,39).
Bei allem Wissen um den Sieg des Kreuzes darf der Christ nicht triumphalistisch werden und das bleibende Ärgernis des Kreuzes nicht vergessen. Gerade unserer Epoche liegt das "Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn" (Gotteslob 179) näher als das Kreuz als Siegeszeichen. Der Gekreuzigte bezeugt Gottes Liebe gerade für die Erniedrigten, Beleidigten, Unterdrückten, Hungernden, Vertriebenen, Gefolterten, für alle, die voll Angst sind und am Sinn ihres Lebens verzweifeln möchten. Die Seligpreisungen der Bergpredigt für die Armen, Trauernden, Gewaltlosen, nach Gerechtigkeit Hungernden (vgl. Mt 5,3-6; Lk 6,20-22) erfahren im Kreuz Jesu Christi ihre endgültige Bestätigung. In den Hungrigen, Fremden und Obdachlosen, Nackten, Kranken, Gefangenen ist der Gekreuzigte bleibend präsent (vgl. Mt 25,35-36.40). Diese Glaubensüberzeugung müßte uns Christen sensibel machen gegen die in unserer Gesellschaft wachsende Unempfindlichkeit gegenüber dem Leiden, gegen seine Verdrängung und Tabuisierung; sie sollte uns wieder leidens- und mitleidensfähig machen (vgl. Gem. Synode, Unsere Hoffnung I,2). So ist das Kreuz nicht nur Kurzformel und Symbol des ganzen Evangeliums, sondern auch Echtheitszeichen des christlichen Lebens.
4. Hinabgestiegen in das Reich des Todes
Der Glaubensartikel vom Hinabstieg Jesu Christi in das Reich des Todes gehört zu den weithin vergessenen Glaubenswahrheiten; er ist den meisten Christen unverständlich und fremd. Früher hieß es gar: "Abgestiegen zu der Hölle." In diesen Aussagen klingt ein für uns heute überholtes dreistöckiges Weltbild an, vielleicht sogar mythische Motive vom Abstieg von Göttern in die Unterwelt. Was sollen wir heute mit solchen Aussagen anfangen?
Wir kommen dem im Glaubensbekenntnis gemeinten Sinn näher, wenn wir sehen, daß der unmittelbare Hintergrund dieser Aussage die alttestamentliche Vorstellung vom Totenreich (scheol) darstellt. Dort führen die Abgeschiedenen nach damaliger Vorstellung ein Schattendasein. Ihre eigentliche Not ist, daß sie ausgeschlossen sind von Gott, daß sie in Gottferne und Gottverlassenheit leben (vgl. Ps 6,6; 88,11-13; 115,17). Wenn nun von Jesus gesagt wird, er sei in das Reich des Todes hinabgestiegen, dann heißt das nicht nur, daß er in unser allgemeinmenschliches Todesschicksal eingegangen ist, sondern daß er auch eingegangen ist in die ganze Verlassenheit und Einsamkeit des Todes, daß er die Erfahrung der Sinnlosigkeit, die Nacht und in diesem Sinn die Hölle des Menschseins auf sich genommen hat. Im Glaubensartikel vom Abstieg in das Reich des Todes geht es also nicht um ein vergangenes Weltbild, sondern in der Sprache des damaligen Weltbilds um eine bleibende Tiefendimension des Menschen, die nicht erst im Jenseits auf uns wartet, sondern schon mitten in diesem Leben anhebt.
Die kirchliche Tradition hat den Glaubensartikel vom Abstieg Jesu in das Reich des Todes mit der Aussage des 1. Petrusbriefes begründet: "So ist er auch zu den Geistern gegangen, die im Gefängnis waren, und hat ihnen gepredigt" (3,19; vgl. 4,6). Die Deutung dieses schwierigen Textes ist freilich umstritten. Ursprünglich war wohl nicht an eine Höllenfahrt, sondern an die Himmelfahrt gedacht. Die bösen Geister waren ja nach damaliger Vorstellung in der Luft zwischen Himmel und Erde angesiedelt. Sie wollen dem Menschen den Himmel verstellen und ihm das Leben zur Hölle machen. In diesem übertragenen Sinn hat die Deutung der kirchlichen Tradition durchaus ihr Recht. Durch seine Himmelfahrt hat Jesus die Hölle besiegt und uns den Weg zum Himmel, die Hoffnung wieder neu geschenkt. Schon früh hat man außerdem im Anschluß an die Aussagen im 1. Petrusbrief versucht, den Abstieg ins Totenreich und den Sieg über die bösen Mächte und Gewalten auszumalen. Man hat von einer Predigt Jesu in der [[ ]], von einem Aufbrechen der Pforten der Hölle, einem Höllenkampf zur Befreiung und Erlösung der Verstorbenen, von einem triumphalen Siegeszug Christi durch den Hades gesprochen. Das alles überschreitet die unmittelbaren Aussagemöglichkeiten des Glaubens. Dennoch haben diese Bilder einen tieferen Sinn. Denn gerade die äußerste Passion, die äußerste Nacht des Gehorsams und die letzte Solidarität Jesu mit den Toten in ihrer Verlassenheit und Einsamkeit, das Eingehen in die ganze Hölle des Menschseins bedeutet zugleich den Sieg Gottes über den Tod und die Mächte der Finsternis und des Todes.
So ist der Glaubensartikel vom Abstieg Jesu in das Reich des Todes Heilsbotschaft. Für die Ostkirche ist der österlich gedeutete Abstieg ins Totenreich sogar das zentrale Heilsereignis. Dieser Glaubensartikel besagt, daß in Jesu Tod Gottes Allmacht in die äußerste Ohnmacht einging, um so die Leere desTodes mit seinem Leben zu erfüllen und damit die Bande des Todes aufzusprengen. Der Glaubensartikel vom Abstieg Jesu in das Reich des Todes bringt damit nochmals zum Ausdruck, daß der Tod Jesu den Tod des Todes bewirkt und den österlichen Sieg des Lebens begründet hat. Die Solidarität Jesu mit dem allgemein-menschlichen Schicksal des Todes bringt außerdem die Universalität des Heils zum Ausdruck. In Jesu Tod sind auch die längst verstorbenen Generationen erlöst. Sein Heilstod gilt allen Leiden und Opfern der Geschichte. Durch ihn wird gerade den Kleinen und Ohnmächtigen, den längst Vergessenen, den vielen Namenlosen, deren Leid kein sozialer Fortschritt mehr versöhnt, Erlösung zuteil (vgl. Gem. Synode, Unsere Hoffnung I,3). So weist das Geheimnis des Karsamstags bereits voraus auf den österlichen Sieg des Lebens über den Tod und auf die Erhöhung des Gekreuzigten zum Herrn der Welt.
IV. Auferstanden - Aufgefahren in den Himmel
1. "Selig sind, die nicht sehen und doch glauben"
Mit dem gewaltsamen und schimpflichen Tod Jesu am Kreuz schien alles aus zu sein. Die Evangelien spiegeln, etwa in der Erzählung von den Emmausjüngern (vgl. Lk 24,13-35), noch die Enttäuschung und Resignation der Jünger, die meinten, nun alle ihre Hoffnungen begraben zu müssen. Denn Jesus hatte seine "Sache", das Kommen der Herrschaft Gottes, so sehr an seine Person gebunden, daß diese "Sache" nach seinem Tod nicht einfach weitergehen konnte. Man konnte nicht Jesu Ideen und Ideale weiterpflegen und weitertragen, so wie man die Ideen und Ideale des Sokrates nach dessen Tod weitergeführt hat. Das war einem Juden schon deshalb unmöglich, weil er das Kreuz als Gottes Gericht verstehen mußte. Dennoch nahm das Evangelium von Jesus Christus schon bald nach dem Karfreitag mit einer kaum mehr vorstellbaren Dynamik seinen Lauf durch die ganze damals bekannte Welt. Wie konnte es zu diesem Umschwung kommen? Wie kann man diesen kraftvollen, bis heute fortwirkenden Anfang des Christentums erklären?
Nach dem übereinstimmenden Zeugnis des Neuen Testaments hat dieser Neuanfang seinen Grund in der Auferweckung Jesu oder, was sachlich dasselbe meint, in seiner Auferstehung. Ohne die Auferstehung Jesu wäre, so sagt uns der Apostel Paulus, die Verkündigung leer und der Glaube sinnlos; dann wären wir mit unserer Hoffnung erbärmlicher daran als alle anderen Menschen (vgl. 1 Kor 15,14.19). Die Auferweckung Jesu ist also das Fundament und zusammen mit der Botschaft vom Kreuz das Zentrum des christlichen Glaubens.
Mit der Botschaft von der Auferstehung Jesu haben viele freilich auch Probleme. Diese Botschaft steht im Konflikt mit der Erfahrung der harten Wirklichkeit, vor allem der Wirklichkeit des Todes. Nichts scheint so endgültig zu sein wie der Tod. So stellten sich von Anfang an Fragen. Die Evangelien berichten uns von anfänglichen Zweifeln, von Unglauben und Starrsinn der Jünger Jesu. Besonders eindrucksvoll wird die Gestalt des "ungläubigen Thomas" beschrieben (vgl. Joh 20,24-29). Diese Berichte zeigen uns, daß Fragen und kritisches Nachforschen auch angesichts der Osterbotschaft ihr Recht haben. Jesus selbst spricht zu Thomas: "Selig sind, die nicht sehen und doch glauben" (Joh 20,29).
Schon in der Zeit des Neuen Testaments gab es Versuche, die Auferstehungsbotschaft und das leere Grab als Betrug der Jünger zu erklären (vgl. Mt 28,13). Seit der Aufklärung kam es neben der Betrugs- und Diebstahlshypothese zur Verwechslungs- und Scheintodhypothese. Oft wollte man den Osterglauben aus damaligen religiösen Ideen und Erwartungen ableiten (Evolutionshypothese) oder die Erscheinungen des Auferstandenen als rein subjektive Visionen (Halluzinationen) erklären. Doch alle diese rationalen "Erklärungen" schaffen angesichts des eindeutigen und übereinstimmenden Zeugnisses des Neuen Testaments mehr Probleme, als sie lösen. Im Unterschied zum Neuen Testament rechnen sie von vornherein nur mit weltimmanenten Ursachen. Damit verfehlen sie aber die Perspektive Jesu und der Heiligen Schrift. Heute sind diese Hypothesen in der seriösen Theologie praktisch aufgegeben.
Heute werden neue Fragen gestellt. Es wird gefragt, wie die Auferstehungsbotschaft zu verstehen ist. Ist sie ein "objektives" Geschehen in Raum und Zeit, aufgrund dessen der zuvor am Kreuz Gestorbene lebt? Doch wie lebt er? Keinesfalls kehrt der Auferstandene in das alte Leben zurück, sondern er lebt ein neues Leben aus Gottes Macht. Aber wie haben wir uns dieses neue Leben zu denken? Ist die Auferstehung nur ein Symbol bzw. eine Chiffre, welche die endgültige und bleibende Bedeutung des irdischen Jesus und seiner "Sache" zum Ausdruck bringen soll? Ist sie gar nur eine Chiffre für die Unzerstörbarkeit des Lebens und der Liebe? Aber wäre mit solchen Deutungen die biblische Botschaft von der Auferstehung nicht gänzlich entleert? Was meint also der Glaubensartikel von der Auferstehung Jesu?
Der zentrale und fundamentale Charakter der Botschaft von der Auferstehung einerseits, die Fragen, die sie aufgibt, andererseits veranlassen uns, zunächst einmal genau auf das Zeugnis der Heiligen Schrift von der Auferstehung Jesu und von den Erscheinungen des Auferstandenen vor seinen Jüngern zu hören. Von dorther können unsere Fragen eine Antwort finden.
2. Die biblischen Zeugnisse von der Auferstehung
2.1 Die frühen Auferstehungsbekenntnisse
Die Auferstehungsaussagen des Neuen Testaments zeichnen sich durch eine bemerkenswerte Zurückhaltung aus. Im Unterschied zu den späteren apokryphen Schriften und zu vielen künstlerischen Darstellungen kennt das Neue Testament keinerlei Beschreibung des Vorgangs der Auferstehung selbst. Es berichtet auch an keiner Stelle, daß irgendein Mensch die Auferstehung beobachtet hat. So liegt auf dem Vorgang der Auferstehung der Schleier eines undurchdringlichen Geheimnisses.
Im Neuen Testament finden sich zunächst teilweise sehr alte, bereits fest geprägte Bekenntnisformeln, die den Auferstehungsglauben bezeugen (vgl. Röm 1,3-4; 10,9; Phil 2,6-11; 1 Tim 3,16). Vielleicht ist uns bei Lukas bereits ein alter liturgischer Zuruf überliefert: "Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen" (24,34). Ein sehr frühes Zeugnis von der Auferstehung ist die von Paulus den Korinthern ins Gedächtnis gerufene, bereits vorpaulinische Glaubensformel
- "Christus ist für unsere Sünden gestorben,
- gemäß der Schrift,
- und ist begraben worden.
- Er ist am dritten Tag auferweckt worden,
- gemäß der Schrift,
- und erschien dem Kephas, dann den Zwölf."
- (1 Kor 15,3-5)
Nach diesem alten, rhythmisch gegliederten Bekenntnis handelt es sich bei der Auferweckung Jesu um eine völlig einmalige Tat Gottes an dem am Kreuz gestorbenen Jesus Christus. Deshalb gebraucht das Neue Testament neben dem uns geläufigen Wort Auferstehung oft den Begriff Auferweckung. Die Passivformulierung "auferweckt worden" ist in der Heiligen Schrift die Umschreibung des den Menschen geheimnishaften Handelns Gottes, das sich jeder bildhaften Vergegenständlichung und begrifflichen Fixierung entzieht.
In dieser einmaligen und geheimnishaften Tat Gottes am Gekreuzigten sind Glaube und Geschichte aufs engste miteinander verbunden. Der irdische und gekreuzigte Jesus steht mitten in der Geschichte; auch die Zeugnisse der Apostel von den Erscheinungen des Auferstandenen sind geschichtliche Größen. Die Auferweckung Jesu als Machttat Gottes dagegen ist zwar durch seinen Tod geschichtlich fixiert, sie überschreitet aber den menschlich-geschichtlichen Erfahrungshorizont. Sie meint, daß der zuvor gekreuzigte Jesus von Nazaret durch Gottes Tat in seiner Leiblichkeit in die Herrlichkeit Gottes aufgenommen wurde, daß er bei Gott lebt. Damit ist die Auferstehung kein "historisches Ereignis" im üblichen Verständnis, d. h. ein Ereignis, das allgemein nachprüfbar, mit anderen Ereignissen vergleichbar, in den Gang der Geschichte eingeordnet und der Vernunft begreiflich gemacht werden könnte. Es ist freilich unaufgebbar für den christlichen Glauben, daß Jesu Auferweckung in Zeit und Geschichte geschehen ist. Sie ist dabei unterschieden von den Wundern, die Jesus während seines irdischen Lebens gewirkt hat. Der Auferstandene kehrt ja nicht (wie etwa der Jüngling von Naïn oder das Töchterchen des Jaïirus in diese Welt und in dieses Leben zurück; er geht vielmehr in die nicht mit den Sinnen wahrnehmbare, zeitüberlegene Welt Gottes ein. So ist die Auferstehung ein im Raum der Geschichte erfolgtes, an der geschichtlichen Person Jesu von Nazaret sich vollziehendes, deren eigene Geschichte vollendendes und die Vollendung aller Geschichte einleitendes Geschehen, das grundsätzlich nur im Glauben zugänglich ist, weil es nur durch Gott möglich ist.
Diese eigentümliche Verschränkung von Glaube und Geschichte zeigt sich vor allem in der Bekenntnisaussage von der Auferstehung "am dritten Tag". Für das Alte Testament ist der dritte Tag der Tag der Wende zum Besseren und zum Heil (vgl. bes. Hos 6,2; Jona 2,1). Nach dem Judentum läßt Gott die Gerechten niemals länger als drei Tage in Not. Diese Heilshoffnung ist in Jesus Christus in einem ganz ungewöhnlichen Maß erfüllt. Denn hier geschieht die Wende nicht innerhalb der Geschichte. So wird der ganze Ernst des Endes und des Scheiterns im Tod gewahrt. Aber es wird zugleich gesagt, daß sich eben in der letzten Ausweglosigkeit Gottes Macht und Treue bewährten und eine absolute Wende bewirkt haben. Indem der Tod durch den Tod besiegt wurde, ist in der Geschichte etwas alle Geschichte Überschreitendes geschehen.
Woher nimmt der Glaube diese Gewißheit? Die Glaubensgewißheit von der Auferstehung Jesu ist nach der zitierten Bekenntnisformel darin begründet, daß der Auferstandene vor von Gott erwählten Zeugen erschienen ist oder, wie man deutlicher übersetzen muß: "sich ihnen sichtbar machte", "sich ihnen offenbarte" (vgl. 1 Kor 9,1; Gal 1,16). Wieder gibt uns das Neue Testament keinerlei Beschreibung des konkreten Vorgangs der Erscheinung. Das Wie der Erscheinungen tritt völlig in den Hintergrund gegenüber dem Wesentlichen, daß es sich nämlich um personale Begegnungen und um Offenbarungsvorgänge handelt, in denen sich der von Gott zum neuen Leben erweckte, in Gottes Herrlichkeit und Herrschaft eingesetzte Herr seinen Jüngern erschloß. Die mannigfachen Versuche, diese österlichen Erfahrungen rein natürlich und rein vernunftgemäß zu deuten und zu erklären, scheitern am klaren Zeugnis des Neuen Testaments. Die Erfahrungen der Jünger, für die sie nach sprachlichem Ausdruck suchen mußten, werden nämlich nur verständlich, wenn ihnen vom auferstandenen Herrn her eine Erschließungserfahrung zuteil wurde, in der sie Jesus, wie sie ihn aus seinem irdischen Leben kannten, in einer neuen Seinsweise wiedererkannten. Auch Paulus versteht seine Begegnung mit Christus vor Damaskus als ihn überwältigende, ihm gnadenhaft geschenkte Offenbarung des auferweckten, lebendigen, bei Gott weilenden Herrn (vgl. Gal 1,15-16; 1 Kor 9,1; 15,8-10; Phil 3,12). Er verkündigt nichts anderes als jene Männer, denen die ersten Erscheinungen zuteil wurden (vgl. 1 Kor 15,11).
So bringen die Erscheinungen des Auferstandenen ein Doppeltes zum Ausdruck: Der Auferstandene erscheint in die Welt hinein und nimmt damit die Jünger konkret in Anspruch. Aber er ist nicht mehr von dieser Welt; er erscheint in Gottes Herrlichkeit und bezeugt damit, daß Gott auf seiner Seite steht und daß er selbst in Gottes Herrschaft eingesetzt wurde. Indem der Gekreuzigte sich so als der Sieger über den Tod bekundet, erweist er sich als der Kyrios, als der Herr, mit dessen Verherrlichung die Botschaft vom Kommen der Herrschaft Gottes endgültig bekräftigt wurde.
2.2 Die Ostererzählungen der Evangelien
Neben den knappen Osterbekenntnissen kennt das Neue Testament ausführlichere Ostererzählungen. Sie bilden den Abschluß der vier Evangelien. Während Markus nur von der Auffindung des leeren Grabes durch die zum Grab eilenden Frauen und von der Verkündigung des Engels berichtet (vgl. Mk 16,1-8), Enden sich in den anderen Evangelien auch Erscheinungsberichte. Diese weichen aber sowohl in den Ortsangaben, bei der Nennung der Personen wie in den erzählerischen Einzelzügen nicht unerheblich voneinander ab. Diese Unterschiede müssen nach der literarischen Art dieser Erzählungen und nach der Zielsetzung der einzelnen Evangelisten beurteilt werden. Diese Erzählungen bezeugen nämlich den gemeinsamen Osterglauben der Gemeinden, indem sie ihn bereits gegenüber Zweiflern und Gegnern verteidigen und im Blick auf das Leben der Gemeinden in der Gegenwart des Herrn entfalten. Vor allem die Erscheinungen des Auferstandenen bei Mahlgemeinschaften (vgl. Lk 24, 30.41-42; Joh 21,5.12-13) zeigen den Zusammenhang mit den urchristlichen Eucharistiefeiern. In ihrer Unterschiedlichkeit und Vielschichtigkeit stellen diese Erzählungen also die grundlegende gemeinsame Botschaft von der Auferstehung des Gekreuzigten nicht in Frage, sie bestätigen und bekräftigen diese vielmehr. Im Chor der Zeugen erfährt die Urkirche die Gewißheit der Auferstehung des Herrn und seiner bleibenden Gegenwart.
Eine eigene Überlieferung ist die vom Grabbesuch der Frauen am ersten Wochentag und vom Auffinden des leeren Grabes (vgl. Mk 16,1-8 par.). Trotz mancher kritischer Fragen besteht kein Grund, an der historischen Tatsache des leeren Grabes zu zweifeln. So findet sich denn auch im damaligen Judentum nirgends ein Versuch, diese Tatsache als solche zu bestreiten. Freilich ist das Leersein des Grabes und das Fehlen des Leichnams als solches, historisch gesehen, kein Beweis für die Auferstehung. Der kritischen Vernunft stehen vielmehr verschiedene Deutungsmöglichkeiten offen (Diebstahl, Betrug, Verlegung, Verwechslung u. a.). Für die Urkirche war das leere Grab denn auch nicht der Grund des Osterglaubens, wohl aber ein hinweisendes und bestätigendes Zeichen für die Osterbotschaft. Nur in Verbindung mit den Selbstoffenbarungen des Auferstandenen wird das leere Grab zum sprechenden Zeugnis dafür, daß der Gekreuzigte auferweckt und auch in seiner Leiblichkeit in die Herrlichkeit Gottes eingegangen ist. Daraus erwuchs schon früh die Verehrung des heiligen Grabes, das, an glaubwürdiger Stätte gelegen, ständig an die Auferstehung Jesu Christi erinnert.
Sowohl die teilweise etwas drastischen Erzählungen vom Essen mit dem Auferstandenen wie die Berichte vom leeren Grab sollen zeichenhaft die Leiblichkeit der Auferstehung Jesu zum Ausdruck bringen. Freilich machen die Erzählungen auch deutlich, daß es sich um eine Leiblichkeit besonderer Art handelt. Sie ist ganz vergeistigt und verklärt durch die Herrlichkeit Gottes und dennoch ganz real. Es ist verständlich, daß hier die Ostererzählungen von der Sache her notwendig in vielfacher Hinsicht schwebend bleiben. Es handelt sich ja um Grenzaussagen, die etwas im Grunde nicht mehr Aussagbares in Worte fassen. Deshalb sind sie von einer eigentümlichen Spannung durchzogen: Einerseits ist der auferstandene Herr seinen Jüngern nahe, und doch entzieht er sich ihnen immer wieder. Diese eigenartige Mischung von Fremdheit und Vertrautheit bringt zum Ausdruck, daß im Ostergeschehen die dem Menschen absolut verborgene Herrlichkeit Gottes, in deren Geheimnis die Auferstehung sich ereignet, in die raum-zeitliche Geschichtswelt hereinbricht als Verheißung und als Hoffnung auf deren künftige Verklärung.
2.3 Die Zeugen der Auferstehung
Die Erscheinungen des Auferstandenen sind nicht rein private Erlebnisse der Apostel, sondern stets verbunden mit der Sendung zum vollmächtigen missionarischen Zeugnis. Sie erlauben deshalb kein distanziertes und neutrales, nur "objektives" und allgemeines Betrachten, sondern fordern Glauben und Zeugenschaft. Am großartigsten ist in dieser Hinsicht der Bericht des Matthäusevangeliums von der Erscheinung des Auferstandenen auf einem Berg in Galiläa:
- "Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern, und macht alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiß: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt." (Mt 28,18-20)
Durch die Erscheinungen des Auferstandenen und durch die damit verbundene Sendung werden die Apostel zum Fundament des Glaubens der Kirche und zu den maßgeblichen Autoritäten für die Kirche aller Zeiten bestellt. Deshalb ist es von Bedeutung, daß jeweils Kephas bzw. Simon Petrus an erster Stelle genannt wird (vgl. 1 Kor 15,5; Lk 24,34; Joh 20,3-8; 21,15-19); er ist der Urzeuge des Auferstehungsglaubens.
Die Erscheinungen des Auferstandenen haben also auch eine kirchenbegründende Bedeutung. Sie zeigen, daß die Kirche von Anfang an und von ihrem Wesen her apostolisch ist. Denn es gibt zum Zentrum der christlichen Verkündigung, zur Botschaft vom Tod und von der Auferstehung Jesu keinen anderen Zugang als das Zeugnis derer, denen sich der Auferstandene in seiner neuen Wirklichkeitsweise erschlossen hat. Ihr Zeugnis erhält dadurch Überzeugungskraft, daß alle Erst- und Urzeugen bereit waren, für ihre Botschaft in den Tod zu gehen und so ihr Glaubenszeugnis mit dem Blut zu besiegeln. Dennoch erspart dieses Zeugnis niemandem die Antwort eines wagenden Glaubens, der, wie der Apostel, das Risiko des Lebens eingeht in der Hoffnung auf das in der Auferstehung Jesu Christi angebrochene neue Leben. Gerade vom Osterglauben gilt das Wort des Auferstandenen: "Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!" (Joh 20,29).
3. Die Bedeutung der Auferstehung
3.1 Erfüllung der Hoffnung
Bereits das älteste Zeugnis der Auferstehung deutet deren tieferen Sinn an. Es sagt: "Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift" (1 Kor 15,4). Damit ist gesagt, daß die Auferstehung Jesu die Erfüllung der Verheißungen des Alten Testaments, die Erfüllung der Hoffnung Israels ist. Von Anfang an war Gott für Israel der lebendige Gott, der Herr über Leben und Tod (vgl. Num 27,16) und die "Quelle des Lebens" (Ps 36,10). Bei ihm ist deshalb Hoffnung, daß er das Leben nicht endgültig dem Tode preisgibt.
- "Denn du gibst mich nicht der Unterwelt preis,
- du läßt deinen Frommen das Grab nicht schauen.
- Du zeigst mir den Pfad zum Leben.
- Vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle,
- zu deiner Rechten Wonne für alle Zeit."
- (Ps 16,10-11)
- "Ich aber bleibe immer bei dir,
- du hältst mich an meiner Rechten.
- Du leitest mich nach deinem Ratschluß
- und nimmst mich am Ende auf in Herrlichkeit."
- (Ps 73,23-24)
Diese Hoffnung bleibt im Alten Testament zunächst noch unbestimmt und offen. Erst im späteren Alten Testament, in einer Zeit der Unterdrückung, der blutigen Verfolgung und des Martyriums verdichtet sich diese Hoffnung zu der Erwartung der Auferweckung der Toten am Ende der Zeit (vgl. Dan 12,1-2; 2 Makk 7,9.11.14.22-23.29). Wenn deshalb das Neue Testament die für einen Juden unerhörte Aussage macht, Gott habe Jesus schon jetzt von den Toten auferweckt, dann sagt es damit: Die Endzeit ist angebrochen. Gott hat in Jesus Christus die Hoffnung endgültig wahr gemacht. Er hat damit auch die Botschaft Jesu vom Kommen der Herrschaft Gottes bestätigt. Jesu Tod war nicht ein sinnloses Ende, sondern der endgültige Anfang. In ihm hat die neue Schöpfung begonnen.
In der Liturgie der Osternacht wird die Botschaft von der Auferstehung Jesu als Erfüllung der Hoffnung nicht nur Israels, sondern der ganzen Schöpfung breit entfaltet. In der ersten Lesung erinnert die Liturgie an die erste Schöpfung. So wie Gott dort das, was nicht ist, ins Dasein ruft (vgl. Röm 4,17), so ruft er in der neuen Schöpfung die Toten zum neuen Leben. In der Auferweckung Jesu steht also Gott zu seiner Schöpfung; er gibt dem Leben recht gegenüber dem Tod. In der zweiten Lesung wird die Auferstehung als Erfüllung der Heilsgeschichte, die mit der Berufung Abrahams begonnen hat, verkündet. In der dritten Lesung erscheint die Auferstehung als Erfüllung der Befreiung Israels aus Ägypten, der Durchgang durch das Rote Meer ist Vorausbild des Durchgangs Jesu durch den Tod zum Leben. Deshalb heißt es im Osterlob (Exsultet): "Dies ist die Nacht, die unsere Väter, die Söhne Israels, aus Ägypten befreit und auf trockenem Pfad durch die Fluten des Roten Meeres geführt hat." Schließlich deuten die weiteren Lesungen Ostern als die Erfüllung der prophetischen Verheißung auf die Erneuerung des auserwählten Volkes Israel durch ein neues Herz und einen neuen Geist.
Von der Auferstehung aus wendet sich der Blick jedoch nicht nur zurück, sondern noch mehr nach vorne. Jesus Christus ist ja der erste der Entschlafenen, derer, die zum neuen Leben erweckt werden (vgl. Apg 26,23; 1 Kor 15,20; Kol 1,18). In ihm ist die Zukunft neu und endgültig erschlossen und für alle endgültig Hoffnung aufgerichtet. Seine Auferstehung ist die Gewähr, daß am Ende das Leben über den Tod, die Wahrheit über die Lüge, die Gerechtigkeit über das Unrecht, die Liebe über den Haß und selbst über den Tod siegen wird. Die Auferstehung Jesu Christi ist der Grund für die Hoffnung auf unsere eigene Auferstehung zum ewigen Leben (vgl. Röm 6,5 1 Kor 15,12-22; Phil 3,11; 2 Tim 2,11). Diese Hoffnung betrifft nicht nur die Seele und den Geist des Menschen, sie ist Hoffnung auf eine Umgestaltung und Verwandlung auch unseres Leibes und des gesamten Kosmos. Nichts ist ausgenommen von dieser Hoffnung - allein das Böse. So besagt diese Hoffnung, daß auch das Wollen und das Tun des Menschen, wenn es aus Liebe geschieht, auch wenn es in der Geschichte scheitert, bleibend eingestiftet ist in die endgültige Wirklichkeit der neuen Schöpfung (vgl. GS 39).
3.2 Die Auferstehung Jesu als Offenbarung Gottes
Wenn das Neue Testament von der Auferweckung Jesu spricht, dann charakterisiert es diese immer als Machttat Gottes. Durch die Auferweckung Jesu offenbart Gott sich endgültig als Herr über Leben und Tod, der alles in der Hand hält, dem alles gehört, auf den unbedingter Verlaß ist im Leben und im Sterben. Schon das Alte Testament sagt:
- "Der Herr macht tot und lebendig,
- er führt zum Totenreich hinab
- und führt auch herauf." (1 Sam 2,6)
So kann Paulus im Anschluß an das Judentum Gott definieren als "Gott, der die Toten lebendig macht" (Röm 4,17; vgl. 2 Kor 1,9). Die Formel "Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat" (vgl. Röm 4,24; 8,11; 2 Kor 4,14; Gal 1,1 u.a.) wird geradezu zur neutestamentlichen Wesensdefinition Gottes. So wird in der Auferweckung Jesu endgültig und unüberbietbar offenbar, wer Gott ist: derjenige, dessen Macht Leben und Tod, Sein und Nichtsein umgreift, der lebendige Gott, der Leben ist und Leben schenkt, der schöpferische Liebe und Treue ist, auf den deshalb noch im Zerbrechen aller menschlichen Möglichkeiten unbedingter Verlaß ist.
Der Glaube an die Auferweckung Jesu ist deshalb kein Zusatz zum Glauben, sondern der Inbegriff des Glaubens an Gott, die alles umfassende Macht des Lebens. In der Entscheidung für oder gegen den Osterglauben geht es letztlich darum, ob man meint, aus seinen eigenen Möglichkeiten und denen der Welt leben zu können, oder ob man es wagt, sich im Leben und Sterben ganz auf Gott einzulassen, ganz von Gott her und auf ihn hin zu leben. Im Osterglauben geht es um die Grundentscheidung über die Ausrichtung und den Sinn des Daseins überhaupt, um die Frage, ob man mit dem Gottsein Gottes Ernst machen will. Paulus hat die Existenz aus der Kraft des Auferstehungsglaubens eindrucksvoll beschrieben:
- "Von allen Seiten werden wir in die Enge getrieben und finden doch noch Raum; wir wissen weder aus noch ein und verzweifeln dennoch nicht; wir werden gehetzt und sind doch nicht verlassen; wir werden niedergestreckt und doch nicht vernichtet. Wohin wir auch kommen, immer tragen wir das Todesleiden Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird. Denn immer werden wir, obgleich wir leben, um Jesu willen dem Tod ausgeliefert, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar wird." (2 Kor 4,8-11)
So ist der Apostel selbst in seinen apostolischen Mühen ein Aufleuchten (Epiphanie) der Wirklichkeit von Tod und Auferstehung Jesu Christi; wie er soll jeder Christ in seinem Leben, Wirken und Sterben Tod und Auferstehung Jesu Christi zum Ausdruck bringen. Er soll nach dem streben, was im Himmel ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt; er soll seinen Sinn auf das Himmlische und nicht auf das Irdische richten (vgl. Kol 3,1-2). Das bedeutet, wie der Apostel Paulus selbst am besten zeigt, keine Geringschätzung der irdischen Güter oder ein Nachlassen im Einsatz für die Sache Gottes in dieser Welt. Es geht vielmehr darum, das Irdische auf die endgültige Zukunft auszurichten und aus der Hoffnung auf das Himmlische Kraft zu schöpfen für das Leben und Wirken in der Welt.
3.3 Die Auferstehung Jesu als Offenbarung und Verherrlichung Jesu Christi
Die Evangelien lassen immer wieder durchblicken, daß Jesus während seines irdischen Lebens nicht nur beim Volk, sondern auch bei seinen Jüngern auf Unverständnis stieß. Trotz aller besonderen und aufsehenerregenden Züge seines Wirkens, in denen das Einzigartige seiner Person und seiner Sendung her vortrat, war ihnen sein Geheimnis noch verborgen. Erst die Osteroffenbarungen führten sie zur klaren Erkenntnis und zur vollen Gewißheit, daß er der verheißene Messias, der Sohn Gottes, das Heil nicht nur für Israel, sondern auch für die Heiden ist. Die Evangelien sind bereits im Licht dieses Osterglaubens geschrieben und verbinden den Bericht von Jesu Worten und Taten mit der gläubigen Deutung.
Durch die Auferweckung hat Gott die Botschaft und den Anspruch Jesu bestätigt. Die Auferweckung Jesu, als Machttat Gottes verstanden, beseitigte vor allem den für die Juden sonst unüberwindlichen Anstoß, daß der am Kreuz Getötete der verheißene Messias, der Christus Gottes sein soll. Der von den Führern seines Volkes Verworfene und von den Menschen Hingerichtete wird durch die Auferweckung als der Unschuldige und Gerechte (vgl. Apg 3,14-15) und als der in seine messianische Machtstellung eingesetzte Davidssohn erwiesen:
- "Der dem Fleisch nach geboren ist als Nachkomme Davids, der dem Geist der Heiligkeit nach eingesetzt ist als Sohn Gottes in Macht seit der Auferstehung von den Toten..." (Röm 1,3-4).
So wurde Jesus durch die Auferstehung zum herrscherlichen Messias, wenn auch in einem anderen Sinn, als es die Juden erwarteten. Das Kreuz war damit zwar nicht aller Anstößigkeit entzogen, es wurde aber einbezogen in Gottes Heilsplan (vgl. Mk 8,31; 1 Kor 2,7-9).
Mit der Auferstehung tritt auch das Verhältnis Jesu zu Gott in volles Licht. Wenn Jesus schon in seinem irdischen Leben seine einzigartige, unmittelbare Beziehung zu Gott, seinem Vater, ahnen läßt, geht den Jüngern am Auferstandenen, bei Gott weilenden und mit göttlicher Macht bekleideten Christus dieses Geheimnis der Gottessohnschaft vollends auf. Paulus ist es unumstößliche Gewißheit, daß Gott ihm vor Damaskus "seinen Sohn offenbarte" (Gal 1,16). Der zuvor ungläubig zweifelnde Thomas fällt, als er dem Auferstandenen begegnet, auf die Knie und sagt: "Mein Herr und mein Gott!" (Joh 20,28).
Alle Hoheitstitel und Würdenamen, mit denen die Urkirche ihren Glauben an die Person Jesu Christi zum Ausdruck brachte (Messias, Herr, Gottessohn, Gottesknecht u. a.), schöpfen ihre Kraft und gewinnen ihren Sinn aus dem Glauben an seine Auferstehung. Sie ist der schöpferische Quellgrund der sich entfaltenden Christologie. Diese will nicht nur sagen, wer der irdische Jesus in der Vergangenheit war, ihr geht es vielmehr immer auch und sogar zuerst um den gegenwärtigen, erhöhten Herrn.
4. Aufgefahren in den Himmel
4.1 Erhöhung und Himmelfahrt
Die Bestätigung Jesu und seine Einsetzung in göttliche Machtstellung drückt das Neue Testament hauptsächlich mit dem Begriff Erhöhung und erhöhen aus. Es knüpft dabei an den von der Urkirche messianisch interpretierten Psalm 110 an: "Setze dich mir zur Rechten, und ich lege dir deine Feinde als Schemel unter die Füße" (Ps 110,1). Die Botschaft, Jesus Christus sei zur Rechten Gottes erhöht worden, findet sich bereits in der "Pfingstpredigt" des Petrus (vgl. Apg 2,34), sie durchzieht das ganze Neue Testament (vgl. Apg 5,31; 7,56, Röm 8,34; Eph 1,20 u. a.). Die Aussage, daß Jesus den Ehrenplatz neben Gott erhalten hat, ist selbstverständlich bildlich gemeint. Es soll damit gesagt werden, daß Jesus Anteil erhalten hat an der Herrlichkeit, Herrschaft, Macht und Göttlichkeit Gottes. Er ist nun "der Herr" bzw. "unser Herr" (vgl. 1 Kor 1,9; 6,17 u. a.). Die Erhöhung bedeutet also die Einsetzung Jesu in Gott-gleiche Machtstellung. Bereits in dem alten Christuslied des Philipperbriefes heißt es
- "Darum hat ihn Gott über alle erhöht
- und ihm den Namen verliehen,
- der größer ist als alle Namen,
- damit alle im Himmel,
- auf der Erde und unter der Erde
- ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu
- und jeder Mund bekennt:
- ,Jesus Christus ist der Herr' -
- zur Ehre Gottes, des Vaters." (Phil 2,9-11)
Nach diesem Lied ist Jesus durch seine Erhöhung der Kosmokrator, der Weltenherrscher über Tote und Lebende (vgl. Röm 14,9). Ihm als dem Pantokrator ist alles, Himmel und Erde, auch die widergöttlichen Mächte und Gewalten, unterworfen. Auch wenn seine Herrschaft jetzt unter den Kämpfen und Bedrängnissen dieser Zeit noch verborgen ist, noch verdeckt durch das Böse in der Welt, ist sie doch unaufhaltbar. Christus "muß herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter die Füße gelegt hat" (1 Kor 15,25). In der Offenbarung des Johannes wird er darum schon jetzt "König der Könige und Herr der Herren" genannt (Offb 19,16).
Sachlich dasselbe meint Lukas mit der Himmelfahrt Jesu (vgl. Lk 24,50-51; Apg 1,9-10). Sie darf selbstverständlich nicht nach Art einer Weltraumfahrt verstanden werden. Die Wolke, die Jesus den Blicken der Jünger entzieht, ist schon im Alten Testament ein Symbol der machtvollen Erscheinung und Gegenwart Gottes. Gemeint ist also, daß Jesus in die raum- und zeitübersteigende Welt Gottes, in die Herrlichkeit Gottes eingegangen ist. Die Himmelfahrt erfolgt nach Lukas im Rahmen einer letzten Erscheinung des Auferstandenen, der bereits in die himmlische Welt eingegangen ist (vgl. Lk 24,26). Damit stellt die Himmelfahrt wie die Erhöhung kein von der Auferweckung gelöstes Geschehen dar, sondern hebt nur einen besonderen Aspekt hervor. Sie ist die letzte Erscheinung des Auferstandenen und macht den Jüngern deutlich bewußt, daß Jesus die Seinen mit seiner unmittelbar erfahrbaren Gegenwart verlassen hat (vgl. Lk 24,51), aber einst wiederkommen wird (vgl. Apg 1,11). Sie macht freilich auch deutlich, daß Jesus, indem er in die Herrlichkeit Gottes eingegangen ist, seinen Jüngern in neuer Weise, in der Weise Gottes, nahe ist. Jesus ist nun von Gott her und in der Weise Gottes bleibend mit uns.
Nach der Darstellung des Lukas liegen zwischen der Auferstehung und der Himmelfahrt Jesu Christi 40 Tage. Die Zahl 40 bezeichnet nach dem Sprachgebrauch der Heiligen Schrift eine besonders heilige Zeit: 40 Jahre wanderte das Volk Israel durch die Wüste, 40 Tage weilte Mose auf dem Sinai "vor Gott", 40 Tage war Elija unterwegs zum Berg Horeb, 40 Tage wurde Jesus in der Wüste erprobt. Die 40 Tage nach Ostern sind die Zeit, da der Erhöhte seinen Jüngern noch leibhaftig erschienen ist. Mit der Himmelfahrt hat nun eine neue Zeit begonnen: die Zeit der Kirche. In ihr ist der zu Gott Heimgekehrte den Seinen auf eine neue Weise nahe, indem er ihnen vom Vater her den Heiligen Geist sendet (vgl. Apg 2,4-5) und sie durch ihn mit der Kraft ausrüstet, sein Werk auf Erden weiter zuführen (vgl. Apg 1,8). Mit der heilsgeschichtlichen Aufeinanderfolge der Ereignisse von Auferweckung, Himmelfahrt und Geistausgießung will Lukas die Kontinuität der Zeit Jesu und der Zeit der Kirche ausdrücken. In den 40 Tagen überlappen sich sozusagen beide Zeiten. Damit ist die Zeit der Kirche mit der Zeit, da Jesus sichtbar auf Erden weilte, verklammert. So ist die Himmelfahrt Jesu Christi weniger ein Abschluß als ein neuer Anfang. Sie leitet die Zeit ein, in der Jesus Christus, der erhöhte Herr, durch seinen Geist sein Werk in der Kirche und in der Geschichte weiterführt.
4.2 Die Herrschaft Jesu Christi
Die Herrschaft des zur Rechten des Vaters erhöhten Jesus Christus wird in der Heiligen Schrift und in der kirchlichen Glaubensüberlieferung in vielfacher Weise beschrieben. In neuerer Zeit hat sich die Lehre vom dreifachen Amt, vom prophetischen, priesterlichen und königlichen Amt Jesu Christi eingebürgert.
1. Das prophetische Amt Jesu Christi. Im Neuen Testament wird Jesus öfter als der im Alten Testament verheißene Prophet (vgl. Dtn 18,15) bezeichnet (vgl. Apg 3,22; Joh 1,45; 6,14). Ebenso wird er oft Lehrer genannt (vgl. Mk 10,17 u. a.). Das vierte Evangelium nennt ihn das Licht der Welt (vgl. Joh 1,8; 8,12; 12,46), die Wahrheit (vgl. 14,6). Dazu ist er in die Welt gekommen, daß er für die Wahrheit Zeugnis ablegt (vgl. 18,37). So ist er die endgültige Wahrheit über Gott, den Menschen und die Welt, er ist unter den vielen Irrlichtern und Blendwerken in der Welt das Licht, das uns die Menschen und die Dinge unverstellt sehen läßt und uns in der Verfinsterung und Verblendung, die Folge der Sünde und Zeichen der Unheilssituation des Menschen sind, den Sinn unseres Daseins, den Sinn auch des Leidens und des Sterbens erschließt. Als der Prophet ist Jesus Christus der Schlüssel zum Verständnis des Menschen; ohne Jesus Christus kann der Mensch sich selbst und seine Welt nicht voll begreifen. In Jesus Christus offenbart Gott "dem Menschen den Menschen" (GS 22). Nicht umsonst wird Jesus Christus in der Liturgie von Weihnachten und Epiphanie als das aufgehende Licht der Sonne, letztlich als Weltensonnenwende gefeiert. Die Liturgie der Osternacht begrüßt Jesus Christus im Symbol der Osterkerze mit dem dreifachen Ruf: "Lumen Christi" - "Christus, das Licht!"
Das prophetische Amt Jesu Christi kommt in der Verkündigung der Kirche zur Geltung. Im Wort der Verkündigung ist der erhöhte Herr bleibend unter uns gegenwärtig. Aus diesem Grund wird bei festlichen Gottesdiensten das Evangelienbuch feierlich hereingetragen und verehrt. Die Gegenwart Jesu Christi im Wort beschränkt sich freilich nicht auf die gottesdienstliche Verkündigung, auch nicht auf die amtliche Verkündigung der Kirche. Jesus Christus ist überall gegenwärtig, wo sein Evangelium in Wort oder Tat bezeugt wird, wo immer seine Wahrheit im alltäglichen Familien- und Gesellschaftsleben zur Geltung kommt (vgl. LG 35).
2. Das priesterliche Amt Jesu Christi. Schon das Neue Testament deutet die Hingabe Jesu an den Willen des Vaters und seinen stellvertretenden Dienst für uns als einen priesterlichen Dienst. Vor allem der Hebräerbrief beschreibt das Kreuz als ein für allemal dargebrachtes Opfer, durch das der erhöhte Christus "Priester auf ewig" (Hehr 7,17.21. vgl. 23-24) ist. Er lebt nun allezeit, um für die Seinigen einzutreten (vgl. Hebr 7,25). Durch sein Opfer hat er ein für allemal Gott und die Menschen wie die Menschen untereinander versöhnt und uns das neue Leben geschenkt. Damit ist das durch die Sünde sich selbst entfremdete, in vielfacher Weise beschädigte Leben wieder heil geworden. Die durch Jesus Christus geschenkte Erfüllung des Lebens besteht freilich nicht in egoistischer Selbstverwirklichung, sondern in der sich selbst entäußernden Liebe. Dieser Sinn des Lebens wird schon im natürlichen Leben angedeutet. Denn alles, was lebt, lebt nur im Übergang in ein anderes; das Lebendige muß aus sich herausgehen, um sich zu erhalten. "Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht" (Joh 12,24). So gilt vollends vom neuen Leben in Jesus Christus: "Wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben... verliert, wird es retten" (Mk 8,35).
Als Hoherpriester ist Jesus Christus vor allem in der Feier der Eucharistie gegenwärtig. Schon in den Ostergeschichten der Evangelien geschieht die Erscheinung des Auferstandenen imZusammenhang von Mahlfeiern (vgl. Lk 24,30-31.36-42; Joh 21,9-14). Darüber hinaus ist die ganze Liturgie Vollzug des Priesteramtes Jesu Christi (vgl. SC 7). In allen Sakramenten ist Jesus Christus der eigentliche Liturge und der eigentliche Spender. Das Priestertum Jesu Christi verwirklicht sich nicht nur im Weihepriestertum, sondern auch im gemeinsamen Priestertum aller Christen, im Dienst der Laien, die durch ihr Gebet, ihren apostolischen Einsatz, ihr Ehe- und Familienleben, die tägliche Arbeit, die geistige und körperliche Erholung, wenn sie im Geist getan werden, durch die Lasten des Lebens, wenn sie geduldig ertragen werden, Gott "geistige Opfer" darbringen (1 Petr 2,5; vgl. Röm 12,1; LG 34).
3. Das königliche Amt Jesu Christi. In der alten Welt galt der König als Repräsentant Gottes, ja als Sohn Gottes; er repräsentierte die kosmische und politische Ordnung, innerhalb derer allein ein erfülltes menschliches Leben möglich war. Der König, das Reich, die Stadt, der Staat waren daher von alters her nicht nur politische Begriffe, sondern auch religiöse Hoffnungssymbole. Die alttestamentliche und neutestamentliche Botschaft von der Königsherrschaft Gottes greift diese Hoffnung auf. Da die Herrschaft Gottes in Jesus Christus, in seinem Kreuz und in seiner Erhöhung anbricht, kann Jesus Christus im Neuen Testament auch als König bezeichnet werden. Doch so wie er der Kreuzesmessias ist, so ist er auch der König am Kreuz (vgl. Mk 15,2.18.26; Joh 19,14-15.19-22). Das wird vor allem in der Szene deutlich, wo Jesus, von der grölenden Volksmenge verspottet, geschlagen, gedemütigt, blutüberströmt, mit der Dornenkrone auf dem Haupt, von Pilatus gefragt wird: "Bist du der König der Juden?" Jesus bejaht diese Frage, aber er fügt sogleich hinzu: "Mein Königtum ist nicht von dieser Welt." Sein Königtum besteht darin, daß er für die Wahrheit Zeugnis ablegt und die Menschen in der Wahrheit sammelt (vgl. Joh 18,33-37). Allein in diesem Sinn ist er "der König der Könige und der Herr der Herren" (1 Tim 6,15, vgl. Offb 19,6).
Aus dem Königtum Jesu Christi folgt also kein theokratisches Reich, sei es in der Kirche, sei es im Staat oder in der Gesellschaft. Die Königsherrschaft Jesu Christi ist keine innerweltliche Utopie oder Ideologie. Sie ist freilich auch keine rein innerliche, keine rein geistliche Größe und kein rein privat verstandenes Heil. Vielmehr will Jesus Christus mit seinem Geist, mit seiner Wahrheit und seinem Leben alles durchdringen, den privaten wie den öffentlichen Bereich, die Welt der Familie wie die Welt der Arbeit und der Freizeit. Die Herrschaft Christi wird deshalb entsprechend dem II. Vatikanischen Konzil überall dort verwirklicht, wo Menschen die königliche Freiheit der Söhne und Töchter Gottes verwirklichen, wo sie durch Selbstverleugnung und durch ein heiliges Leben das Reich der Sünde in sich besiegen, wo sie ihren Leib nicht mehr von der Sünde beherrschen lassen, sondern ihre Glieder "als Waffen der Gerechtigkeit in den Dienst Gottes" stellen (Röm 6,13). So ist das Reich Christi ein Reich der Heiligkeit und der Gnade, ein Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens (Präfation des Christkönigsfestes). Indem die Christen alle Bereiche der Welt "gemäß der Ordnung des Schöpfers und im Lichte seines Wortes durch menschliche Arbeit, Technik und Kultur zum Nutzen wirklich aller Menschen" entwickeln, "wird Christus durch die Glieder der Kirche die ganze menschliche Gesellschaft mehr und mehr mit seinem heilsamen Licht erleuchten" (LG 36).
Das Reich Gottes bzw. das Reich Christi und das Reich der Welt lassen sich also nicht äußerlich trennen; beide Größen sind sowohl in der Kirche wie in der Gesellschaft und im Staat miteinander vermischt. Der hl. Augustinus hat in seinem berühmten Buch "Über den Gottesstaat" gezeigt, daß die beiden Reiche durch zwei Weisen der Liebe unterschieden sind: Selbstliebe und Gottesliebe, Leben nach dem Fleisch und Leben nach dem Geist. Wo immer also selbstlose Liebe geschieht, sei es innerhalb der Kirche, sei es auch außerhalb der Kirche, da bricht Christi Reich schon jetzt an. Die Kirche soll Sakrament, d. h. Zeichen und Werkzeug der Einheit der Menschen mit Gott und untereinander sein (vgl. LG 1). Die Aufgabe der Christen und aller Menschen guten Willens ist es deshalb, auf eine universale Zivilisation der Liebe hinzuwirken (Paul VI.).
5. Er wird wiederkommen in Herrlichkeit
Mit der Auferstehung und Erhöhung Jesu Christi hat die neue Welt und die neue Menschheit ein für allemal begonnen. Aber das Reich Christi steht noch im Kampf mit den Mächten des Bösen. Deshalb schließt das Christusbekenntnis der Kirche mit einem Ausblick der Hoffnung auf die endgültige Vollendung der Herrschaft Jesu Christi: "Er wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten."
Dieses Bekenntnis zur Wiederkunft Jesu Christi und zum endzeitlichen Gericht wirft für uns heutige Menschen wiederum viele Fragen auf. Wie können wir uns das angesichts unseres heutigen evolutiven Weltbilds vorstellen? Können wir uns darunter überhaupt noch etwas vorstellen? Wir können in diesem Zusammenhang noch nicht auf diese Fragen eingehen und müssen an späterer Stelle, wo ausführlich von der endzeitlichen Hoffnung die Rede sein wird, auf sie zurückkommen. In diesem Zusammenhang geht es nur um die Frage, was die im Glaubensbekenntnis formulierte Hoffnung hier und heute bedeutet und welche Kraft sie besitzt, unser jetziges Leben und unsere gegenwärtige Welt zu verwandeln.
Mit dieser Fragestellung treffen wir auch die Intention des Neuen Testaments. Denn die Heilige Schrift ist nicht besonders interessiert an irgendwelchen Spekulationen über das Wann, Wo und Wie der Wiederkunft Jesu Christi. Im Gegenteil, sie weist solche Spekulationen zurück. Denn "jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater" (Mk 13,32). Es geht also nicht um Belehrung über eine nahe oder ferne Zukunft, sondern um die Entscheidung im Hier und Heute angesichts dieser Zukunft. "Seht euch also vor, und bleibt wach! Denn ihr wißt nicht, wann die Zeit da ist" (Mk 13,33). Die künftige Gerichtsentscheidung fällt im Grunde schon jetzt:
- "Denn wer sich vor dieser treulosen und sündigen Generation meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Hoheit seines Vaters kommt." (Mk 8,38; vgl. Joh 5,24)
Nicht nur das irdische Leben und Wirken Jesu, auch die Himmelfahrt und Erhöhung Jesu Christi stehen in diesem Zukunftshorizont. Die Zeit der Kirche, die mit der Himmelfahrt beginnt, ist begrenzt durch die Wiederkunft Jesu Christi in Herrlichkeit (vgl. Apg 1,11). So haben die Apostel den Auftrag, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen:
- "Das ist der von Gott eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten." (Apg 10,42)
Diese und viele andere Aussagen des Neuen Testaments (vgl. Apg 17,31; Röm 14,9; 2 Tim 4,1; 1 Petr 4,5) werden zusammengefaßt durch die Aussage im Großen Glaubensbekenntnis: "Er wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten." Damit ist ausgesagt, daß die Herrschaft Christi, der Sieg des Lebens und der Liebe, die mit der Auferstehung und Erhöhung verborgen begonnen hat, endgültig ist und am Ende allgemein offenbar werden wird. Dann wird auch unsere Hoffnung auf das ewige Leben und die Auferstehung von den Toten in Erfüllung gehen.
Die Wiederkunft Jesu Christi und die Unterwerfung aller gottwidrigen Mächte und Gewalten dienen letztlich dem Ziel, daß Gott am Ende alles in allem sei (vgl. 1 Kor 15,28). Als im 4. Jahrhundert Marcell von Ankyra aus dieser Aussage die falsche Folgerung zog, Jesus Christus werde am Ende der Zeit seine menschliche Natur ablegen und in Gott zurückkehren, widersprach ihm das erste Konzil von Konstantinopel (381), indem es den Zusatz in das Glaubensbekenntnis aufnahm: "Seiner Herrschaft wird kein Ende sein". Jesus Christus ist ja das endgültige Ja und Amen Gottes zu allem, was Gott verheißen hat (vgl. 2 Kor 1,20), das Ja und Amen zum Menschen und zur Welt. So hat auch die Menschheit Jesu Christi eine endgültige Bedeutung in Gott und für Gott. Deshalb wird die Herrschaft Jesu Christi ewige Herrschaft sein (vgl. Lk 1,33).
Auch dieser Glaubensartikel hat eine eminent praktische Bedeutung. Das Bekenntnis zum endzeitlichen Gericht Gottes durch Jesus Christus widerspricht einerseits unseren Fortschritts- und Harmonieträumen, mit denen wir gern unsere Vorstellung vom Heil verbinden. Der Gerichtsgedanke sagt, daß am Ende nicht alles glatt aufgeht, am Ende stehen vielmehr die endgültige Scheidung des Guten vom Bösen, der Sieg des Guten und die Verurteilung des Bösen. Das macht den Ernst der Entscheidung im Heute aus. Auf der anderen Seite drückt sich im Gerichtsgedanken auch "ein verheißungsvoller Gedanke unserer christlichen Botschaft aus: nämlich der spezifisch christliche Gedanke von der Gleichheit aller Menschen, der nicht auf Gleichmacherei hinausläuft, sondern der die Gleichheit aller Menschen in ihrer praktischen Lebensverantwortung vor Gott hervorhebt, der aber auch allen, die Unrecht leiden, eine unverlierbare Hoffnung zusagt. Dieser christliche Gleichheitsgedanke ist auf Gerechtigkeit für alle aus und lähmt darum auch nicht das Interesse am geschichtlichen Kampf um Gerechtigkeit für alle, er weckt vielmehr immer neu das Verantwortungsbewußtsein für diese Gerechtigkeit. Wie anders sollten wir in seinem Gericht bestehen?" (Gem. Synode, Unsere Hoffnung 1,4).
Der hoffnungsvolle Blick nach vorn schärft also am Ende nochmals unseren Blick in die Gegenwart und auf unsere geschichtliche Verantwortung im Hier und Heute. Die Zukunft, die mit Jesus Christus endgültig begonnen hat, verwirklicht sich durch das Werk des Heiligen Geistes, der das Werk Jesu Christi in uns, in der Kirche und in der Welt gegenwärtig macht. Dies ist das Thema des dritten Teils des Glaubensbekenntnisses.
Dritter Teil: Das Werk des Heiligen Geistes
I. Das neue Leben im Heiligen Geist
1. Die Wirklichkeit des Heiligen Geistes
1.1 Sind wir erlöst?
Die frohe Botschaft von der Erlösung der Welt durch Jesus Christus scheint durch den unerlösten Zustand der Welt wie von selbst widerlegt zu werden. Was bleibt von dieser Botschaft angesichts von himmelschreiendem Unrecht, Lüge, Gewalt, Hunger und Folter? Was bleibt angesichts Einsamkeit, Sinnlosigkeit, Treulosigkeit, Krankheit, Schuld und Sterben? Was bleibt angesichts unserer eigenen fortdauernden Sündhaftigkeit? Ist unsere Welt nicht im eigentlichen Sinn des Wortes gnadenlos? Ist Jesus also vergeblich gestorben?
Diese Fragen sind nicht neu. Sie sind so alt wie das Christentum selbst. Die christliche Botschaft vom Heil der Welt mußte sich von allem Anfang an gegenüber zwei anderen Antworten zur Wehr setzen. Da war und ist zunächst die Antwort des Judentums. Es teilt mit dem Christentum die messianischen Verheißungen des Heils. Aber während das Judentum noch auf den Messias und die messianische Zeit hofft, verkündet das Christentum, daß in Jesus der Christus, d. h. der Messias, schon erschienen und das Heil der Welt schon angebrochen ist. Damit setzt sich das Christentum auch in Gegensatz zu einer der einflußreichsten Strömungen der alten Welt, zur Antwort der Gnosis, die in neuen Formen heute wieder aktuell ist. Der Gnosis geht es nicht um die Erlösung der Welt, sondern um Erlösung von der Welt. Der Gnostiker will "aussteigen" aus dem bösen System dieser Welt. Er flüchtet entweder in die reine Innerlichkeit, in die heile Natur oder durch mystische Ekstase in eine ganz andere Welt. Demgegenüber verkündet das Christentum, daß Gott diese Welt so sehr geliebt hat, daß er seinen einzigen Sohn hingab und in die Welt sandte, damit sie durch ihn gerettet werde (vgl. Joh 3,16-17).
Die christliche Botschaft ist also eine Botschaft von einem Heil, das nicht von dieser Welt, das aber doch das Heil der Welt ist (vgl. Joh 17,11.14.16.18). Das Christentum spricht einerseits von einem Heil, das nicht von dieser Welt ist. Es bezeugt Heil von Gott her. Allein Gott kann einen ganz neuen Anfang setzen; er allein kann auch die letzte Erfüllung des Menschen sein. Das Christentum bezeugt andererseits aber auch, daß dieses Heil in Jesus Christus ein für allemal in der Welt und für die Welt gegenwärtig ist. Doch wie kann diese Botschaft angesichts des Unheils in der Welt glaubwürdig bezeugt werden? Wo und wie begegnen wir der Wirklichkeit des Heils?
1.2 Der Heilige Geist als Wirklichkeit des Neuen Bundes
Auf die Frage nach der Wirklichkeit der Erlösung antwortet das kirchliche Glaubensbekenntnis im Anschluß an die Heilige Schrift: "Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht." Wie ist das gemeint?
Wie wir bereits gesehen haben, wird der Heilige Geist in der Heiligen Schrift als die schöpferische Macht allen Lebens verstanden. Er belebt alles, hält alles zusammen und lenkt allesauf das endzeitliche Heil hin. Er ist vor allem in Jesus Christus wirksam: in seiner Empfängnis, seiner Taufe, seinem öffentlichen Wirken, seinem Tod und seiner Auferweckung. In Tod, Auferweckung und Verherrlichung Jesu hat er den Anfang der neuen Schöpfung heraufgeführt. Sie wird einmal zur Vollendung kommen in der Verklärung der gesamten Wirklichkeit. So ist Jesus der Christus, d.h. der mit dem Heiligen Geist Gesalbte. Nach dem Lukasevangelium wendet Jesus die Verheißung des Propheten auf sich an: "Der Geist des Herrn ruht auf mir; denn der Herr hat mich gesalbt" (Lk 4,18; vgl. Apg 10,38; Joh 1,32). Unsere Erlösung und unser Heil bestehen darin, daß wir an der Geistfülle Jesu Christi teilhaben. Wir sind Christen, d. h. Gesalbte durch die Anteilhabe an der Geistsalbung Jesu Christi.
Diese Teilhabe an Jesus Christus wird uns durch den Heiligen Geist selbst geschenkt. Denn der Geist ist gesandt, um Jesus Christus, seine Person, sein Wort und sein Werk in der Geschichte immer wieder neu gegenwärtig zu machen. Dadurch wird alle Wirklichkeit vom Heiligen Geist, der der Geist Jesu Christi ist, durchdrungen. So kann Paulus sagen: "Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit" (2 Kor 3,17). Damit ist gesagt: Der Geist ist die wirksame Gegenwart und die gegenwärtige Wirksamkeit des erhöhten Herrn in der Kirche und in der Welt. Er ist jedoch nicht nur die Gabe des neuen Lebens in Jesus Christus, er ist auch der Geber dieser Gabe, eine eigene göttliche Person. Wo er wirkt, bricht das endzeitliche Reich der Freiheit schon jetzt an. Das im Glauben empfangene Geschenk des Heiligen Geistes ist die Wirklichkeit des neuen Bundes (Thomas von Aquin).
Was dies bedeutet, hat Lukas in seinem Bericht über die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten zum Ausdruck gebracht (vgl. Apg 2,1-13). Für die Juden war das Pfingstfest ursprünglich ein Erntefest; im 1./2. Jahrhundert n. Chr. wurde daraus ein Erinnerungstag an den Bundesschluß am Sinai. Daran knüpft Lukas an. Er will mit dem Bericht von der Ausgießung des Heiligen Geistes den Anbruch der endgültigen Heilszeit, die Erfüllung der prophetischen Verheißung (vgl. Joël 3,1-3) und der Ankündigung Jesu (vgl. Apg 1,8) darstellen. Dabei bedient er sich biblischer Bilder, die schon für Gotteserscheinungen im Alten Testament, besonders am Sinai, gebraucht werden. Das Brausen des Sturmes zeigt die Kraft des Heiligen Geistes, der der Atem und Sturm des neuen Lebens ist, an. Die Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen der Versammelten niederlassen, deuten an, daß die Jünger zum Zeugnisgeben befähigt und ermutigt werden. Das Reden und Verstehen in fremden Sprachen weist zusammen mit der Völkerliste darauf hin, daß mit der weltweiten Mission, die den Jüngern aufgetragen ist, der babylonischen Sprachverwirrung ein Ende bereitet und die zerrissene Menschheit nun wieder geeint wird. Auf dem Weg der Mission sollen die Völker zu dem einen Volk Gottes gesammelt werden. So geht an Pfingsten die Verheißung in Erfüllung, wonach der Geist Gottes am Ende der Zeit über alles Fleisch, über groß und klein, jung und alt, Juden und Heiden ausgegossen wird (vgl. Joël 3,1-2; Apg 2,17-18; 10,44-48).
Im einzelnen wird die Wirklichkeit und Wirksamkeit des Geistes im Neuen Testament vielfältig beschrieben. Nach der Apostelgeschichte ist der Geist vor allem in der Mission der Kirche wirksam. Er ist es, der die Kirche auf den Weg der Mission führt und ihr immer wieder neue Missionsfelder und Missionsaufgaben erschließt. Er begleitet diesen Weg mit auffälligen Wundertaten und mit außerordentlichen Charismen wie Glossolalie (Zungenreden) und Prophetie. Bei aller Betonung der Freiheit des Geistes kommt es Lukas aber auch darauf an, die Kontinuität in der Wirksamkeit des Geistes aufzuweisen; sie zeigt sich besonders in der brüderlichen Gemeinschaft der heidenchristlichen Gemeinden mit der Jerusalemer Urgemeinde.
Auch Paulus kennt außerordentliche Geistgaben. Der Nachdruck liegt bei ihm jedoch nicht auf den auffälligen Phänomenen, sondern auf dem alltäglichen christlichen Leben. Der Geist ist nicht sosehr die Kraft des Außerordentlichen als die Kraft, das Ordentliche in außerordentlicher Weise zu tun. Er erweist sich vor allem im Bekenntnis zu Jesus Christus (vgl. 1 Kor 12,3) und im Dienst zur Auferbauung der Gemeinde (vgl. 1 Kor 12-14). Paulus versteht den Geist aber auch als die treibende Kraft im Leben jedes Gläubigen. Sie sollen sich nicht vom Fleisch, sondern vom Geist leiten lassen (vgl. Gal 5, 16-17; Röm 8,12-13) und Früchte des Geistes hervorbringen: "Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung" (Gal 5,22-23). So wirkt der Geist eine doppelte Offenheit des Menschen: die Offenheit des Menschen für Gott, die sich vor allem im Gebet äußert (vgl. Gal 4,6; Röm 8,15-16.26-27), wie die Offenheit gegenüber dem Nächsten. Denn der selbstlose Dienst der Liebe ist die wahre christliche Freiheit (vgl. Gal 5,13). Darin zeichnet sich schon die Befreiung der Schöpfung von ihrer Vergänglichkeit und Knechtschaft ab, auf die sie harrt und hofft. Der Geist ist die Erstlingsgabe, die der christlichen Hoffnung einen sicheren Grund gibt (vgl. Röm 8,18-27).
Dieses vielfältige Zeugnis der Heiligen Schrift von der Wirklichkeit und Wirksamkeit des Heiligen Geistes läßt sich unter drei Gesichtspunkten zusammenfassen:
1. Der Heilige Geist, die Gabe und die Liebe Gottes in Person, erschließt uns die Wirklichkeit der Schöpfung. Bereits in der Schöpfung ist Gnade in einem weiteren Sinn wirksam. Deshalb ist für den gläubigen Menschen nichts einfachhin eine Selbstverständlichkeit; für ihn ist alles Gabe und Geschenk Gottes. Er kann auch in den unscheinbarsten und alltäglichsten Dingen, Begebenheiten und Begegnungen Spuren der Liebe Gottes und seines Geistes erfahren und dafür mit Freude und Dank erfüllt werden. Da der Geist alle Wirklichkeit auf ihre endgültige Vollendung hin ausrichtet, zeigt sich seine Wirklichkeit und Wirksamkeit vor allem dort, wo neues Leben geweckt wird, Wirklichkeit über sich hinausdrängt, vor allem im geschichtlichen Suchen und Streben der Menschen und Völker nach Leben, Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden. In besonderer Weise dürfen wir dort Spuren des Geistes erkennen, wo Menschen aus dem Gefängnis ihres Egoismus ausbrechen, in Liebe zueinanderfinden, einander vergeben und verzeihen, einander Gutes tun und helfen, ohne Gegenleistung zu erwarten oder gar zu fordern. Nicht in egoistischer Selbstverkrampfung, sondern im Geben, Schenken und Teilen findet der Mensch zu sich und zu seiner Erfüllung. Wo Liebe geschieht, da wird schon jetzt etwas von der endgültigen Vollendung und Verklärung der Welt vorweggenommen.
2. Seine tiefste Erfüllung findet der Mensch freilich erst dort, wo er als Person unbedingt und endgültig angenommen und bejaht ist. Solche absolute Liebe kann allein Gott schenken, und er schenkt sie, indem er sich selbst dem Menschen schenkt, ihn in seine Gemeinschaft und Freundschaft aufnimmt und ihn so im Heiligen Geist an seinem göttlichen Leben teilhaben läßt. Dadurch werden wir neue Schöpfung (vgl. 2 Kor 5,17; Gal 6,15). Wo dies geschieht, da sprechen wir von Gnade im eigentlichen Sinn des Wortes. Gnade ist also Freundschaft und Gemeinschaft mit Gott. Sie besteht darin, daß durch den Heiligen Geist Gottes Liebe in unsere Herzen ausgegossen ist (vgl. Röm 5,5; DS 1530; 1561; NR 801; 829). Die Heilige Schrift spricht sogar von der Einwohnung des Heiligen Geistes (vgl. 1 Kor 3,16; 6,19; 2 Kor 6,16), d. h. von seiner lebendigen Gegenwart in den Gläubigen. Durch die Einwohnung des Heiligen Geistes sind auch der Vater und der Sohn in uns gegenwärtig (vgl. Joh 14,23). Die Gnade bedeutet also, daß wir in das Leben und in die Liebe des dreifaltigen Gottes hineingenommen werden und daran teilhaben.
Diese Gottesfreundschaft wirkt sich in verschiedener Weise aus. Sie zeigt sich einmal im Menschen selbst. Der Heilige Geist heilt und heiligt ihn. Er heiligt ihn, indem er ihn mit Gott verbindet; dadurch macht er ihn zugleich heil und ganz; er bewirkt im Menschen Ordnung, Zucht und Maß. - Die Früchte des Geistes zeigen sich zum zweiten im mitmenschlichen Verhalten: in Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Versöhnlichkeit, Selbstlosigkeit, aber auch im Einsatz für die Gerechtigkeit, ohne welche die Liebe hohl und leer wäre. - Der Geist wirkt außerdem Freundschaft und Gemeinschaft mit Jesus Christus. "Im Geist" und "in Jesus Christus" sind für Paulus austauschbare Aussagen. Diese Gemeinschaft mit Jesus Christus zeigt sich konkret im Lesen und Betrachten der Heiligen Schrift, im Bemühen um die Nachfolge Jesu im Sinn der Bergpredigt, in der Christusgemeinschaft in den Sakramenten und nicht zuletzt im Dienst an den notleidenden Brüdern und Schwestern, in denen wir Jesus Christus selbst begegnen (vgl. Mt 25,34-45). Schließlich wirkt der Geist Freude an Gott, am Gottesdienst und am Gebet. Besonders im Gebet läßt uns der Heilige Geist unsere Gotteskindschaft erfahren. Denn nur im Heiligen Geist können wir rufen "Abba, Vater". "So bezeugt der Geist selber unserem Geist, daß wir Kinder Gottes sind" (Röm 8,15-16). Weil die Gemeinschaft mit Gott die tiefste Erfüllung des Menschen ist, wird nach der Erfahrung aller großen Christen, vor allem der Heiligen, derjenige, der sich dem Wirken des Geistes öffnet, mit tiefem inneren Frieden, mit Trost und Freude erfüllt.
3. Alle diese Wirkungen des Heiligen Geistes sind nur ein erster Anteil an der künftigen Herrlichkeit (vgl. 2 Kor 1,22; Eph 1,14). Sie sind nur Anfang und Vorwegnahme der endgültigen Vollendung. So ist der Geist die Macht der Hoffnung und die Kraft eines Lebens aus der Hoffnung. Aus diesem Grund gehört zur Erfahrung des Heiligen Geistes auch das Leiden an der noch unvollendeten Welt, das Leiden unter der Macht des Bösen in seinen vielfältigen Formen, Erfahrungen von Ungerechtigkeit, Ablehnung, Verfolgung, bis hin zum Martyrium, das auch heute für viele Christen in vielen Teilen der Welt eine konkrete Wirklichkeit darstellt. In solchen Situationen, die in der einen oder anderen Weise zu jedem Christenleben gehören, gibt uns der Geist die Kraft und ist er die Kraft zum Durchhalten und zum Widerstehen; er verleiht uns Tapferkeit und Großmut, damit wir uns allen Widerständen zum Trotz für Christus und sein Reich einsetzen. Er ist nicht zuletzt Kraft im Leiden und Sterben. Nicht zufällig wurden im Mittelalter viele Spitäler als Heilig-Geist-Spitäler bezeichnet. Das Kirchenlied faßt dies alles zusammen, indem es den Heiligen Geist als den Tröster bezeichnet: "Der du der Tröster wirst genannt" (Gotteslob 245). Diese vielfältige Heilswirksamkeit des Heiligen Geistes kommt in vielen Liedern zum Ausdruck. Besonders eindrucksvoll ist ein Gebet des hl. Augustinus:
- "Atme in mir,
- du Heiliger Geist,
- daß ich Heiliges denke.
- Treibe mich,
- du Heiliger Geist,
- daß ich Heiliges tue.
- Locke mich,
- du Heiliger Geist,
- daß ich Heiliges liebe.
- Stärke mich,
- du Heiliger Geist,
- daß ich Heiliges hüte.
- Hüte mich,
- du Heiliger Geist,
- daß ich das Heilige nimmer verliere."
Wenn wir alles zusammenfassen, dann können wir sagen: Der Heilige Geist erschließt uns unseren Ursprung in Gott und seiner Gnade, und er macht uns Hoffnung auf Gott und sein Reich. Er wirkt aber auch schon in unserem gegenwärtigen Leben heilend und heiligend, versöhnend und tröstend. Diesen Ausgang und diese Rückkehr aller Wirklichkeit von Gott und zu Gott müssen wir nun im einzelnen bedenken.
2. Gottes ewige Vorherbestimmung zum Heil
Die erste und für alles Weitere grundlegende Aussage über die Begnadung des Menschen lautet: Gott hat uns von aller Ewigkeit her erwählt, berufen und angenommen. Gott ist dem Menschen mit seiner helfenden Gnade je schon zuvorgekommen. Bevor wir nach Gott und seiner Gnade fragten, bevor wir uns auf den Weg zu ihm machten und uns durch ein gutes Leben seiner würdig zu erweisen suchten, ja, noch bevor wir überhaupt waren, hat Gott uns schon aus reiner Liebe auserwählt und für seine Gemeinschaft vorherbestimmt. Er hat uns, wie der Anfang des Epheserbriefes sagt, von aller Ewigkeit her "mit allem Segen seines Geistes gesegnet".
- "Denn in ihm - Jesus Christus - hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott; er hat uns aus Liebe im voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen, zum Lob seiner herrlichen Gnade." (Eph 1,4-6)
Diese Lehre von der Vorherbestimmung (Prädestination) scheint jedoch vielen ein besonders dunkles Kapitel zu sein. Sie sehen darin einen verwegenen Versuch, in das verborgene Geheimnis des Willens Gottes einzudringen. In Wirklichkeit handelt es sich um eine wesentliche Ausdrucksgestalt des Evangeliums, also um eine aufrichtende, tröstende, helfende, frohe Botschaft. Denn das Ziel dieser Lehre ist nicht ein vorwitziges Eindringen in das Geheimnis des Willens Gottes, sondern die Gewißheit, "daß Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt, bei denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind" (Röm 8,28), so daß nichts in dieser Welt uns trennen kann von der Liebe Gottes, die ist in Jesus Christus, unserem Herrn (vgl. Röm 8,39). Diese Botschaft kann ein letzter Halt sein in den Widerwärtigkeiten der Welt. Sie sagt, daß Gott in Jesus Christus von Ewigkeit her der Immanuel, der Gott mit uns und für uns ist.
Diese frohe Botschaft gilt grundsätzlich von allen Menschen. Gottes Heilswille ist universal. Gott "will, daß alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen" (1 Tim 2,4). Er will nicht den Tod des Sünders, sondern daß er umkehrt und am Leben bleibt (vgl. Ez 33,11; 2 Petr 3,9). Diese Universalität des göttlichen Heilswillens ist vom II. Vatikanischen Konzil nochmals mit Nachdruck zur Geltung gebracht worden
- "Wer nämlich das Evangelium Christi und seine Kirche^ohne Schuld nicht kennt, Gott aber aus ehrlichem Herzen sucht, seinen im Anruf des Gewissens erkannten Willen unter dem Einfluß der Gnade in der Tat zu erfüllen trachtet, kann das ewige Heil erlangen. Die göttliche Vorsehung verweigert auch denen das zum Heil Notwendige nicht, die ohne Schuld noch nicht zur ausdrücklichen Anerkennung Gottes gekommen sind, jedoch, nicht ohne die göttliche Gnade, ein rechtes Leben zu führen sich bemühen. Was sich nämlich an Gutem und Wahrem bei ihnen findet, wird von der Kirche als Vorbereitung für die Frohbotschaft und als Gabe dessen geschätzt, der jeden Menschen erleuchtet, damit er schließlich das Leben habe." (LG 16)
Die Erwählung und Berufung des Menschen, jedes Menschen, besagt freilich auch, daß Gott den Menschen als Menschen annimmt und ernst nimmt. Deshalb will er die freie Antwort und Zustimmung des Menschen. Ja, Gott macht in seiner Liebe die Verwirklichung seines Heilswillens von unserer Freiheit abhängig. Das bedeutet, daß wir durch unsere Schuld das Heil auch verfehlen können. Die Vorherbestimmung im engeren Sinn gilt darum nur denen, die mit Gottes Gnade das ewige Heil auch erlangen.
Leider hat sich diese frohe Botschaft in der Vergangenheit oft vermischt mit einer Angst erzeugenden Schreckensbotschaft. Im Anschluß an den hl. Augustinus, den großen Lehrer der Gnade, hat man aus einzelnen Aussagen der Heiligen Schrift über die Verstockung einzelner (vgl. Ex 7,3; 9,12; Jes 6,10; Mk 4,12; Röm 9,18), vor allem aus Aussagen des Apostels Paulus in Röm 9-11 oft die Lehre von der doppelten Vorherbestimmung abgeleitet: Die einen sind von Ewigkeit her zum Heil erwählt, die anderen sind nicht erwählt. Manchmal wollte man sogar wissen, daß nur die kleinere Zahl der Menschen zum Heil vorherbestimmt ist, während die Mehrzahl zur Masse der Verdammten gehört. Die Kirche hat jedoch diese extremen Vorherbestimmungslehren (etwa bei dem Mönch Gottschalk im 9. Jahrhundert oder bei Calvin im 16. Jahrhundert), wonach Gott bestimmte Menschen durch einen Willensakt zur Verdammung vorherbestimmt hat, abgelehnt. Die Kirche hat daran festgehalten: "Der allmächtige Gott will, daß alle Menschen ohne Ausnahme zum Heil kommen, auch wenn tatsächlich nicht alle gerettet werden. Daß die einen gerettet werden, ist Geschenk des Retters; daß andere verlorengehen, ist die Schuld derer, die verlorengehen" (DS 623; vgl. 1567; NR 835). Jesus Christus ist nicht nur für die Erwählten, auch nicht nur für die Gläubigen, sondern für alle Menschen gestorben (vgl. DS 2005; 2304; NR 875). Deshalb sagte man: Alle besitzen hinreichende Gnade, aber nicht bei allen wird die Gnade zur wirksamen Gnade.
Doch mit diesen an sich richtigen Abgrenzungen ist das Problem keineswegs gelöst. Die Frage ist ja: Wie ist der absolute Primat Gottes noch gewahrt, wenn das Wirksamwerden des Heilswirkens Gottes von der Zustimmung des Menschen abhängt? Umgekehrt: Muß das Nichterreichen des Heils letztlich nicht doch auf Gott zurückfallen, der allen Menschen zwar hinreichende Gnade, aber nicht allen Menschen wirksame Gnade schenkt? Wie soll man also die beiden Aussagen zusammenbringen, daß Gott einerseits das Heil aller Menschen will und es andererseits Menschen gibt, die aus eigener Schuld das Heil nicht erreichen? Wie verhalten sich Gottes Vorherbestimmung und menschliche Freiheit?
Um dieses schwierige Problem drehte sich der sogenannte Gnadenstreit im 16./17. Jahrhundert zwischen den Theologen aus dem Dominikanerorden und den Theologen aus dem Jesuitenorden. Der Papst ließ die Frage schließlich offen und verbot nur die gegenseitige Verketzerung. Das war eine weise Entscheidung. Denn so, wie die Frage damals gestellt wurde, war sie gar nicht zu lösen. Das Verhältnis von Gottes Freiheit und der Freiheit des Menschen ist für uns letztlich ein unauflösliches Geheimnis. Man kann das Verhältnis von Gottes und des Menschen Freiheit nicht in der Weise bestimmen, daß man Gott das abzieht, was man dem Menschen gibt, oder umgekehrt. Gott ist in der Freiheit seiner Liebe so unendlich groß, daß er die endliche menschliche Freiheit nicht nur zuläßt, sondern sie ermöglicht, trägt, ermutigt, befreit und erfüllt. Dieses Verhältnis von Gott und Mensch ist uns in Jesus Christus ein für allemal erschlossen. Deshalb läßt sich auch das Problem der Vorherbestimmung nur von Jesus Christus her erhellen. Dieser Ausgangspunkt kam in der traditionellen Vorherbestimmungsdiskussion zu kurz, weshalb sie sich in viele nutzlose Fragestellungen verrannte.
Ihrem ursprünglichen Sinn nach will die Lehre von der göttlichen Vorherbestimmung ein Dreifaches sagen:
1. Der Ausgangspunkt der Lehre von Gottes Vorherbestimmung ist kein abstraktes Willensdekret Gottes, kein allgemeines Prinzip, sondern die konkrete Erwählung in Jesus Christus (vgl. Eph 1,4-6.11-12; 3,2-13). In Jesus Christus ist Gott reines Ja und nicht Ja und Nein zugleich. Deshalb stehen Erwählung und Verwerfung nicht parallel nebeneinander, es geht vielmehr allein um die Erwählung zum Heil. Das ist der Grund, weshalb wir nicht abstrakt und unbestimmt von Vorherbestimmung, sondern konkret und bestimmt von der Vorherbestimmung zum Heil sprechen. Sie geschieht in Jesus Christus. Denn Gottes Erwählung bestimmt uns, "an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben" (Röm 8,29). Gott hat ihn für uns zur Sünde gemacht (vgl. 2 Kor 5,21); so sind alle, auch die Sünder, in Christus zum Heil berufen.
2. Gottes Heilswille in Jesus Christus richtet sich nicht auf den isolierten einzelnen, sondern auf das Volk Gottes im ganzen, auf den einzelnen, insofern er eingebettet ist in die große Gemeinschaft des Gottesvolkes, als dessen Glied er das Heil erlangt (vgl. Dtn 7,7-8; 14,2 u. a.). Deshalb ist von Erwählung nicht im Singular, sondern im Plural die Rede (vgl. Eph 1,4-6; 1 Petr 1,1-2, 2,5-10). Die Erwählung des einen ist am Ende auch das Heil des andern (vgl. bes. Röm 11,31-32). Die Erwählung des einzelnen ist also immer auch Erwählung zum stellvertretenden Dienst für die andern. Darum ist die Erwählung kein Privileg derer, die das Heil "gepachtet" haben, sondern Aussonderung zum Dienst am Heil aller. Auf die Frage, ob es nur wenige sind, die gerettet werden, antwortet Jesus mit einem Appell: "Bemüht euch mit allen Kräften, durch die enge Tür zu gelangen" (Lk 13,24). Dieser Appell wird im Missionsauftrag des Auferstandenen zu einem Anruf, allen Geschöpfen das Evangelium zu verkünden (vgl. Mk 16,15). Deshalb darf es keine prädestinierten und privilegierten Familien, Völker oder Rassen, keine Herrenmenschen neben Menschen zweiten Ranges geben. Gegen eine solch falsch interpretierte Erwählungslehre weist uns die Heilige Schrift darauf hin, daß Gott gerade das Schwache erwählt, um das Starke zu beschämen (vgl. 1 Kor 1,26-28).
3. Für den einzelnen ist Gottes Vorherbestimmung der Inbegriff des Evangeliums. Denn sie besagt, daß es letztlich nicht auf das Wollen und Streben des Menschen, sondern allein auf das Erbarmen Gottes ankommt (vgl. Röm 9,16; Eph 2,8). So ist die Erwählungsgewißheit der größte Halt und der stärkste Trost. Aber sie durchkreuzt zugleich alle natürlichen Absicherungen und verweist uns ganz und gar auf Gottes Gnade. Gerade weil Gott auch das Wollen und Vollbringen wirkt, gilt es, das Heil in Furcht und Zittern zu wirken (vgl. Phil 2,12-13). Wo der Mensch dagegen der Gnade nicht entspricht, da wird sie ihm zum Gericht. Das Wort "viele sind gerufen, aber nur wenige auserwählt" (Mt 22,14) zeigt, daß Erwählung kein sicherer Besitz, sondern als Gabe zugleich Aufgabe ist. Sie schließt die Verantwortung des Menschen nicht aus, sondern setzt sie ganz im Gegenteil frei und beansprucht sie aufs äußerste. Sie konfrontiert den Menschen mit der Möglichkeit, ihn für uns zur Sünde gemacht (vgl. 2 Kor 5,21); so sind alle, auch die Sünder, in Christus zum Heil berufen.
2. Gottes Heilswille in Jesus Christus richtet sich nicht auf den isolierten einzelnen, sondern auf das Volk Gottes im ganzen, auf den einzelnen, insofern er eingebettet ist in die große Gemeinschaft des Gottesvolkes, als dessen Glied er das Heil erlangt (vgl. Dtn 7,7-8; 14,2 u. a.). Deshalb ist von Erwählung nicht im Singular, sondern im Plural die Rede (vgl. Eph 1,4-6; 1 Petr 1,1-2, 2,5-10). Die Erwählung des einen ist am Ende auch das Heil des andern (vgl. bes. Röm 11,31-32). Die Erwählung des einzelnen ist also immer auch Erwählung zum stellvertretenden Dienst für die andern. Darum ist die Erwählung kein Privileg derer, die das Heil "gepachtet" haben, sondern Aussonderung zum Dienst am Heil aller. Auf die Frage, ob es nur wenige sind, die gerettet werden, antwortet Jesus mit einem Appell: "Bemüht euch mit allen Kräften, durch die enge Tür zu gelangen" (Lk 13,24). Dieser Appell wird im Missionsauftrag des Auferstandenen zu einem Anruf, allen Geschöpfen das Evangelium zu verkünden (vgl. Mk 16,15). Deshalb darf es keine prädestinierten und privilegierten Familien, Völker oder Rassen, keine Herrenmenschen neben Menschen zweiten Ranges geben. Gegen eine solch falsch interpretierte Erwählungslehre weist uns die Heilige Schrift darauf hin, daß Gott gerade das Schwache erwählt, um das Starke zu beschämen (vgl. 1 Kor 1,26-28).
3. Für den einzelnen ist Gottes Vorherbestimmung der Inbegriff des Evangeliums. Denn sie besagt, daß es letztlich nicht auf das Wollen und Streben des Menschen, sondern allein auf das Erbarmen Gottes ankommt (vgl. Röm 9,16; Eph 2,8). So ist die Erwählungsgewißheit der größte Halt und der stärkste Trost. Aber sie durchkreuzt zugleich alle natürlichen Absicherungen und verweist uns ganz und gar auf Gottes Gnade. Gerade weil Gott auch das Wollen und Vollbringen wirkt, gilt es, das Heil in Furcht und Zittern zu wirken (vgl. Phil 2,12-13). Wo der Mensch dagegen der Gnade nicht entspricht, da wird sie ihm zum Gericht. Das Wort "viele sind gerufen, aber nur wenige auserwählt" (Mt 22,14) zeigt, daß Erwählung kein sicherer Besitz, sondern als Gabe zugleich Aufgabe ist. Sie schließt die Verantwortung des Menschen nicht aus, sondern setzt sie ganz im Gegenteil frei und beansprucht sie aufs äußerste. Sie konfrontiert den Menschen mit der Möglichkeit, durch eigene Schuld sein Leben zu verfehlen und dem ewigen Verderben zu verfallen. Die Erwählungsgewißheit gibt darum keine Sicherheit, sondern ist letztlich eine Hoffnungsgewißheit. Sie stützt sich allein auf die Treue Gottes und hofft, daß er der das gute Werk begonnen hat, es auch vollenden wird (vgl.Phil 1,6). So wie die Erwählung von Gott ausgeht, mündet sie darum am Ende wieder in den Lobpreis Gottes ein:
- "O Tiefe des Reichtums,
- der Weisheit und der Erkenntnis Gottes!
':Wie unergründlich sind seine Entscheidungen,
- wie unerforschlich seine Wege!
- Denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt?
- Oder wer ist sein Ratgeber gewesen?
- Wer hat ihm etwas gegeben,
- so daß Gott ihm etwas zurückgeben müßte?
- Denn aus ihm und durch ihn und auf ihn hin
- ist die ganze Schöpfung.
- Ihm sei Ehre in Ewigkeit! Amen." (Röm 11,33-36)
3. Geschichtliche Verwirklichung der Gnade: Die Rechtfertigung des Sünders
3.1 Gerechtigkeit und Rechtfertigung nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift
Auf die Frage nach der Bedeutung der Gnade und des Heils in der Gegenwart antworten das Alte und das Neue Testament mit sehr unterschiedlichen Bildern und Begriffen. Die Heilige Schrift spricht von Leben, Licht, Friede, Freiheit, Gerechtigkeit, Versöhnung, Heiligung, Erlösung, Wiedergeburt u. a. Aus der Fülle dieser Bilder und Begriffe wurden durch den Einfluß des hl. Augustinus und noch mehr durch die Reformation besonders die Begriffe Gerechtigkeit und Rechtfertigung wichtig. Heute sind uns der ursprüngliche Sinn und die grundlegende Bedeutung dieser Begriffe nicht mehr unmittelbar verständlich. Wir müssen uns ihren ursprünglichen Sinn erst wieder mühsam erschließen. Deshalb müssen wir uns in diesem Kapitel zunächst auf die biblische und kirchliche Tradition einlassen. Erst im nächsten Kapitel können wir nach deren Bedeutung für heute fragen.
Das Thema Gerechtigkeit und Rechtfertigung spielt schon im Alten Testament eine große Rolle. Von besonderer Bedeutung ist das Urteil über Abraham anläßlich des Bundesschlusses: "Abram glaubte dem Herrn, und der Herr rechnete es ihm als Gerechtigkeit an" (Gen 15,6). Dieses Wort zeigt, daß Gerechtigkeit in diesem Zusammenhang die Bundestreue und das bundesgemäße Verhalten meint. Der Bund ist ja der große Gnadenerweis Gottes gegenüber Israel; er schenkt dem Volk wie dem einzelnen Leben und Lebensraum. Gerecht ist, wer zu diesem Bund und seiner Ordnung steht. Er ist recht vor Gott, recht im Verhältnis zu den anderen und vor sich. Doch schon die Propheten klagten Israel an, daß es seine Existenz nicht auf Gott und seinen Willen, sondern auf eigene Einsicht und Kraft gründen wollte. So ist die Gemeinschaft mit Gott am Unglauben Israels zerbrochen, es droht ihm das Gericht. Aber auch im Alten Testament ist die Gerichtsbotschaft nicht das letzte Wort (vgl. Hos 14,5). Stärker ist die Verheißung, daß Gott am Ende der Zeit Israel durch sein schöpferisches Handeln wiederherstellen und einen neuen Bund mit ihm schließen wird (vgl. Jer 31,31-33). So erwarten Teile des Judentums zur Zeit Jesu (Apokalyptik) das Offenbarwerden der Gerechtigkeit, d. h. der Bundestreue Gottes am Ende der Zeit.
Charakteristisch für Botschaft und Auftreten Jesu ist seine Kritik an der Selbstgerechtigkeit der Frommen seiner Zeit und seine Zuwendung zu den Sündern. Er ist "gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten" (Mk 2,17; vgl. Lk 19,10). Im Gleichnis vom verlorenen Sohn wird dieser vom Vater wieder in seine Sohnesrechte eingesetzt und gerechtfertigt (vgl. Lk 15,11-32). "Einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten" (Lk 18,9), erzählt Jesus das Gleichnis vom selbstgerechten Pharisäer und vom Zöllner. Vom Zöllner, der bekennt: "Gott, sei mir Sünder gnädig!" (Lk 18,13), sagt Jesus: "Dieser kehrte als Gerechter nach Hause zurück, der andere nicht" (Lk 18,14). Diese Botschaft führt Jesus dazu, Sünder in seine Gemeinschaft aufzunehmen und Mahlgemeinschaft mit ihnen zu halten (vgl. Mk 2,15-16; Mt 11,19; Lk 15,2; 19,7). Jesus verstand diese Mähler als Vorfeiern des endzeitlichen Hochzeitsmahles im Reiche Gottes. Die neue Gerechtigkeit, die Jesus verkündet, bedeutet also neue Gemeinschaft mit Gott und neue Gemeinschaft zwischen den Menschen. Weil Gott jeden Menschen, auch den Sünder, den Gottlosen, annimmt, können und müssen nun auch die Menschen sich gegenseitig annehmen. Weil Gott uns rechtfertigt, brauchen wir uns nicht mehr selbst zu rechtfertigen, brauchen wir unser Leben nicht mehr selbst zu "leisten".
Der Apostel Paulus hat die Botschaft Jesu besonders tief verstanden und sie in seiner Botschaft von der Rechtfertigung der Sünder gegenüber dem Judentum seiner Zeit geltend gemacht. Paulus suchte lange Zeit und mit Eifer die Gerechtigkeit durch das Halten der Vorschriften des Gesetzes. Er war "untadelig in der Gerechtigkeit, wie sie das Gesetz vorschreibt" (Phil 3,6; vgl. Gal 1,14), bis ihm vor Damaskus Jesus Christus aufging (vgl. Apg 9,1-9; Gal 1,15-16) und er um Christi willen alles Bisherige als Verlust erkannte (vgl. Phil 3,7-8). Als den zentralen Inhalt des Evangeliums von Jesus Christus verkündete er nun:
- "Jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz die Gerechtigkeit Gottes offenbart worden, bezeugt vom Gesetz und von den Propheten: die Gerechtigkeit Gottes aus dem Glauben an Jesus Christus, offenbart für alle, die glauben." (Röm 3,21-22; vgl. 1,17)
- "Denn wir sind der Überzeugung, daß der Mensch gerecht wird durch Glauben, unabhängig von Werken des Gesetzes." (Röm 3,28)
Diese Aussagen sind nur zu verstehen, wenn man erkennt, daß für Paulus mit Kreuz und Auferstehung Jesu die große Wende gekommen ist. Obwohl alle Menschen Sünder sind und den Bund Gottes gebrochen haben, hat Gott in Jesus Christus seine Bundestreue, seine Gerechtigkeit durchgehalten und aus reiner Liebe die Welt mit sich versöhnt (vgl. 2 Kor 5,18). Deshalb ist die Gerechtigkeit Gottes nicht an die Bedingungen des Gesetzes und an seine Erfüllung gebunden, sondern allein an den Glauben an Jesus Christus. Er ist für uns zur Gerechtigkeit gemacht worden (vgl. 1 Kor 1,30); in ihm wird uns Gottes Gerechtigkeit zuteil. Gottes Gerechtigkeit ist also nicht eine je nach Verdienst zuteilende, die Guten belohnende und die Sünder bestrafende Gerechtigkeit. Sie ist Gottes eigene Gerechtigkeit, seine Bundestreue und Liebe. Sie erweist sich als schenkende und neuschaffende Gerechtigkeit, welche die Sünder ohne Verdienst aus reiner Gnade gerecht macht. Dabei geht es nicht nur um den individuellen einzelnen. Schon der Abrahamsbund steht im Horizont einer universalen Verheißung (vgl. Gen 15,5-7); Abrahams Nachkommen sollen "Erben der Welt" sein (Röm 4,13). Im Glauben, der sich gegen alle Hoffnung ganz auf Gott verläßt, wird ja die ursprüngliche Schöpfung wieder hergestellt (vgl. Röm 4,17-18). In der Aufrichtung der Bundesgerechtigkeit geht es also um die Aufrichtung von Gottes neuer Gerechtigkeit in der Welt, um das Kommen der Herrschaft Gottes, der Herrschaft der Liebe.
Was Paulus in der Auseinandersetzung mit den Juden seiner Zeit als Rechtfertigung des Sünders durch Gott verkündet, sagt er in anderen Zusammenhängen mit anderen Worten wie retten, erlösen, versöhnen. In anderen Schriften des Neuen Testaments finden sich wiederum andere Vorstellungen und Begriffe. Der Jakobusbrief sieht sich sogar veranlaßt, gegen Mißverständnisse der paulinischen Rechtfertigungslehre Stellung zu nehmen und zu betonen, daß der Glaube ohne Werke nutzlos ist (vgl. Jak 2,20). Das steht der Sache nach nicht im Widerspruch zu Paulus, denn auch nach Paulus müssen die Christen reich sein an "Frucht der Gerechtigkeit" (Phil 1,11) und an "Frucht des Geistes" (Gal 15,22). Der Glaube muß in der Liehe wirksam sein (vgl. Gal 5,6). So ist deutlich, daß das Neue Testament die eine Botschaft vom Heil Gottes in Jesus Christus je nach den sich wandelnden Fragestellungen und Situationen in unterschiedlichen Bildern und Begriffen verkündet.
Diese unterschiedlichen Bilder und Begriffe stehen in einem tiefen sachlichen Zusammenhang: Der gemeinsame Ausgangspunkt ist Jesu Botschaft vom Kommen der Herrschaft Gottes; sie ist zugleich das Heil der Menschen. In ihr wird Gottes Bundestreue, seine Gerechtigkeit trotz aller Untreue und Sünde der Menschen offenbar. In ihr kommt Gottes bedingungslose Liebe zur Geltung, weil Gott durch Jesus Christus jeden Menschen, der sich im Glauben auf diese Botschaft einläßt, ohne jede Ausnahme und ohne alle Bedingungen annimmt. Diese unbedingte Annahme bedeutet das Ende der Feindschaft mit Gott, Vergebung der Sünden, Befreiung von der Macht der Sünde, und das heißt zugleich: Befreiung von der Macht des Todes, von der Macht gesetzlichen Leistungsdrucks, der Sinnlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Verlorenheit. Positiv bedeutet die Annahme durch Gott neue Gemeinschaft und Freundschaft mit Gott, Versöhnung und Frieden. Indem dieser neue Bund im Blut Jesu (vgl. Mt 26,28; Mk 14,24) Wirklichkeit wird, bricht die neue Schöpfung an, in der dem verlorenen Menschen ein neuer Lebensraum geschenkt wird. Sein Leben hat wieder Sinn, er ist im Licht. Er ist wiedergeboren zu einem neuen Leben. Wo so Gottes Herrschaft in der Liebe konkrete Wirklichkeit wird, da werden auch die Menschen untereinander versöhnt und in den Dienst der Gerechtigkeit, der Liebe und der Freundschaft gerufen. Dies alles ist gemeint, wenn wir von Rechtfertigung aus Gnade sprechen.
3.2 Die katholisch-evangelische Kontroverse
Rechtfertigung und Heiligung des Menschen wurden durch die Reformation des 16. Jahrhunderts zur Schicksalsfrage, an der die Einheit der abendländischen Christenheit zerbrach. Für die Reformation war die Rechtfertigungslehre "der Artikel, mit dem die Kirche steht und fällt".
Wie kam es zu dieser folgenschweren Spaltung der Kirche? Welche Fragen des Glaubens standen und stehen zur Diskussion?
Historisch betrachtet haben vielerlei wirtschaftliche, soziale, politische, geistige und geistliche Faktoren zusammengewirkt. Durch das Aufkommen der Nationalstaaten zerbrach damals die Einheit der abendländischen Christenheit. Das beginnende 16. Jahrhundert war auch eine Zeit des geistigen Umbruchs. Man braucht nur an die Renaissance, den Humanismus und die revolutionären Neuentdeckungen von N. Kopernikus und Chr. Kolumbus oder die Erfindung der Buchdruckerkunst zu denken. In der Kirche gab es einflußreiche Reformbestrebungen, geistliche Erneuerungs- und Frömmigkeitsbewegungen (etwa die Devotio moderna). Insgesamt aber war die Kirche am Ende des Mittelalters in eine schwere innere Krise geraten. Päpste und Bischöfe waren vielfach in weltliche Händel und Interessen verstrickt; ihr persönliches Leben entsprach oft in keiner Weise ihrem geistlichen Amt. Die Seelsorge lag vielerorts darnieder. Die Volksfrömmigkeit war zu einem großen Teil veräußerlicht, manchmal sogar abergläubisch. In der Theologie bestanden große Unklarheiten. Solche Mißstände machten eine Reform an Haupt und Gliedern dringend notwendig. Doch diese äußeren Faktoren bildeten eher das Klima, in dem sich die Reformation vielerorts so rasch durchsetzen konnte. Die eigentlichen Ursachen liegen tiefer. Der hl. Clemens Maria Hofbauer († 1820) äußerte einmal, die Reformation sei entstanden, "weil die Deutschen das Bedürfnis haben und hatten, fromm zu sein". Diesen genuin religiösen Impuls der Reformation darf man nicht übersehen. Das muß uns daran hindern, die Glaubensspaltung durch einseitige persönliche Schuldzuweisung zu "erklären".
Der Ausgangspunkt der Reformation war Martin Luthers (1483-1546) Frage: "Wie kriege ich einen gnädigen Gott?" Dies war für Luther eine Frage auf Leben und Tod, die ihn zutiefst aufwühlte und in Verzweiflung stürzte. Ging es ihm in dieser Frage doch um das rechte Stehen des Menschen vor Gott. Die Antwort fand er nicht in der Lossprechung im Bußsakrament, sondern in einem neuen Verständnis der Heiligen Schrift. Beim Lesen des Römerbriefs entdeckte er neu, was Gottes Gerechtigkeit (vgl. Röm 1,17) meint: nicht die den Menschen nach seinen Werken beurteilende und ihn für seine Sünden strafende Gerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit, die Gott um Christi willen aus reiner Gnade dem Menschen schenkt. Das Augsburger Bekenntnis formuliert die Rechtfertigungslehre so: "Die Menschen können vor Gott nicht gerechtfertigt werden durch eigene Kräfte, Verdienste oder Werke, sondern sie werden ohne ihr Zutun gerechtfertigt um Christi willen durch den Glauben..." (CA 4). Diese Rechtfertigungslehre war für Luther und die Lutheraner fortan nicht ein Glaubensartikel neben anderen, sondern die Mitte und das Kriterium des christlichen Glaubens. Denn in diesem Artikel geht es darum, was Jesus Christus "für mich" bedeutet. Weil es in diesem Artikel um Jesus Christus als den einzigen Mittler des Heils geht, kann man von ihm "nichts weichen oder nachgeben, es falle Himmel und Erden" (Schmalkaldische Artikel).
Luthers Verständnis der Gerechtigkeit Gottes entsprach durchaus der katholischen Tradition. Indem er diese Lehre jedoch einseitig zum Kriterium des ganzen Glaubens machte, geriet er in der damaligen Situation schon bald in Konflikt mit der bestehenden Kirchenordnung. In seinen 1517 veröffentlichten Ablaßthesen wandte sich Luther gegen die Ablaßpraxis des Dominikaners Tetzel, weil er darin eine falsche Auffassung von der Sündenvergebung sah. In den darauf folgenden Auseinandersetzungen berief sich Luther auf die im Sinn des Rechtfertigungsartikels ausgelegte "Schrift allein". Damit war die Vollmacht der Kirche, die Schrift verbindlich auszulegen, in Frage gestellt. Luther erklärte den Papst, der die Predigt des im Sinn seiner Rechtfertigungslehre ausgelegten Evangeliums nicht zulassen wollte, zum Antichrist. Nicht Kirchenkritik war also der Ausgangspunkt, der zur reformatorischen Position führte, sondern Luthers Verständnis von der Autorität der Schrift und die aus ihr gewonnene Rechtfertigungslehre waren Ausgangspunkt und Kriterium der Kritik an der bestehenden Kirche, deren Sakramenten und Ämtern. Die gesamte Kirche wurde nun unter das Kriterium des Evangeliums von der Rechtfertigung allein aus Glauben gestellt. So kam es zum Bruch mit wesentlichen überlieferten Lebensformen der Kirche. Das unterschiedliche Verständnis derKirche, ihrer Sakramente und Ämter trat immer deutlicher in den Vordergrund und erwies sich als der eigentliche Grund für den Bruch der Kirchengemeinschaft.
Neben Luther sind als Reformatoren auch Huldrich Zwingli (1484-1531) in Zürich und vor allem Johannes Calvin (1509-1564) in Genf zu nennen. Bei aller fundamentalen Übereinstimmung mit Luther setzte Calvin auch in der Rechtfertigungslehre einige andere Akzente. Anders als bei Luther war diese für ihn nicht die Leitperspektive aller Lehre; in seinem Hauptwerk "Unterricht in der christlichen Religion" ordnete er sie der Lehre vom Heiligen Geist ein. Calvins leitender Gesichtspunkt war die Ehre Gottes und der Gehorsam gegenüber Gottes Ordnungen in allen Lebensbereichen. In diesen Anliegen stand er der katholischen Überlieferung nahe. Dagegen geriet er vor allem in der Lehre von der göttlichen Vorherbestimmung (Prädestination), aber auch in der Sakramentenlehre, besonders der Eucharistielehre, in scharfen Gegensatz zum katholischen Glaubensverständnis.
Eine erste Reaktion der katholischen Kirche erfolgte bereits durch die Verurteilung verschiedener Thesen Luthers in der Bannandrohungsbulle "Exsurge Domine" (1520). Das immer wieder geforderte und geplante, aber immer wieder verschobene allgemeine Konzil kam leider erst nach langem Hin und Her viel zu spät zustande. Das Konzil von Trient (1545-1563) verurteilte nicht die Personen der Reformatoren, auch nicht deren Lehre insgesamt; es belegte aber viele ihrer Thesen mit dem Anathem. Daneben leitete es eine der größten Reformen in der Geschichte der Kirche ein. Im Dekret über die Rechtfertigung (1547) (vgl. DS 1520-1583; NR 790-851) legte es im Anschluß an die katholische Tradition eine eigene Gesamtdarstellung der katholischen Rechtfertigungslehre vor. Im Unterschied zu Luther machte das Konzil die Rechtfertigungslehre jedoch nicht zum Kriterium und zur Perspektive des Ganzen, sondern entwickelte sie im Zusammenhang des Ganzen des überlieferten Glaubens und Lebens der Kirche.
Damit ist der entscheidende Kontroverspunkt deutlich geworden. Die Reformatoren waren überzeugt, mit ihrer Lehre von der Rechtfertigung allein aus Glauben den ursprünglichen Sinn und die Mitte der Heiligen Schrift wieder entdeckt und gegenüber späteren Entstellungen des Evangeliums zur Geltung gebracht zu haben. Aber auch für die katholischen Theologen, die ihnen entgegentraten, besaß die Heilige Schrift unbedingte Autorität. Nicht die Heilige Schrift als solche, sondern die rechte Auslegung der Heiligen Schrift war das Problem. Die Fragestellung der Reformatoren war ja nicht unmittelbar die des Apostels Paulus im Römerbrief. Paulus verkündete in der Auseinandersetzung mit den Juden, daß das Heil ohne alle Vorbedingungen allein durch Jesus Christus geschenkt wird. In den Kontroversen des 16. Jahrhunderts dagegen ging es um eine innerchristliche Diskussion, bei der im Unterschied zur Situation des Paulus beide Seiten Jesus Christus als den einzigen Mittler des Heils anerkannten. Die Frage war nun, was Jesus Christus "für uns" bedeutet und wie das Heil Jesu Christi uns vermittelt wird. Näherhin war die Frage, ob durch bestimmte als heilsnotwendig erklärte kirchliche Ordnungen nicht neue Bedingungen des Heils aufgestellt werden. Es ging um eine aktualisierende Übersetzung des zentralen Inhalts der Heiligen Schrift in eine veränderte Fragestellung hinein. Es stand also nicht einfach Schriftlehre gegen Kirchenlehre. Zur Diskussion stand vielmehr die rechte Auslegung und Aktualisierung der Lehre der Heiligen Schrift. Dabei stellte das Konzil von Trient der von ihrer persönlichen Glaubenserfahrung geprägten Schriftauslegung der Reformatoren die Schriftauslegung durch das Wir der Kirche entgegen.
3.3 Die katholische Lehre von der Rechtfertigung und Heiligung
Die Lehre von der Rechtfertigung ist heute für die meisten Christen nur schwer zu verstehen. Es wird darauf ankommen, die alten Formeln aufzubrechen und ihren sachlichen Gehalt neu herauszustellen. Im Grunde geht es dabei um die Grundlagen der christlichen Existenz. Die Botschaft von der Gnade ist ja in gewissem Sinn der Inbegriff des ganzen Christentums.
1. Die erste und grundlegende Aussage, welche die katholische Lehre von der Rechtfertigung im Anschluß an das Zeugnis der Heiligen Schrift macht, betrifft die absolute Unmöglichkeit der Selbsterlösung des Menschen und die absolute Notwendigkeit der Erlösung durch Jesus Christus. Jesus Christus allein ist das Heil des Menschen; er ist "die Sonne der Gerechtigkeit" (DS 1520; NR 790). Nach dem Johannesevangelium sagt Jesus: "Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen" (Joh 3,5). "Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen" (Joh 15,5). Der hl. Augustinus weist darauf hin, es heiße nicht "Ihr könnt ohne mich wenig tun", sondern "Ihr könnt nichts tun". "Sei es also wenig oder viel, es kann nicht ohne den geschehen, ohne welchen nichts geschehen kann." Entsprechend lehrte das Trienter Konzil:
- "Wer behauptet, daß der Mensch durch seine Werke, die durch die Kräfte der menschlichen Natur oder in der Lehre des Gesetzes vollbracht werden, ohne die göttliche Gnade, die da ist durch Jesus Christus, vor Gott gerechtfertigt werden könne, der sei ausgeschlossen." (DS 1551; NR 819)
Damit ist festgehalten, daß zu jedem heilshaften Tun des Menschen die übernatürliche Gnade Gottes absolut notwendig ist. Das gilt auch vom ersten Heilsverlangen und vom Anfang des Glaubens und des Heils. Immer geht die Gnade dem Erkennen und Wollen des Menschen voran und begleitet sie. "Denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt, noch über euren guten Willen hinaus" (Phil 2,13). Christliche Existenz ist ganz und gar verdankte Existenz, Existenz im Danken. In diesem Punkt besteht volle Übereinstimmung mit den Reformatoren. Gemeinsam beten wir in dem bekannten Heilig-Geist-Hymnus "Veni Sancte Spiritus" (um 1200):
- "Ohne dein lebendig Wehn
- kann im Menschen nichts bestehn,
- kann nichts heil sein noch gesund."
- (Gotteslob 244) (zit. CA 20)
Die These von der absoluten Notwendigkeit der Gnade zum Heilshandeln des Menschen beinhaltet keinen grundsätzlichen moralischen oder kulturellen Pessimismus. Sie bedeutet nach katholischer Lehre nicht, daß der Mensch im Zustand der Sünde ohne die Gnade keine sittliche Wahrheit erkennen und keine sittlich gute Tat vollbringen kann. Seine Erkenntniskraft und seine sittliche Freiheit sind durch die Sünde zwar tief verwundet, aber nicht zerstört. Es soll also keineswegs die Möglichkeit beachtlicher sittlicher und kultureller Leistungen des Menschen bestritten werden. Ausgeschlossen ist lediglich der natürliche Optimismus in bezug auf das Heil. Denn die dem Sünder verbleibende sittliche Freiheit bezieht sich nur auf den Bereich des menschlich Guten, nicht auf das Heil des Menschen. Bei allen unterschiedlichen Akzentuierungen und trotz mancher überspitzter Formulierungen der Reformatoren ist in dieser Frage ein grundsätzliches Einverständnis möglich (vgl. CA 18).
Die Kontroverse geht vor allem darum, ob die Gnade den Menschen dazu befähigt, seiner Rechtfertigung zuzustimmen und dabei mitzuwirken. Die Reformatoren sprechen ausdrücklich vom "unfreien Willen"; für sie war die völlige Passivität des Menschen beim Rechtfertigungsprozeß grundlegend. Demgegenüber spricht das Trienter Konzil mehrfach von einer Mitwirkung (vgl. bes. DS 1554; NR 822). Es meinte damit freilich keine autonome Freiheit gegenüber Gott, sondern eine geschenkte Freiheit. Diese Sprechweise ist biblisch legitim. Der Apostel Paulus bezeichnet sich ausdrücklich als Gottes Mitarbeiter (vgl. 1 Kor 3,9; 2 Kor 6,1); er spricht von einem Wirken der Gnade "zusammen mit mir" (1 Kor 15,10). Gott wahrt die Würde des Geschöpfes, die auch der Sünder nicht verliert. Er behandelt uns nicht wie tote Klötze; er respektiert uns als Menschen! Gottes Allwirksamkeit ist keine Alleinwirksamkeit. "Der dich ohne dich erschaffen hat, rechtfertigt dich nicht ohne dich. Also hat er dich ohne dein Wissen erschaffen, aber nur mit deiner Willenszustimmung rechtfertigt er dich" (Augustinus). Diese Frage der geschöpflichen Mitwirkung beim Prozeß der Heilsvermittlung stellt ein Grundproblem im Verhältnis zur Reformation dar. Der Sinn und das Ziel der Rechtfertigungslehre ist freilich auch nach katholischem Verständnis nicht der Ruhm des Menschen, sondern die Verherrlichung Gottes und seiner Gnade in Jesus Christus (vgl. DS 1528; 1583; NR 798; 851). Es gilt aber: Die Ehre Gottes aber ist der lebendige Mensch (Irenäus von Lyon). Deshalb gehören Verherrlichung Gottes und Ernstnehmen der Würde des Menschen zusammen. In dieser Gesamtperspektive können sich Katholiken und Protestanten finden, um die bestehenden Sachdifferenzen einer Lösung entgegenzuführen.
2. Das Wesen der Rechtfertigung wird im Neuen Testament als Wiedergeburt, neue Schöpfung, Erneuerung und Heiligung, als Versetzung aus dem Zustand des Todes in den des Lebens (vgl. 1 Joh 3,14), aus dem Zustand der Finsternis in den des Lichtes (vgl. Kol 1,13; Eph 5,8) beschrieben. Entsprechend definiert das Trienter Konzil die Rechtfertigung als
- "die Überführung aus dem Stand, in dem der Mensch als Sohn des ersten Adam geboren wird, in den Stand der Gnade und der Annahme zum Gotteskind durch den zweiten Adam, Jesus Christus, unsern Heiland". (DS 1524; NR 794)
Die Rechtfertigung durch Gott bewirkt also eine wirkliche und wesenhafte Umwandlung des Menschen. Sie erklärt ihn nicht nur gerecht, sondern macht, daß er gerecht ist; sie verändert ihn und schafft ihn neu. Dies schließt ein Doppeltes ein: die Vergebung der Sünden wie "die Heiligung und Erneuerung des inneren Menschen" (DS 1528; NR 798). Die Rechtfertigung ist also zugleich Heiligung, durch die wir im Heiligen Geist durch Jesus Christus Gemeinschaft haben mit Gott.
Nach Luther sind die Gerechtfertigten "gerecht und Sünder zugleich". Damit will Luther die Paradoxie der christlichen Existenz ausdrücken, wonach auch der Gerechtfertigte noch unter der Sünde steht. In der Tat, gerade die größten Heiligen hielten sich immer für die größten Sünder. Dieser Tatsache suchte das Trienter Konzil in anderer Weise dadurch gerecht zu werden, daß es von einer bleibenden Neigung zur Sünde (Begierlichkeit) spricht. Von solchen Aussagen ausgehend, scheint heute vielen Theologen in diesem Punkt eine Verständigung möglich. Daß die verbleibenden unterschiedlichen Ausgangspunkte, Denk- und Redeformen, vor allem die Stellung der Rechtfertigungslehre innerhalb des Ganzen dennoch Konsequenzen haben, zeigt die spätere reformatorische Entwicklung, die sich vor allem im Konkordienbuch (1580), das zu den lutherischen Bekenntnisschriften zählt, niedergeschlagen hat. Das Konkordienbuch unterscheidet nämlich streng zwischen Rechtfertigung und Heiligung, während das Trienter Konzil (1545-1563) beides als eine Einheit sieht. Diese unterschiedlichen Aussagen haben wiederum Konsequenzen für das Verhältnis von Glaube und Werk, dem wir uns nun zuwenden müssen.
3. Die Rechtfertigung des Menschen ist nur im Glauben möglich. Dies ist die eindeutige Lehre der Heiligen Schrift. Im Schluß des Markusevangeliums heißt es ausdrücklich: "Wer glaubt und sich taufen läßt, wird gerettet; wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden" (Mk 16,16). Der Apostel Paulus hat, wie wir gesehen haben, die Bedeutung des Glaubens besonders deutlich hervorgehoben (vgl. Röm 1,17; 3,22.28). "Ohne Glauben aber ist es unmöglich, (Gott) zu gefallen; denn wer zu Gott kommen will, muß glauben, daß er ist und daß er denen, die ihn suchen, ihren Lohn geben wird" (Hehr 11,6). So kann das Trienter Konzil erklären, daß
- "der Glaube Beginn des Heils für den Menschen, Grundlage und Wurzel jeder Rechtfertigung ist; ohne ihn kann ja niemand Gott gefallen (Hebr 11,6)". (DS 1532; NR 803)
"Der Glaube ist also der Anfang des Heils, jedoch nicht nur ein Anfang, der jemals während dieses Zeitlebens, etwa nachdem bedeutende Fortschritte gemacht sind, wieder verlassen werden könnte; er ist zugleich die bleibende Grundlage, worauf das ganze Heilsgebäude errichtet wird; aber auch nicht etwa nur eine unterlegte Masse, mit welcher das übrige in keinem organischen Verband stünde, denn er ist die Wurzel der Rechtfertigung" (J. A. Möhler). Dies alles ist möglich, weil der Glaube seinem tiefsten Wesen nach Einbezogensein in die innerste Grundhaltung Jesu bedeutet. Christliche Existenz ist also Existenz im Glauben und aus dem Glauben.
Luthers berühmte Formel "allein aus Glauben" ist darin begründet, daß für ihn der Glaube nicht nur der Anfang, sondern der Inbegriff des Heils ist. Dennoch hat Luther aus Furcht vor Werkgerechtigkeit es abgelehnt, daß zur Rechtfertigung ein von der Liebe bestimmter und bewegter Glaube notwendig sei. Die katholische Lehre versteht die Liebe freilich nicht als selbstgerechtes Werk des Menschen, sondern als Geschenk der Gnade. In diesem Sinn sagt sie, daß nur ein in der gnadenhaft geschenkten Liebe lebendiger Glaube rechtfertigt, während der "bloße" Glaube ohne Liebe, das bloße Fürwahrhalten nicht rechtfertigt (vgl. DS 1559; NR 827). Versteht man dagegen den Glauben im vollen und umfassenden biblischen Sinn, den Glauben also, der Umkehr, Hoffnung, Liebe einschließt, dann hat diese Formel auch einen guten katholischen Sinn. Denn nach katholischer Lehre umfaßt der Glaube beides: das Vertrauen auf Gott aufgrund seiner in Jesus Christus erwiesenen Barmherzigkeit und das Bekenntnis zu diesem Heilswerk Gottes durch Jesus Christus im Heiligen Geist (vgl. DS 1562; NR 830). Dieser Glaube ist niemals allein; er schließt vielmehr verschiedene andere Akte ein: Umkehr von der Sünde und Hinkehr zu Gott, Furcht Gottes wie Hoffnung auf Gott und Liebe zu Gott (vgl. DS 1559; NR 827). Das alles sind keine äußeren Zusätze und Ergänzungen zum Glauben, sondern Entfaltungen des inneren Wesens des Glaubens selbst.
4. Von besonderer Bedeutung war und ist erst recht heute die Frage nach der Erfahrbarkeit der Rechtfertigungsgnade. Selbstverständlich kann es keine objektive Sicherheit über die Gnade geben. Das ist schon dadurch ausgeschlossen, daß Gott, der Ursprung und der Inhalt der Gnade, dem Menschen ein undurchdringliches Geheimnis ist. Zwar ist Gottes Gnade und Barmherzigkeit für den, der glaubt, über jeden Zweifel erhaben; aber diese Gewißheit haben wir nur im Vollzug des Glaubens. Wenn wir dagegen auf uns selbst schauen, dann können wir wegen unserer Schwäche auch im Glauben niemals mit Sicherheit wissen, ob wir uns im Stande der Gnade befinden oder nicht (vgl. DS 1534; NR 804). Wir mögen uns vielleicht keiner Sünde bewußt sein, aber damit sind wir noch nicht gerechtfertigt (vgl. 1 Kor 4,4). Wir müssen uns deshalb "mit Furcht und Zittern" um unser Heil bemühen (Phil 2,12). Aber wir dürfen im Blick auf die Barmherzigkeit Gottes hoffen, das Heil zu erlangen.
Diese Hoffnungsgewißheit ist zeichenhaft erfahrbar. Paulus selbst mahnt: "Fragt euch selbst, ob ihr im Glauben seid, prüft euch selbst! Erfahrt ihr nicht an euch selbst, daß Christus Jesus in euch ist?" (2 Kor 13,5). Thomas von Aquin nennt als solche Zeichen: die Freude an Gott und an den Dingen des Glaubens, die Distanz gegenüber der Verführungsmacht der Welt, das Gewissensurteil, keiner schweren Sünde schuldig zu sein. Der hl. Ignatius von Loyola hat in den Regeln zur Unterscheidung der Geister vor allem auf die Erfahrung des geistlichen Trostes hingewiesen: innerer Mut und innere Kraft, innere Ruhe, alles andere hintansetzende Liebe zu Gott, innere Freudigkeit und inneres Hingezogensein zu den geistlichen Dingen.
Für Luther war die Frage der Heilsgewißheit der Ausgangspunkt seiner reformatorischen Entwicklung. So war für ihn die Erfahrung der Heilsgewißheit untrennbar mit dem rechtfertigenden Glauben verbunden. Calvin sprach sogar von einer Prädestinationsgewißheit. Das Konzil von Trient (1545-1563) sah darin einen "leeren und unfrommen Vertrauensglauben", der sich in der Sicherheit der Sündenvergebung gar noch seiner Sünden brüstet (DS 1533; NR 804). In der Sache sind sich die reformatorische Lehre und die katholische Tradition von der Hoffnungsgewißheit des Glaubens jedoch viel näher, als die scharfen Formulierungen von beiden Seiten nahelegen. Das eigentliche Problem liegt freilich tiefer. In Luthers Lehre der individuellen Glaubensgewißheit meldet sich ein Anliegen, das für die Neuzeit insgesamt grundlegend werden sollte: die neuzeitliche Gewißheitsproblematik. Indem das Trienter Konzil die Lehre von der individuellen Glaubensgewißheit abweist (vgl. DS 1563-1564; NR 831-832), deutet es auf die katholische Lösung des Gewißheitsproblems: Gewißheit ist nur in der Gemeinschaft der Kirche möglich, im wechselseitigen Zuspruch der Gnade und der aus ihr kommenden Hoffnung wie im gemeinsamen Getragensein von dem einen Wir des Glaubens und der Hoffnung.
5. Da die Rechtfertigung eine innere Erneuerung des Menschen ist, muß sie sich in einem neuen Leben auswirken. Mit dem "bloßen" Glauben ist es nicht getan; der Glaube, der das ganze Leben auf Gott und seine Gnade gründet, wird ganz von Gott und seinem Willen in Anspruch genommen. So erweist sich das neue Leben im Halten der Gebote. Christliche Existenz ist Existenz im Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes.
Im Alten Testament gehören zu dem von Gott aus Gnade gewährten Bund die Zehn Gebote, die Bundescharta (vgl. Ex 20; Dtn 5). Als Jesus nach dem Weg zum Leben gefragt wurde, antwortete er: "Wenn du aber das Leben erlangen willst, halte die Gebote!" (Mt 19,17). Es genügt ihm nicht, "Herr! Herr!" zu sagen, um in das Himmelreich einzugehen, es gilt vielmehr, den Willen des Vaters zu tun (Mt 7,21). Im Gleichnis vom unbarmherzigen Gläubiger zeigt Jesus, daß die Vergebung der Schuld durch Gott die zwischenmenschliche Vergebung zur Folge haben muß (vgl. Mt 18,23-35). Wer Jesus liebt, der wird auch seine Gebote halten (vgl. Job 14,15). Der Apostel Paulus hat aus der Befreiung von der Macht der Sünde die Folgerung abgeleitet, nunmehr nicht mehr Sklaven der Sünde zu sein, sondern als neue Menschen zu leben und seine Glieder "als Waffen der Gerechtigkeit in den Dienst Gottes" zu stellen (Röm 6,13).
So ist es biblisch gut begründet, wenn das Trienter Konzil die Notwendigkeit und die Möglichkeit der Erfüllung der Gebote lehrt (vgl. DS 1536-39; NR 806-808). Das Konzil betont sogar, Jesus Christus sei nicht nur Erlöser, sondern auch Gesetzgeber (vgl. DS 1571; NR 839). Auch Paulus spricht ja vom "Gesetz Christi" (Gal 6,2). Damit wehrt sich das Konzil im Sinn des Apostels Paulus gegen ein falsches Verständnis der christlichen Freiheit, das die Freiheit vom Gesetz als Vorwand für Eigensucht benutzt, statt die Freiheit als Selbstlosigkeit in der Liebe zu verstehen (vgl. Gal 5,13).
Zur Diskussion steht damit die reformatorische Lehre von der "Freiheit eines Christenmenschen". Luther gebraucht die paradoxe Formulierung: "Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan." Das Augsburger Bekenntnis (1530) spricht vom "neuen Gehorsam" und sagt: "Jener Glaube muß gute Früchte hervorbringen" (CA 6). "Zu Unrecht werden die Unsrigen beschuldigt, daß sie die guten Werke verbieten" (CA 20). Näherhin kennen die Reformatoren einen doppelten (teilweise auch dreifachen) Gebrauch des Gesetzes: den bürgerlichen bzw. politischen zur Regelung des menschlichen Zusammenlebens und den theologischen als Ausdruck des Willens Gottes. In diesem letzteren Sinn überfordert das Gesetz den Menschen; es überführt ihn seiner Sünde und verweist ihn auf das Evangelium. Dieses befreit vom Gesetz und läßt ihn den Willen Gottes von innen heraus erfüllen.
Das Trienter Konzil hat die Lehre von der christlichen Freiheit nicht ausdrücklich behandelt. Sie hat aber auch eine gute katholische Tradition. Auch nach katholischem Verständnis ist das Gesetz Christi kein neuer Gesetzeskodex, sondern ein Gesetz des Geistes (vgl. Röm 8,2) und insofern ein Gesetz der Freiheit (vgl. Jak 1,25), das von innen heraus zur Erfüllung des Willens Gottes drängt. "Das Gesetz wurde gegeben, damit die Gnade gesucht würde; die Gnade wurde gegeben, damit das Gesetz erfüllt würde" (Augustinus). In diesem Sinn nennt Thomas von Aquin das Gesetz des neuen Bundes ein Gesetz der Freiheit, weil es nicht von außen gegeben ist, sondern in der im Glauben empfangenen Gnade des Heiligen Geistes besteht. Der Unterschied zur reformatorischen Position ist nicht so sehr dogmatischer Art als ein solcher des konkreten christlichen Lebensvollzugs, des konkreten Weltverhältnisses und nicht zuletzt unterschiedlicher Sprach- und Denkform. Im katholischen Bereich wird die Entsprechung zwischen dem inneren Gesetz des Geistes und dem äußeren Gebot deutlicher herausgestellt. Deshalb ist die Bindung an die Gebote Gottes und (in anderer Weise) an die Ordnung der Kirche konkreter. Das kann die Gefahr des Legalismus mit sich bringen, wie die reformatorische Position in Gesetzlosigkeit umschlagen kann. Beide Positionen können sich ein gegenseitiges Korrektiv sein.
6. Der neuralgische Punkt der Rechtfertigungslehre ist die Frage der Verdienstlichkeit der guten Werke. Wird damit am Ende nicht doch wieder eine Werkheiligkeit und eine Selbstgerechtigkeit behauptet? Auf diese Frage ist zunächst zu antworten, daß Jesus selbst an vielen Stellen vom Lohn im Himmel (vgl. Mt 5,12; 19,29) und vom Gericht nach den Werken des Menschen spricht (vgl. Mt 25,34-35 u. a.). Dasselbe gilt vom Apostel Paulus (vgl. Röm 2,6; 1 Kor 3,8; 15,58 u. a.). Dabei geht es jedoch nicht um Werkgerechtigkeit. Vielmehr sind die Christen wie die Rebzweige am Weinstock; nur in Jesus Christus können sie Frucht bringen; ohne Jesus Christus dagegen können sie nichts vollbringen (vgl. Joh 15,5). So sind auch unsere Verdienste letztlich seine Gnade.
Das Trienter Konzil steht ganz auf dem Boden dieser Schriftaussagen, wenn es lehrt,
- "das ewige Leben in Aussicht zu stellen zugleich als Gnade, die den Söhnen Gottes durch Christus Jesus erbarmungsvoll verheißen wurde, und als Lohn, der nach Gottes Verheißung für ihre guten Werke und Verdienste getreu zu erstatten ist". (DS 1545; NR 815)
- Von der Gnade heißt es: "Diese Kraft geht stets ihren Werken voraus, begleitet sie und folgt ihnen nach, und ohne sie könnten sie in keiner Weise Gott genehm und verdienstlich sein." (DS 1546; NR 816)
- "So sei es doch ferne, daß ein Christ auf sich vertraue oder in sich seinen Ruhm suche und nicht im Herrn (1 Kor 1,31), dessen Güte gegen alle Menschen so groß ist, daß er seine eigenen Geschenke an sie zu ihren Verdiensten werden läßt." (DS 1548; NR 817)
Das zeigt: Die Gnade, die in unserem und durch unser Mittun wirksam wird, ist keine starre und statische Wirklichkeit, sondern etwas höchst Dynamisches, ja Dramatisches. Die Rechtfertigung wird zwar ein für allemal geschenkt und setzt doch einen lebenslangen Prozeß der Heiligung in Gang: Mit Hilfe der Gnade können und müssen wir uns auf die heiligmachende Gnade vorbereiten (vgl. DS 1525-1527, NR 795-797). Durch die in der Kraft der Gnade vollbrachten Werke kann die heiligmachende Gnade wachsen (vgl. DS 1635; NR 805). Die Gnade kann durch die Sünde aber auch verlorengehen (vgl. DS 1544; NR 814), wie sie durch die Umkehr wieder neu geschenkt wird (vgl. DS 1542-1543; NR 812-813). So ist das ganze Leben des Christen ein Kampf mit der Sünde und eine ständige Buße; immer wieder bedarf es der Erneuerung und der Vertiefung. Aber auch wenn wir alles getan haben, bleiben wir noch immer unnütze Knechte (vgl. Lk 17,10).
Die reformatorische Polemik gegen Werkgerechtigkeit war mit dem "allein aus Gnade", "allein aufgrund des Glaubens" notwendig verbunden. Aber auch die Reformatoren sprechen von Werken als Früchten des Glaubens und als dessen gewißmachende Zeichen. So sind die Werke nötig zum Heil, aber sie wirken nicht das Heil; sie haben vor Gott keinen Verdienstwert (vgl. CA 6; 20). Bezüglich der Verdienstlichkeit der Früchte der Rechtfertigung werden also deutlich unterschiedliche Aussagen gemacht (vgl. bes. DS 1581-1582; NR 849-850).
Dennoch scheint uns heute in der gemeinten Sache eine weit größere Nähe zu bestehen, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Diese sachliche Nähe kommt deutlich zum Ausdruck in dem Weihegebet der hl. Theresia von Lisieux "an die barmherzige Liebe des lieben Gottes": "Ich will keine Verdienste für den Himmel anhäufen, ich will einzig um deiner Liebe willen arbeiten, in der alleinigen Absicht, dich zu erfreuen... Am Abend dieses Lebens werde ich mit leeren Händen vor dir erscheinen, denn ich bitte dich nicht, Herr, meine Werke zu zählen. Alle unsere Gerechtigkeiten sind befleckt in deinen Augen. Ich will mich also mit deiner eigenen Gerechtigkeit bekleiden und von deiner Liebe den ewigen Besitz deiner selbst empfangen." Ähnlich formulieren viele Orationen in der Eucharistie. Offensichtlich sind sich katholische und evangelische Christen also trotz unterschiedlicher dogmatischer Formulierungen immer dann sehr nahe, wenn sie nicht über Gott und über den Glauben sprechen, sondern im Glauben vor Gott stehen und aus ihrem Glauben heraus im Gebet zu Gott sprechen. Sind wir heute also einig in Sachen Rechtfertigung, über die sich unsere Väter im 16. Jahrhundert getrennt haben?
3.4 Einig in der Rechtfertigungslehre?
Wenn wir heute nach 450 Jahren auf die Auseinandersetzungen des 16. Jahrhunderts über die Rechtfertigungslehre zurückschauen, dann müssen wir feststellen: Es ging damals um Fragen, die bleibende Fragen der Christen sind. Es wäre nicht gut um uns bestellt, würden uns diese Fragen heute nichts mehr bedeuten. Freilich spüren wir heute auch deutlich den Abstand der Zeit. Sowohl die Reformatoren wie die Väter von Trient waren Kinder ihrer Zeit, und sie sprachen die Sprache ihrer Zeit. Die katholische Seite war der Denk- und Sprechweise der mittelalterlichen Scholastik verpflichtet, Luther war in vielem von der Problematik des späten Mittelalters (Nominalismus) geprägt. So sprach man oft aneinander vorbei. Dazu kamen gegenseitige polemische Verzerrungen. Doch was in einer Zeit, da die Einheit zerbrach, von beiden Seiten oft in überscharfer Polemik gesagt wurde, sehen wir heute, da sich die Konfessionen wieder aufeinander zubewegen, ruhiger und sachlicher. So können wir heute viele Kontroversen, die durch sprachliche und sachliche Mißverständnisse entstanden sind, als Scheingegensätze erkennen. Wenn wir außerdem auf die in den widersprüchlichen Formulierungen gemeinte "Sache", besonders auf den persönlichen Vollzug des Glaubens schauen, dann ergibt sich uns in vielen Fragen eine erstaunliche Nähe und eine tiefe Gemeinsamkeit. Dafür dürfen wir dankbar sein. Denn es ist der Geist Gottes selbst, der uns zusammenführt (vgl. UR 1; 4).
So hat die ökumenische Diskussion der letzten Jahrzehnte in der Rechtfertigungslehre zu großen Fortschritten geführt. Viele katholische und evangelische Theologen sind heute der Meinung, daß die Rechtfertigungslehre als solche die beiden Kirchen nicht mehr zu trennen brauche, sondern daß eine Einigung in dieser Frage möglich sei. In der Rechtfertigungslehre muß man ja jeweils zwei Gesichtspunkte zusammendenken: die Gnade Gottes und das von ihr ermöglichte Mittun des Menschen im Glauben und im Tun. Die katholische und die protestantische Lehre bezüglich dieser Verhältnisbestimmung schließen sich nicht grundsätzlich aus; sie decken sich zwar nicht, aber sie sind füreinander offen (vgl. Evangelischer Erwachsenenkatechismus, S. 431-432).
Der trotz dieser Annäherung noch bestehende Unterschied betrifft vor allem die Stellung der Rechtfertigungslehre im Ganzen des Glaubens und des Lebens der Kirche. Im Verständnis der Kirche, ihrer Sakramente und Ämter bestehen noch immer wesentliche Unterschiede. Das zeigt, daß die Auseinandersetzung vor 400 Jahren, schaut man auf den Gesamtzusammenhang der Rechtfertigungslehre, nicht nur Mißverständnisse und nur unterschiedliche Begrifflichkeiten, Denkformen und Akzentuierungen betroffen hat, so daß in Wirklichkeit beide Parteien dasselbe meinten. Es bestehen zwischen der Lehre der Reformatoren und der katholischen Lehre auch Sachdifferenzen.
In diesen Einzelfragen zeigt sich ein unterschiedliches Gesamtverständnis des gemeinsamen christlichen Erbes. Während die Reformation stärker den Bruch der Sünde und ihre bleibende Macht auch im Leben des Gerechtfertigten herausstellt, sieht die katholische Lehre mehr die Einheit von Schöpfung und Erlösung, die durch die Sünde zwar gestört, aber nicht zerstört wurde. Deshalb kann sie auch deutlicher die heilende und heiligende Bedeutung der Gnade und die Bedeutung des Mittuns des Menschen im Heilswerk herausstellen. Das ist der tiefere Grund, weshalb sie nicht nur in personalen Kategorien das Stehen des Menschen vor Gott und sein Verhältnis zu Gott beschreibt, sondern auch in seinshaften (ontologischen) Kategorien über die Wirklichkeit der Sünde wie über die neue Wirklichkeit der Gnade spricht.
Die Überwindung der noch bestehenden Unterschiede erfordert einen geduldigen Dialog, in dem alte Vorurteile und Mißverständnisse abgebaut und beide Seiten sich um ein tieferes gegenseitiges Verständnis bemühen, um so im gemeinsamen Gehorsam gegenüber dem Wort und Werk Jesu Christi auch untereinander zusammenzuwachsen. Dazu gehört auch das Bemühen, die Botschaft von Rechtfertigung und Heiligung des Menschen in Treue zur Heiligen Schrift und zur Glaubensüberlieferung in der Sprache unserer Zeit neu zu sagen. Dieser Aufgabe müssen wir uns nunmehr zuwenden.
4. Gnade als Anfang und Anbruch der neuen Schöpfung
4.1 Der neue Mensch
Die biblische Botschaft von der Gerechtigkeit Gottes, von seiner Treue und Liebe entspricht einer bleibenden Frage und Not des Menschen. Sie ist heute so aktuell wie je zuvor. Wir erfahren heute sogar besonders eindringlich, daß wir uns nicht aus eigener Kraft aus unserer gnadenlosen Situation befreien können. Was immer wir unternehmen, steht selbst unter dem Gesetz der allgemeinen Unheilssituation, der keiner aus eigener Kraft entrinnen kann. Jeder Versuch der Selbstbefreiung schafft deshalb neue Konflikte und Entfremdungen. So bewegen wir uns ohne die Erlösung wie in einem Teufelskreis. Trotzdem können die Menschen es nicht aufgeben, auf endgültige Gerechtigkeit, Wahrheit und Liebe zu hoffen. Dazu ist ein qualitativ neuer Anfang notwendig, der nicht aus unserer Unheilsgeschichte ableitbar sein kann. Das aber bedeutet: Heil ist nur von Gott her möglich.
Diesen neuen Anfang verkündet Jesus mit der Botschaft vom Kommen der Herrschaft Gottes. Sie ist für ihn der Inbegriff des Heils und der Gnade und muß deshalb auch der Ausgangspunkt und die Grundlage unseres Sprechens von Gnade und Heil sein. Das Kommen der Herrschaft Gottes ist ja gleichbedeutend mit dem Offenbarwerden der Treue, der Gerechtigkeit, der Huld, des Erbarmens, der Liebe Gottes. Sie schenkt dem Menschen neue Zukunft und damit einen neuen Lebensraum. Sie bringt Gerechtigkeit im Sinn der rechten Ordnung gegenüber Gott und den Menschen. Die Schrift kann auch sagen: Leben, Licht, Heil, Friede. Die Gnade der Gottesherrschaft schenkt also Gemeinschaft und Freundschaft mit Gott und gibt Anteil an seinem Leben. Der Gott-Mensch Jesus Christus ist der neue Bund Gottes in Person, da in seiner Person Gottheit und Menschheit unlösbar und aufs innigste miteinander verbunden sind. In seinem Tod und in seiner Auferstehung ist das neue Leben endgültig erschienen, ist endgültig Hoffnung aufgerichtet worden. Deshalb ist er die urbildliche Verwirklichung der Gnade. Alle Begnadung des Menschen besteht darin, in die Wirklichkeit Jesu Christi hineingenommen zu werden. Durch die Gnade werden wir Adoptiv-Söhne und -Töchter nach dem Bild des einen und einzigen Sohnes. Diese Gotteskindschaft verwirklicht sich im Heiligen Geist. Allein im Geist können wir Gott als "Abba, Vater" anreden und sind wir untereinander Brüder und Schwestern. So besteht die Gnade letztlich darin, daß durch den Heiligen Geist die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist (vgl. Röm 5,5), daß der Heilige Geist in uns wohnt (vgl. Röm 8,9.11) und wir Tempel des Heiligen Geistes sind (vgl. 1 Kor 3,16-17; 6,19; Eph 2,22). Im Heiligen Geist durch Jesus Christus haben wir Anteil am Leben und an der Liebe des dreifaltigen Gottes. Damit ist die Verheißung des Alten Testaments in Erfüllung gegangen:
- "Ich schließe mit ihnen einen Friedensbund; es soll ein ewiger Bund sein... Ich werde mitten unter ihnen für immer mein Heiligtum errichten, und bei ihnen wird meine Wohnung sein. Ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein." (Ez 37,26-27)
Nimmt man alle diese vielfältigen Aussagen zusammen, dann ergibt sich: Die Gnade ist keine dinghafte Größe. Gnade ist Gott selbst in seiner Selbstmitteilung an uns durch Jesus Christus im Heiligen Geist. Gnade bedeutet deshalb im tiefsten, daß wirvon Gott durch Jesus Christus im Heiligen Geist unbedingt angenommen, bejaht und geliebt sind und daß wir in dieser Liehe ganz eins sind mit ihm. Gnade ist also personale Gemeinschaft und Freundschaft mit Gott, personale Teilhabe am Leben Gottes. Diese unbedingte Annahme in der Begegnung mit der unendlichen Liebe Gottes ist die letzte und höchste Erfüllung des Menschen, das Heil des Menschen.
Die lebendige und schöpferische Gegenwart Gottes und die innige Gemeinschaft mit ihm setzen die von Gottes Gnade getragene Bereitung des Menschen für Gott voraus, und sie haben die innere Verwandlung des Menschen zur Folge. Die Liebe Gottes ist ja schöpferisch, sie gestaltet den Menschen um und heiligt ihn. So schenkt die Gnade dem Menschen ein neues Sein; sie ist das Geschenk der Wiedergeburt zum neuen Leben, die Wirklichkeit der neuen Schöpfung. Der hl. Augustinus sagt: "Weil du mich geliebt hast, machst du mich liebenswürdig." In diesem Sinn wirkt die personale Gemeinschaft mit Gott die Vergöttlichung des Menschen, die seine wahre Vermenschlichung ist. Denn in der Vergöttlichung findet der Mensch seine höchste Vollendung.
Wir können demnach unterscheiden zwischen der ungeschaffenen Gnade, Gott selbst in seiner liebenden Selbstmitteilung an den Menschen, und der geschaffenen Gnade, die der Bereitung des Menschen dient und die gleichsam die Ausstrahlung der Liebe Gottes im Menschen ist. Bei der geschaffenen Gnade kann man nochmals unterscheiden zwischen der bleibenden gnadenhaften Bestimmung der Person, die heiligmachende Gnade, und der Bestimmung einzelner Akte des Erkennens und Wollens, die Aktgnade oder helfende Gnade (Erleuchtungs- und Stärkungsgnade). Diese Unterscheidungen mögen manchen zunächst als nichtssagend erscheinen. Sie meinen im Grunde, daß die eine Gnade Gottes eine dynamische Wirklichkeit ist, sie ist das Geschehen einer das ganze Leben umfassenden Verwandlung des Menschen. Denn die Aktgnade dient entweder der Vorbereitung auf die heiligmachende Gnade, oder aber sie ist deren Auswirkung und Intensivierung im Tun des Menschen. In dieser prozeßhaften Weise nimmt die Gnade immer mehr vom Menschen Besitz. Deshalb wäre es falsch zu meinen, die Gnade sei sozusagen unser Besitz. Der hl. Bonaventura, neben dem hl. Thomas von Aquin der bedeutendste Kirchenlehrer des Mittelalters, gebraucht die Formulierung: "Gott haben bedeutet von Gott gehabt werden". Die Gnade gehört nicht uns, vielmehr gehören wir durch die Gnade Gott. Die Gnade ist die Weise, wie wir schon jetzt in die Herrschaft Gottes hineingenommen und von ihr in Dienst genommen werden.
Leben aus der Gnade bedeutet Leben aus Glaube, Hoffnung und Liebe. Wir nennen sie die göttlichen Tugenden, weil sie uns von Gott geschenkt werden und weil sie Gott wiederum zum Ziel haben:
Im Glauben gründet der Mensch seine ganze Existenz auf Gott, er ist ihm Halt und Inhalt des Lebens. Diese Haltung vertrauenden Glaubens ist nur möglich als Antwort auf die geschichtliche Offenbarung der Treue und Verläßlichkeit Gottes. So ist der Glaube immer zugleich personaler Vertrauensglaube und inhaltlicher Bekenntnisglaube. Erst beides zusammen macht den lebendigen Glauben aus, der von der Liebe bewegt wird, im Unterschied zum bloßen Fürwahrhalten, dem toten Glauben. Ein solcher Glaube bedeutet für den Menschen Licht, das ihm Orientierung, Perspektive, Richtung, Sinn schenkt. Mit den "Augen des Glaubens" sieht er mehr und tiefer, als er mit den natürlichen Augen und mit dem natürlichen Licht der Vernunft wahrnehmen kann. Zwar ist der Glaube als die personale Überantwortung an das Geheimnis Gottes von seinem Wesen her vom Dunkel umgeben, weil unsere Augen, solange wir noch nicht in der Schau Gottes leben, das übergroße Licht Gottes nicht fassen können und gleichsam von ihm geblendet werden; ja wir können in unserem Glauben durch Fragen und Zweifel angefochten werden. Dennoch ist die Gewißheit des Glaubens über alle Zweifel erhaben. Sie stützt sich nicht auf menschliche Einsicht, sondern auf die uns im Glauben "einleuchtende" Wahrheit Gottes selbst, die uns auch die Wahrheit über uns selbst und über die Welt neu und endgültig erschließt. Der Glaube ist deshalb ein unschätzbares Gnadengeschenk für den Menschen.
In der Hoffnung richtet sich der Mensch aufgrund der im Glauben ergriffenen Treue Gottes ganz auf das in Jesus Christus bereits angebrochene kommende Reich Gottes aus; ihm ordnet er die irdischen Güter unter, um seinetwillen setzt er sie sogar hintan und erträgt in Tapferkeit und Geduld Leiden und Verfolgungen aller Art. Die christliche Hoffnung richtet sich sowohl gegen die Verzweiflung, die Vorwegnahme der Nichterfüllung wie gegen die Vermessenheit, d. h. jenes falsche Vertrauen in die eigene Tüchtigkeit und Leistung und in die irdischen Sicherheiten, die Vorwegnahme der Erfüllung. Die Hoffnung bewahrt vor allem vor der geistlichen Trägheit, dem Verharren im Diesseitigen und dem Widerwillen gegenüber dem Überschreiten der diesseitigen Welt mit ihren irdischen Erfüllungen, der Lustlosigkeit und Lauheit gegenüber dem religiösen Leben; sie befreit von der Dumpfheit und Sattheit des Alltags. Gegenüber allen diesen rein diesseitigen Einstellungen richtet sich die Hoffnung auf das je größere, alles umfassende und alles übertreffende höchste Gut, auf Gott selbst als der erst künftig voll offenbaren Erfüllung des Menschen und der Welt.
Die Liebe ist jene Freundschaft und Gemeinschaft mit Gott, in der der Mensch "mit ganzem Herzen und ganzer Seele" Gott über alles liebt (Mk 12,30 par.) und schon jetzt ganz eins wird mit ihm. Die Liebe zu Gott ist das volle, uneingeschränkte, vorbehaltlose Ja zu Gott und zu seinen Geboten (vgl. Joh 14,15-17; 15,9-10; 1 Joh 1,3-6), ein Ja, wie es nur der Freund sprechen kann, weil er den Geliebten ganz kennt und versteht (vgl. Joh 15,15). Solche Gottesliebe ist das Maß und die Vollendung des christlichen Lebens, wer ihrer ermangelt, ist geistlich ein Nichts (vgl. 1 Kor 13). In dem Maß, wie der Mensch sich in der Liebe zu Gott selbst vergißt und sich in liebender Hingabe auf Gott hin überschreitet, findet er in Gott auch seine wahre eigene Erfüllung; deshalb darf er in Gott und mit Gott auch die geschaffenen Güter lieben und sich ihrer erfreuen. Tugend ist Ordnung in der Liebe (Augustinus). Da Gott jeden Menschen absolut liebt, muß wahre Gottesliebe immer mit der Nächstenliebe verbunden sein (vgl. Mk 12,30-31 par.; Joh 13,34; 1 Joh 2,8-10; 1 Kor 13). Die Nächstenliebe ist sogar das Kriterium für die Echtheit der Gottesliebe (vgl. 1 Joh 4,20-21). Die Gottesliebe, die mit der Nächstenliebe verbunden ist, schenkt Freude, Friede und Mitleid; sie wirkt sich aus im Eifer und in der Leidenschaft für Gott und sein Reich. So nimmt der neue Mensch, der aus Glaube, Hoffnung und Liebe lebt, die volle Gemeinschaft mit Gott in der neuen künftigen Welt vorweg.
Die Gnade des Heiligen Geistes und ihre Verwirklichung in Glaube, Hoffnung und Liebe sind ein erster Anteil an der künftigen Herrlichkeit in der Herrschaft Gottes (vgl. 2 Kor 1,22, Eph 1,14). Wir sind ja auf Hoffnung hin erlöst (vgl. Röm 8,24), und wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung (vgl. 1 Petr 1,3). Die Gnade ist die schon jetzt gegenwärtige Kraft und Macht der künftigen Herrlichkeit. Deshalb bezeichnet die Theologie die Gnade als Anfang und Vorgeschmack des ewigen Lebens und als Vorwegnahme der Schau Gottes "von Angesicht zu Angesicht" (1 Kor 13,12). Kardinal J. H. Newman hat diesen Sachverhalt in dem bekannten Vers ausgedrückt: "In der Gnade ist die Glorie in der Fremde; in der Glorie ist die Gnade daheim." So wie alle Gnade von Gott herkommt, führt sie auch wieder zu ihm und in sein Reich zurück.
4.2 Die erneuerte Welt
Der Anbruch des Reiches Gottes geschieht nicht nur in der Innerlichkeit des Herzens. Schon im Alten Testament geschieht Gottes Heilshandeln in konkreten geschichtlichen Ereignissen. Die Erwählung Israels durch Gott wird erfahren in der Befreiung aus der Sklaverei Ägyptens, in der Führung durch das Schilfmeer und durch die Wüste, im Einzug ins verheißene Land, in der Errichtung des davidischen Königtums. Jesu Verkündigung der kommenden Herrschaft Gottes ist begleitet von wunderbaren Machttaten, Heilung von Kranken, Speisung von Hungrigen, Aufrichtung und Ermutigung von Hoffnungslosen. So ist die innere Gnade normalerweise mit der äußeren Gnade verbunden.
Dieser Zusammenhang zeigt sich in jedem Christenleben. Wir erfahren Gott und sein Heil normalerweise zunächst durch die Eltern, in der Familie, in der Begegnung mit anderen Menschen, in Liebe und Vergebung, in Worten, die ins Herz treffen, in besonderen guten wie bösen Lebenssituationen, aber auch in Büchern, in der Kunst, in der Natur. In solchen Erfahrungen leuchtet uns konkret auf, was Gnade ist: Vergebung und Geschenk eines neuen Anfangs, Befreiung von Schuld, Angst, Sinnlosigkeit. Positiv ausgedrückt: Liebe, Vertrauen, Wahrheit, Gemeinschaft und Freundschaft, Trost und Hoffnung. In alledem ist für den christlichen Glauben in menschlichen Erfahrungen jeweils mehr als nur Menschliches am Werk. Die menschliche Erfahrung ist Zeichen und Symbol dafür, daß Gottes Geist unter uns wirkt, um inmitten einer gnadenlosen Welt Gottes Reich heraufzuführen.
Gnade begegnet uns jedoch nicht nur von außen, sie wirkt auch wieder nach außen. In dem Maß, als Gott durch seinen Geist vom Menschen Besitz ergreift, wird und muß das neue Leben auch das Tun des Menschen bestimmen und sich im Tun der Wahrheit und der Gerechtigkeit, in Werken des Friedens und der Versöhnung auswirken. Das Leben aus der Gnade muß also zu Zeichen der beginnenden Erlösung der Welt führen. Das neue Leben Gottes muß in unserem Leben zeichenhaft konkret sichtbar werden; die Liebe zu Gott muß sich in der Liebe zum Nächsten verleiblichen und konkretisieren.
- "Wenn jemand sagt: Ich liebe Gott!, aber seinen Bruder haßt, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm: Wer Gott liebt, soll auch seinen Bruder lieben." (1 Joh 4,20-21)
Was dies konkret bedeutet, hat die Tradition in der Aufzählung der sieben Werke der leiblichen und der sieben Werke der geistlichen Barmherzigkeit zusammengefaßt:
- Die Hungrigen speisen, die Durstigen tränken, die Nackten bekleiden, die Fremden beherbergen, die Kranken besuchen, die Gefangenen erlösen, die Toten begraben.
- Die Unwissenden lehren, die Zweifelnden beraten, die Trauernden trösten, die Sünder zurechtweisen, den Beleidigern gerne verzeihen, die Unangenehmen ertragen, für alle beten.
Gegenwärtig versucht man, die beginnende Erlösung der Welt oft als Befreiung zu beschreiben. Dies geschieht nicht nur in der Theologie, sondern auch in lehramtlichen Aussagen, besonders in dem Apostolischen Schreiben von Papst Paul Vl. über die Evangelisierung in der Welt von heute (1975). Dabei muß man das Wort Befreiung freilich in einem tiefen und umfassenden Sinn verstehen; man darf es also nicht auf politische oder psychologische Befreiung einengen. Die Freiheit, zu der Jesus Christus uns befreit hat (vgl. Gal 5,1), ist die gnadenhaft von Gott geschenkte Freiheit. Sie äußert sich vor allem im Danken, in Lob und Preis Gottes und seiner Heilstaten, im Abba-Sagen des Gebets. Die Freiheit vor Gott befreit zugleich zur Freiheit und zum Dienst in der Welt.
Konkret meint die Befreiung durch Jesus Christus Befreiung von der Sünde, vom Gesetz und vom Tod. Die Freiheit von der Sünde bedeutet, daß der unfrei machende Bann des Bösen gebrochen ist. Die Sünde verkörpert sich oft in drückenden und unterdrückten Strukturen, in entfremdenden menschlichen, wirtschaftlichen und politischen Konstellationen, die dann ihrerseits wieder Anlaß zu egoistischem Verhalten geben, zu Neid und Streit, zu Unfrieden und Gewalttätigkeit. Die christliche Freiheit muß sich darin bewähren, solche Unrechtssituationen nach Kräften zu verändern und Ordnungen der Freiheit, der Gerechtigkeit und der Wahrheit herbeizuführen. Die gnadenhafte Befreiung vom Gesetz meint Befreiung von Gesetzlichkeit aller Art. Gesetzlichkeit bedeutet, sein Leben allein durch Werke, Arbeit, Leistung, Erfolg, Ansehen, Macht zu erfüllen. Das erzeugt Überforderung, Druck und Streß. Freiheit vom Gesetz heißt also etwa, Freiräume und Freizeiten zu schaffen für Muße, Fest und Feier, für Geselligkeit und Erholung. Die Befreiung vom Tod kann und muß dazu führen, Lebensängste nach Möglichkeit abzubauen, Mut und Hoffnung zu wecken und gegen eine weit verbreitete lebensfeindliche Mentalität dem Leben zu dienen, ihm Raum zu schaffen, es zu hegen und zu pflegen. Dazu gehört das Speisen der Hungrigen ebenso wie die Sorge für Behinderte und Alte sowie der Schutz des ungeborenen Lebens.
Das alles zeigt: Sowenig die christlich verstandene Befreiung auf die politische Befreiung eingeschränkt werden kann, sowenig meint sie doch eine rein innerliche Gesinnung oder eine rein private Praxis. Sie hat eine politische Dimension und schließt den Einsatz für Gerechtigkeit, Frieden, Freiheit und Wahrheit notwendig ein. Der Christ muß sich für eine Ordnung des privaten und öffentlichen Lebens einsetzen, in der - in einem allgemeineren Sinn verstanden - Gnade kein leeres Wort ist.
Dies alles darf nicht in einem schwärmerischen Sinn mißverstanden werden. Mit alledem können wir das Reich Gottes nicht aufbauen; dieses ist Gottes Tat. Freilich will Gott unter uns und durch uns handeln. So begründet die Botschaft vom Reich Gottes zwar keine innerweltliche Utopie, sondern eine endzeitliche Hoffnung; diese will und soll aber schon in dieser Welt zeichenhaft konkret werden. Wir können nämlich in der Kraft des Heiligen Geistes und seiner Freiheit Zeichen des kommenden Reiches Gottes setzen und Gottes Herrschaft schon jetzt in dieser Welt in fragmentarischer Gestalt und in schattenhaften Vorentwürfen aufleuchten lassen. Natürlich nützt die Veränderung der äußeren Verhältnisse wenig, wenn sich nicht auch die Herzen der Menschen ändern; aber oft genug können sich die Herzen der Menschen kaum ändern, solange die Verhältnisse, menschlich betrachtet, alle Hoffnung niederhalten und egoistische und gewalttätige Haltungen und Handlungen erzeugen. Jedes Entweder-Oder ist hier fehl am Platz. Im christlich verstandenen Heil geht es um den ganzen Menschen und um die ganze Welt. Diese ganzheitliche Befreiung geschieht konkret dadurch, daß der Mensch aus der Macht der Sünde herausgerufen und in den neuen Lebenszusammenhang, in die Gemeinschaft der Glaubenden und Erlösten hineingerufen wird, dadurch, daß er Glied wird in der Kirche. Sie ist das große Heilszeichen Gottes in der Welt.
II. Die Kirche als Sakrament des Geistes
1. Schwierigkeiten mit der Kirche
Auf die Frage nach dem Ort des Heiligen Geistes antwortet das Glaubensbekenntnis der Kirche mit der Aussage: "Ich glaube (an) die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche". Die Kirche bekennt also, daß in ihr und durch sie der Geist Jesu Christi weiterwirkt in der Geschichte. Sie glaubt, daß sie der Ort, ja das Sakrament, d. h. das Zeichen und das Werkzeug des Wirkens des Heiligen Geistes ist.
Kaum eine andere Glaubensaussage erregt so viel Unverständnis, Widerspruch, ja Feindseligkeit wie diese. Auch viele praktizierende katholische Christen haben Schwierigkeiten mit der Kirche. Nicht wenige sagen: "Jesus, ja - Kirche, nein!" Der Haupteinwand gegen die Kirche lautet, sie habe in ihrer Geschichte die ursprüngliche Botschaft Jesu verraten. Denn Jesus - so wird eingewandt - war arm und ist für die Armen eingetreten; die Kirche dagegen sei reich, paktiere mit den Reichen und Mächtigen und habe vor der sozialen Frage versagt. Jesus predigte die Liebe bis zur Feindesliebe; die Kirche dagegen sei intolerant und verfolge, wie vor allem die Inquisition zeigt, ihre Gegner mit brutaler Grausamkeit. Jesus rief die Menschen zur Nachfolge, vor allem zur praktischen Tat der Liebe; die Kirche dagegen verlange Gehorsam gegenüber unfehlbaren Dogmen. Jesus verhielt sich unbefangen, offen und verständnisvoll gegenüber Frauen; die Kirche dagegen habe die Frau abgewertet und die Sexualität verteufelt, sie mißgönne dem Menschen das Glück und vertröste ihn auf das Jenseits. Für andere wiederum ist die Kirche geistig, kulturell, wissenschaftlich rückständig und letztlich überholt.
Was soll ein katholischer Christ zu diesem "Sündenregister" sagen? Er braucht nichts zu beschönigen oder zu vertuschen. Gerade die Kirche, die die Vergebung der Sünden verkündet, kann im Vertrauen auf Gottes Vergebung ihre eigene Schuld bekennen wie Papst Hadrian Vl. beim Reichstag zu Nürnberg (1522/1523) oder Papst Paul Vl. während des II. Vatikanischen Konzils (1962-1965). Der Christ braucht also die Schattenseiten der Kirchengeschichte nicht zu leugnen. Er darf aber in aller Bescheidenheit auch an die Lichtseiten erinnern: an die Kirche der Märtyrer, die den Mächtigen widerstanden haben, an die Kirche der Heiligen, die das Evangelium in heroischer Weise gelebt haben, an Zeugen bis in unsere Gegenwart: Pater Maximilian Kolbe, Mutter Teresa und viele andere, an die Werke der Caritas, die es zu allen Zeiten gegeben hat, heute vor allem im Dienst an den Armen in der Dritten Welt, an den Beitrag der Kirche zum Frieden, sowohl im Mittelalter wie in der Gegenwart, an den Beitrag des Christentums zur Anerkennung der einmaligen Würde der Person, der Würde der Frau und der Freiheit des Gewissens. Man denke sich nur einen Augenblick die Kirche aus der Geschichte unserer abendländischen Kultur weg und frage, was dann noch übrig bleibt. Man denke sich die sozialen und karitativen Einrichtungen der Kirchen in unserer gegenwärtigen Gesellschaft weg und frage, wie es dann aussehen würde. Damit ist das Wichtigste noch gar nicht gesagt. Die Kirche hat vor allem bis heute die Erinnerung an Jesus Christus wachgehalten. Ohne sie gäbe es kein Evangelium und keine Heilige Schrift; ohne sie wüßten wir nichts von Jesus Christus und der Hoffnung, die er uns gebracht hat.
Weder einseitige Polemik noch einseitige Apologetik werden der Kirche gerecht. Doch Licht- und Schattenseite der Kirche in Geschichte und Gegenwart lassen sich nicht gegeneinander aufrechnen. Das letztentscheidende Urteil des Christen über die Kirche kann nur im Glauben gefällt werden. Nicht umsonst heißt es im Glaubensbekenntnis: "Ich glaube (an) die Kirche". Die Kirche ist also einbezogen in unseren Glauben an Gottes Heil durch Jesus Christus im Heiligen Geist. Sie ist letztlich eine Wirklichkeit des Glaubens. Der Glaubende bekennt, daß in der äußerlich sichtbaren, manchmal recht armseligen Gestalt der Kirche in geschichtlicher Vorläufigkeit und sündiger Gebrochenheit Gottes Geist am Werk ist. Der Glaube bestreitet also nichts und schließt nichts aus von dem, was an der Kirche sichtbar ist und stets der Reinigung und der Erneuerung bedarf; er sieht jedoch in der sichtbaren Wirklichkeit der Kirche eine tiefere und umfassendere Wirklichkeit am Werk. So gilt von der Kirche in verstärktem Maß, was der Apostel Paulus von sich selber sagt: Sie trägt die Reichtümer Jesu Christi in irdenen Gefäßen, damit deutlich wird, daß das Übermaß der Kraft von Gott kommt und nicht von uns (vgl. 2 Kor 4,7).
2. Die Kirche in der Geschichte Gottes mit den Menschen
2.1 Die Kirche in der Heilsgeschichte
Der Ursprung der Kirche reicht bis in die Anfänge der Menschheitsgeschichte zurück. Gott beruft und heiligt den Menschen ja nicht als isoliertes Individuum, sondern als ein Wesen, das auf Gemeinschaft angelegt ist und nur in Gemeinschaft seine Erfüllung finden kann (vgl. LG 9; GS 32). Niemand kann allein glauben und allein Christ sein; keiner kann sich das Evangelium selber sagen. Jeder ist darauf angewiesen, daß ihm der Glaube von anderen bezeugt wird und daß er von anderen in seinem Glauben getragen und gestützt wird. Jeder ist hineingenommen in die große Kette der Glaubenden und in die Zeiten und Räume umgreifende Gemeinschaft der Glaubenden. So hat Gott von Anfang an die Menschen nicht als einzelne versprengte gläubige Seelen berufen, sondern ein Volk gesammelt, in dem und durch das jeder einzelne getragen wird und in dem er selbst die anderen trägt.
Die Sammlung des Volkes Gottes wird seit Anfang der Welt vorausbedeutet. Sie beginnt in dem Augenblick, da die Sünde die Gemeinschaft mit Gott und der Menschen untereinander zerstörte. Die Sammlung des Volkes Gottes ist sozusagen Gottes Gegenaktion zu dem durch die Sünde verursachten Chaos. Sie beginnt nach der Überzeugung der Kirchenväter bereits mit dem gerechten Abel und geschieht verborgen unter allen Völkern (vgl. LG 2; 13; 16). "Zu aller Zeit und in jedem Volk ruht Gottes Wohlgefallen auf jedem, der ihn fürchtet und gerecht handelt (vgl. Apg 10,35)" (LG 9).
Die Vorbereitung und die öffentliche Geschichte der Sammlung des Volkes Gottes beginnt mit der Berufung Abrahams, dem Gott die Verheißung gab, er werde Stammvater eines großen Volkes sein (vgl. Gen 12,2; 15,5-6). Die eigentliche Vorbereitung setzt mit der Erwählung Israels zum Eigentumsvolk Gottes ein (vgl. Ex 19,5-6; Dtn 7,6). Israel soll durch seine Erwählung Zeichen sein für die endzeitliche Sammlung aller Völker (vgl. Jes 2,1-5; Mi 4,1-4). Doch schon die Propheten klagen Israel an, weil es den Bund gebrochen hat und zu einer Dirne geworden ist (vgl. Hos 1; Jes 1,2-4; Jer 2 u. a.). Sie kündigen einen neuen Bund an, durch den Gott sich ein neues Volk erwählen wird (vgl. Jer 31,31-34).
An diese Verheißung knüpft Jesus an. Seine ganze Verkündigung und sein ganzes Auftreten stehen im Horizont des Reiches Gottes. Durch diese Botschaft leitet er die endzeitliche Sammlung Israels ein. Diese Sammlungsbewegung ist die Grundlage für die Kirche. Das wird vor allem daran deutlich, daß er aus dem weiteren Kreis seiner Jünger die Zwölf in seine engere Gemeinschaft berufen und in besonderer Weise an seiner Sendung zur Verkündigung beteiligt hat (vgl. Mk 3,13-19; 6,6b-13). Die Zahl zwölf ist nämlich nicht zufällig; die Zwölf sollen vielmehr die zwölf Stämme Israels repräsentieren (vgl. Mt 19,28; Lk 22,30). Die Zwölf sind deshalb auch die Grundsteine des neuen Jerusalem (vgl. Offb 21,12-14). Außerdem nimmt Jesus in den Mahlgemeinschaften, die er mit den Seinen feiert, die endzeitliche himmlische Mahlgemeinschaft vorweg. Dies geschieht vor allem beim letzten Mahl am Abend vor seinem Tod (vgl. Mk 14,22-25 par.). Die Eucharistiefeiern der Urgemeinde nehmen diese Mahlgemeinschaften Jesu auf und verwirklichen sie in der neuen Situation nach Tod und Auferstehung Jesu in neuer Weise. So ist die Kirche, ihre Verkündigung, die Feier der Eucharistie, die Vollmacht des apostolischen Amtes schon beim irdischen Jesus grundgelegt.
Ihre eigentliche Begründung hat die Kirche in Kreuz und Ruferweckung Jesu Christi. Die kirchenbegründende Bedeutung des Kreuzes kommt vor allem dadurch zum Ausdruck, daß in den eucharistischen Texten vom Blut des Bundes (vgl. Mk 14,24) bzw. des neuen Bundes (vgl. Lk 22,20; 1 Kor 11,25) die Rede ist. Der Tod Jesu ist demnach die Begründung des neuen Bundes und des Volkes Gottes im neuen Bund. Das Johannesevangelium sagt, daß Jesus als der ans Kreuz und zur Rechten des Vaters Erhöhte alle an sich zieht (vgl. Joh 12,32). Das Blut und das Wasser, die aus der geöffneten Seite des gekreuzigten Jesus entströmen (vgl. Joh 19,34), symbolisieren nach der Auslegung der Kirchenväter die beiden Grundsakramente der Kirche: die Taufe und die Eucharistie. So kann man mit den Kirchenvätern sagen, die Kirche sei aus der Seitenwunde Jesu entstanden (vgl. SC 5). Das Kreuz darf nicht von der Auferstehung und ihrer kirchengründenden Bedeutung getrennt werden. Durch die Osterereignisse wurde die zerstreute Jüngerschar wieder gesammelt, zugleich erhielten die Osterzeugen die Sendung, alle Völker zu Jüngern Jesu zu machen und sie zu taufen (vgl. Mt 28,19-20). Schließlich wird die Gründung der Kirche durch die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten vollendet und als das neue Volk Gottes aus den vielen Völkern der Erde öffentlich kundgemacht (vgl. Apg 2; LG 2 ; 5). Der Heilige Geist ist ja gleichsam das Lebensprinzip der Kirche.
Aus alledem folgt, daß die Kirche zwar nicht durch ein besonderes Wort oder durch einen besonderen Akt Jesu gegründet oder gestiftet worden ist. Die Kirche ist aber im Ganzen der Geschichte Gottes mit den Menschen begründet; sie erwächst der Gesamtdynamik der Heilsgeschichte. Man kann deshalb von einer gestuften Kirchengründung sprechen: vorausbedeutet seit Anfang der Welt, vorbereitet durch die Geschichte des alten Bundesvolkes, grundgelegt durch das Wirken des irdischen Jesus, verwirklicht durch Kreuz und Auferstehung Jesu, geoffenbart durch die Ausgießung des Heiligen Geistes (vgl. LG 5).
Die Kirche, die im Ganzen der schon geschehenen Geschichte Gottes mit den Menschen begründet ist, ist noch unterwegs zu ihrer endzeitlichen Vollendung. Sie ist pilgernde Kirche, die in ihren Sakramenten und Einrichtungen, die noch zu dieser Weltzeit gehören, die Gestalt dieser Welt trägt; sie "zählt selbst so zu der Schöpfung, die bis jetzt noch seufzt und in Wehen liegt und die Offenbarung der Kinder Gottes erwartet (vgl. Röm 8,19-22)" (LG 48). In der Kirche sind aber die Kräfte des kommenden Reiches Gottes schon wirksam; besonders in der Feier der Liturgie wird die endzeitliche Verherrlichung Gottes schon jetzt vorweggenommen (vgl. LG 50-51; SC 8). Dennoch ist die Kirche noch nicht das Reich Gottes. Sie nimmt vielmehr an der Knechtsgestalt Jesu teil: Sie ist die Kirche der Armen und der Leidenden; sie ist die Kirche der Sünder, sie ist stets der Reinigung bedürftig und muß immerfort den Weg der Buße und der Erneuerung gehen; sie ist schließlich die verfolgte Kirche, die ihren Weg durch Prüfungen und Trübsale hindurch gehen muß (vgl. LG 8). So ist sie nur "Keim und Anfang" des Reiches Gottes auf Erden (LG 5). Sie ist ein messianisches Volk und "für das ganze Menschengeschlecht die unzerstörbare Keimzelle der Einheit, der Hoffnung und des Heils" (LG 9). Wir werden uns zu fragen haben, was dies für die Sendung der Kirche in Geschichte und Gesellschaft bedeutet.
2.2 Die Kirche in Geschichte und moderner Gesellschaft
Im Ursprung der Kirche wird bereits etwas von ihrem Wesen deutlich: Die Sammlung der Kirche zielt auf ihre Sendung in die Welt. Beides, Sammlung und Sendung, gehören untrennbar zusammen.
Die konkrete Verwirklichung der Sendung der Kirche hat im Laufe ihrer Geschichte unterschiedliche Gestalten angenommen. Die frühe Kirche wußte sich als ein neues, der Gottesherrschaft verpflichtetes Volk in der Welt der Völker. Sie stand als kleine Herde dem großen römischen Reich gegenüber. Sie wollte dem Kaiser geben, was des Kaisers ist (vgl. Mt 22,21), anerkannte loyal die staatliche Ordnung und schloß Kaiser und Reich in ihre Fürbitte ein. Sie wußte freilich auch, daß sie nicht von dieser Welt ist (vgl. Joh 17,16) und daß man Gott mehr gehorchen muß als den Menschen (vgl. Apg 5,29). Diese Einstellung führte in den Christenverfolgungen der ersten Jahrhunderte zu schweren Konflikten zwischen Staat und Kirche. Doch das Blut der Christen erwies sich als Same neuer Christen (Tertullian). Die wachsende Bedeutung des Christentums führte dazu, daß Kaiser Konstantin im Mailänder Edikt (313) das Christentum als erlaubte Religion anerkannte; sein Nachfolger Theodosius machte es 380 zur offiziellen Staatsreligion. Diese sogenannte konstantinische Wende bedeutet einen der wichtigsten Einschnitte der Kirchengeschichte. Die Kirche wurde zu einer staatlichen und gesellschaftlichen Macht und erlag oft genug auch der Versuchung der Macht und des Reichtums.
Im Mittelalter bildeten Kirche und Reich die eine Christenheit, in der Geistliches und Weltliches unlösbar miteinander verbunden waren. Die Bischöfe waren zugleich Reichsfürsten, der Kaiser und die Könige beanspruchten geistliche Vollmacht. Während sich im Osten, in Byzanz und später in Moskau ein vom Kaiser bestimmtes Staatskirchentum durchsetzte (Cäsaropapismus), kam es in der Westkirche schon früh zum Kampf um die Freiheit der Kirche vom Staat. Im Westen konstituierte sich die Kirche unter Führung des Papstes immer mehr als eine eigenständige, hierarchisch geordnete Größe. In dieser mächtigen "Papstkirche" wurde der Ruf nach der Freiheit der Kirche schon bald zum Ruf nach der Freiheit von der äußeren hierarchischen Macht der Kirche, zum Ruf nach einem rein geistlichen Verständnis der Kirche. Besonders im späten Mittelalter wurde die Forderung nach Reform der Kirche an Haupt und Gliedern immer stärker. Da diese Reform nicht rechtzeitig gelang, kam es zu einer der schlimmsten Katastrophen der Christenheit, zur Kirchenspaltung im Gefolge der Reformation.
Luther unterschied zwischen dem weltlichen Regiment und der Kirche. Er kritisierte vor allem die Verbindung kirchlicher Ämter mit weltlichen Herrschaftsfunktionen. Die Kirche ist für ihn die Gemeinschaft der wahrhaft Gläubigen. Sie ist überall dort, wo das Evangelium rein gepredigt und die Sakramente dem Evangelium gemäß verwaltet werden (vgl. CA 7). Deshalb wird die Kirche nicht wie ein weltliches Regiment durch äußere Gewalt regiert, sondern ohne alle Gewalt allein durch das Wort Gottes (vgl. CA 28). Zur Kirche gehören zwar äußere Verkündigung und Sakramentenspendung und daher auch ein von Gott eingesetztes Amt (vgl. CA 5). Die Herrschaft Christi über die Kirche ist aber unter dieser empirischen Gestalt der Kirche verborgen. Die wahre Kirche ist nach Luther eine verborgene Größe. Die Folge dieser Unterscheidung zwischen der sichtbaren und der verborgenen Kirche war freilich, daß Luther den äußeren Schutz und die äußere Ordnung der Kirche den Fürsten anvertrauen mußte und so die Kirche bis in unser Jahrhundert in neue Abhängigkeit von der weltlichen Gewalt brachte.
Nach katholischer Überzeugung gehören auch die sichtbare Seite der Kirche sowie deren sakramentale und hierarchische Verfassung zur wahren Kirche. So verstand sich die römisch-katholische Kirche der Neuzeit als eine gegenüber dem Staat eigenständige, sichtbare, hierarchisch verfaßte Größe. Im Gefolge der Aufklärung, der Französischen Revolution und der Säkularisation wurde sie nicht selten in die Rolle einer Burg im Belagerungszustand gedrängt. Dies war der geschichtliche Kontext des I. Vatikanischen Konzils (1869/1870) und seiner Definition des Jurisdiktionsprimats und der Unfehlbarkeit des Papstes.
Das II. Vatikanische Konzil (1962-1965) bedeutet wieder einen grundlegenden Einschnitt. Erstmals in ihrer Geschichte sieht sich die Kirche einer globalen und universalen Weltsituation konfrontiert. Ihre bisher weithin "abendländische" Gestalt muß nunmehr zu einer "weltkirchlichen" Gestalt werden. Dazu gehört auch, daß das Konzil bewußt Abschied genommen hat von der inzwischen auch geschichtlich überholten sogenannten konstantinischen Gestalt der Kirche.
Der Ausgangspunkt und die Grundlage für die rechte Bestimmung des Verhältnisses von Kirche und heutiger Welt ist die der Kirche aufgetragene Botschaft vom Kommen des Reiches Gottes. Das bedeutet, daß das Ziel der Kirche das endzeitliche Heil ist, das erst in der künftigen Welt voll verwirklicht werden kann (vgl. GS 40). Die Kirche ist zwar als sichtbares Gefüge verfaßt (vgl. LG 8; GS 40), aber sie ist hinsichtlich ihrer Aufgabe und Zuständigkeit von der politischen Gemeinschaft verschieden und an kein politisches System gebunden. Indem die Kirche ihre eigene und eigenständige Sendung herausstellt, anerkennt sie zugleich die legitime Eigenständigkeit der weltlichen Sachbereiche, besonders des Staates (vgl. GS 36; 56; 76, AA 7). Sie tritt für Religionsfreiheit als Ausdruck der Würde der Person ein (vgl. DH).
Diese Unterscheidung der Zuständigkeitsbereiche von Kirche und Welt (Gesellschaft, Kultur, Politik u. a.) bedeutet freilich keine Scheidung. Jesus Christus ist ja der Schlüssel und Mittelpunkt, das Ziel der ganzen Menschheitsgeschichte; er ist der Punkt, auf den hin alle Bestrebungen der Geschichte und der Kultur konvergieren, der Mittelpunkt der Menschheit, das Alpha und das Omega (vgl. GS 10; 45). Aus dieser Botschaft fließen Auftrag, Licht und Kraft zum Aufbau der menschlichen Gemeinschaft (vgl. GS 42; AA 5). Deshalb nimmt die Kirche das Recht in Anspruch, "auch politische Angelegenheiten einer sittlichen Beurteilung zu unterstellen, wenn die Grundrechte der menschlichen Person oder das Heil der Seelen es verlangen" (GS 76; vgl. DH 14). Die "Spaltung bei vielen zwischen dem Glauben, den man bekennt, und dem täglichen Leben gehört zu den schweren Verirrungen unserer Zeit ... Man darf keinen künstlichen Gegensatz zwischen beruflicher und gesellschaftlicher Tätigkeit auf der einen Seite und dem religiösen Leben auf der anderen konstruieren. Ein Christ, der seine irdischen Pflichten vernachlässigt, versäumt damit seine Pflichten gegenüber dem Nächsten, ja gegen Gott selbst und bringt sein ewiges Heil in Gefahr" (GS 43).
Im Bereich der Welt soll die Kirche freilich nicht auf die Weise der Welt durch weltliche Mittel wirken; sie soll vielmehr die zeitliche Ordnung von innen her mit dem Geist des Evangeliums durchdringen. Sie ist "gewissermaßen der Sauerteig und die Seele der in Christus zu erneuernden ... menschlichen Gesellschaft" (GS 40). Das Konzil zitiert den Brief an Diognet (2./3. Jh.): "Was die Seele im Leibe ist, das sollen in der Welt die Christen sein" (LG 38). Hier liegen vor allem die Sendung und Verantwortung der christlichen Laien. Dabei muß jeweils sorgfältig unterschieden werden zwischen dem, was im Namen der Kirche für alle verbindlich gesagt und getan werden kann, und dem, wofür einzelne Christen als Glieder der menschlichen Gesellschaft aus ihrem christlichen Gewissen heraus in der Gesellschaft eintreten (vgl. LG 36; GS 76). Beim letzteren können Christen auf der Grundlage und innerhalb der Grenzen des gemeinsamen Glaubens auch zu einem unterschiedlichen Urteil kommen (vgl. GS 43).
Was ergibt sich daraus für den Dienst der Kirche an der Welt? Weil die Kirche mit Nachdruck darauf verweist, daß der Mensch allein in Gott seine Erfüllung findet (vgl. GS 21; 41), ist sie "Zeichen und Schutz der Transzendenz der menschlichen Person" (GS 76). Damit vertritt die Kirche die Würde der menschlichen Person und deren Vorrang vor der Institution und vor den Sachgütern. Die christliche Botschaft von der Hoffnung auf die neue Erde und den neuen Himmel ist zugleich eine Ermutigung zum Einsatz in der Welt, weil alles, was in Liebe und aus Liebe getan wird, in gereinigter und verklärter Form eingehen wird in den endgültigen Bestand der Wirklichkeit (vgl. GS 39). Da die Kirche kraft ihrer Sendung und Natur an keine besondere Form menschlicher Kultur und an kein besonderes politisches und wirtschaftliches oder gesellschaftliches System gebunden ist, kann sie kraft dieser ihrer Universalität ein Band des Friedens und der Versöhnung zwischen den Menschen, zwischen den Rassen und Klassen, den Völkern und den Kulturen sein (vgl. GS 42). Mit alledem kommt der Kirche ein Wächteramt zu im Interesse der Würde des Menschen und der Einheit der Menschen. Immer wieder muß sie das Gewissen der Gesellschaft sein, wenn es um die grundlegenden Werte des Menschen und des menschlichen Zusammenlebens geht. Sie muß vor allem immer wieder auf die Vorläufigkeit der Welt hinweisen und so aller Verabsolutierung und Vergötzung irdischer Größen, sei es Geld, Macht, Genuß, wehren. Auch damit dient sie der größeren Freiheit und Hoffnung des Menschen.
Bei einer solchen dialogischen Verhältnisbestimmung von Kirche und Welt erfährt auch die Kirche von der heutigen Welt vielfache Hilfe. Denn die Kirche muß die Botschaft Christi in der Vorstellungswelt und Sprache der verschiedenen Völker aussagen und diese Botschaft mit Hilfe der Weisheit der Philosophen verdeutlichen (vgl. GS 44). Dabei übernimmt und fördert die Kirche Anlagen, Fähigkeiten und Sitten der Völker, soweit sie gut sind; sie reinigt, kräftigt und hebt sie aber auch (vgl. LG 13). In dieser Weise können auch die Fragen einer Zeit, die profanen Wissenschaften, Literatur und Kunst vieles beitragen für ein genaueres, tieferes und zeitgemäßeres Verständnis des Glaubens (vgl. GS 62). Das zeigt nochmals: Die Kirche ist Volk Gottes auf dem Wege. Sie lebt und wirkt nicht nur in der Geschichte; sie hat selbst eine Geschichte. Sie muß immer neu wachsen zum Vollmaß der Fülle Christi (vgl. Eph 4,13).
2.3 Die Heilssendung (Mission) der Kirche
Bei all den vielen und einschneidenden Wandlungen, denen die konkrete Ausübung des kirchlichen Heilsauftrags je nach den Umständen von Ort und Zeit in der Geschichte unterlag, bleibt die Kirche doch in allen Zeiten und für alle Zeiten das eine allumfassende Sakrament des Heils (vgl. LG 48). Alle Menschen sind zu ihr gerufen, allen ist sie zum Heil notwendig. Denn es gibt nur einen Mittler des Heils, Jesus Christus (vgl. Apg 4,12; 1 Tim 2,5). Nur wer an ihn glaubt und auf seinen Namen getauft wird, kann das Heil erlangen (vgl. Mk 16,16, Joh 3,5). Damit ist zugleich die Heilsnotwendigkeit der Kirche ausgesagt. Denn Glaube und Taufe sind die Tür, durch die wir in die Kirche eintreten.
- "Darum könnten jene Menschen nicht gerettet werden, die um die katholische Kirche und ihre von Gott durch Christus gestiftete Heilsnotwendigkeit wissen, in sie aber nicht eintreten oder in ihr nicht ausharren wollten."(LG 14; vgl. AG 7)
Diese positive Aussage, daß das Heil nur in und durch Jesus Christus möglich ist, daß man Christus aber in der Kirche begegnet, wird oft auch negativ formuliert: "Außerhalb der Kirche kein Heil". Dieser Satz ist mißverständlich, und er ist heute vielen sogar ganz und gar unverständlich. Sie fragen: Sollen wir wirklich glauben, daß alle Menschen guten Willens, die nie von Christus und Kirche gehört haben, aber gut, gerecht und fromm leben, in die Hölle fahren? Soll dies gar auch von den nicht römisch-katholischen Christen gelten? Wie soll eine solche Lehre vereinbar sein mit der Gerechtigkeit und der Liebe Gottes gegenüber allen Menschen? Wie soll sie vereinbar sein mit der Solidarität der Christen mit allen Menschen?
Der Satz "Außerhalb der Kirche kein Heil" richtet sich ursprünglich mahnend an solche Christen, die in der Kirche sind und also um sie wissen, die aber drauf und dran sind, die Kirche zu verlassen. In diesem Zusammenhang will der Satz sagen, daß diejenigen, welche die Kirche verlassen, auch das Heil verlieren. Erst später bekam dieser Satz einen allgemeineren Sinn; er bezog sich jetzt auf alle, die tatsächlich nicht zur römisch-katholischen Kirche gehören. Manche Formulierungen sind sehr eng gehalten; das gilt vor allem von der Bulle "Unam sanctam" von Papst Bonifaz VIII. (1302) (vgl. DS 875; NR 430) und vom Dekret des Konzils von Florenz für die Jakobiten (1442) (vgl. DS 1351; NR 381). Diese scharfen Formulierungen müssen auf dem Hintergrund des damaligen Weltbildes gesehen werden. Man ging davon aus, daß das Evangelium in aller Welt bezeugt ist und setzte deshalb voraus, daß es nur eigene Schuld des Menschen sein kann, nicht im Schoß der einen römisch-katholischen Kirche zu sein. Als man zu Beginn der Neuzeit neue Kontinente und vom Christentum völlig unberührte Kulturen entdeckte, stellte die Kirche schon 1713 fest, daß es auch außerhalb der sichtbaren römisch-katholischen Kirche Gnade gibt (vgl. DS 2429). Papst Pius IX. lehrte ausdrücklich, daß Gott denen seine Gnade nicht versagt, die nach ihrem Gewissen leben, aber ohne ihre Schuld die Kirche Christi nicht kennen, sondern den Willen Gottes so tun, wie sie ihn in ihrer Situation erkennen können (vgl. DS 2866). Pius XII. hat dies nochmals ausdrücklich festgestellt (vgl. DS 3869). Das II. Vatikanische Konzil hat diese Lehre bestätigt, weitergeführt und wesentlich vertieft. Es hat an die Aussage der Heiligen Schrift erinnert, daß Gott das Heil aller Menschen will (vgl. 1 Tim 2,4), aber auch, daß sich der Mensch den Heilswillen Gottes zu eigen machen muß (vgl. LG 16).
Der Satz "Außerhalb der Kirche kein Heil" meint also: Die Kirche ist das eine allumfassende Heilssakrament. Wer sie durch eigene Schuld ablehnt, kann nicht im Heil sein. Nicht im Heil ist freilich auch, wer der Kirche nur äußerlich, nur dem Leibe nach, nicht aber dem Herzen nach angehört. Wer aber ohne eigene Schuld die Kirche nicht kennt, der kann im Heil sein, wenn er den Willen Gottes nach bestem Wissen und Gewissen so tut, wie er ihn in seiner Situation konkret erkennt.
Da die Kirche das eine alle umfassende Heilssakrament ist, tatsächlich aber viele Menschen der Kirche ohne eigene Schuld nicht angehören, gibt es verschiedene Weisen und Grade der Zugehörigkeit zur Kirche. Der Gemeinschaft der Kirche voll eingegliedert sind diejenigen, die im Besitz des Geistes Christi "durch die Bande des Glaubensbekenntnisses, der Sakramente und der kirchlichen Leitung und Gemeinschaft" mit ihr verbunden sind. Die Taufbewerber (Katechumenen), die "getrieben vom Heiligen Geist, mit ausdrücklicher Willensäußerung um Aufnahme in die Kirche bitten, werden durch eben dieses Begehren mit ihr verbunden" (LG 14). - "Mit jenen, die durch die Taufe der Ehre des Christennamens teilhaft sind, den vollen Glauben aber nicht bekennen oder die Einheit der Gemeinschaft unter dem Nachfolger Petri nicht wahren, weiß sich die Kirche aus mehrfachem Grund verbunden" (LG 15): durch die Schrift, durch das Glaubensbekenntnis der alten Kirche, durch einzelne Sakramente, teilweise durch das Bischofsamt und die Eucharistie. Dazu kommt die Gemeinschaft im Gebet und in anderen geistlichen Gütern sowie in den Gaben und Gnaden des Heiligen Geistes (vgl. LG 15). - Diejenigen, die das Evangelium noch nicht empfangen haben, sind auf die Kirche auf verschiedene Weise hingeordnet. Dies gilt in erster Linie vom Volk des Alten Bundes, aber auch von den Muslimen, die sich zum Glauben Abrahams bekennen, schließlich von denen, die in Schatten und Bildern den unbekannten Gott suchen, ja sogar von denen, die nicht zur ausdrücklichen Anerkennung Gottes gekommen sind, jedoch mit Hilfe der Gnade ein rechtes Leben zu führen sich bemühen (vgl. LG 16). Die Zugehörigkeit zur einen Kirche Jesu Christi verwirklicht sich also in einer abgestuften Weise.
Die umfassende Heilsmöglichkeit aller Menschen entbindet die Kirche nicht vom Auftrag zur Mission. Denn durch die Sünde ist die Erkenntnis Gottes aus der Schöpfung gestört; oft vertauschten die Menschen die Wahrheit Gottes mit der Lüge und dienten der Schöpfung mehr als dem Schöpfer (vgl. Röm 1,21-25). Erst die Botschaft von Jesus Christus bringt das ursprüngliche Licht der Schöpfung wieder voll zum Leuchten; erst in ihm wird das tiefste Geheimnis des Menschen erschlossen (vgl. GS 22).
Heute begegnet die Mission vielen Fragen und kritischen Einwänden. Geschätzt werden im allgemeinen die kirchliche Entwicklungsarbeit und die Bemühungen der Missionskirchen, menschenunwürdige Verhältnisse zu beseitigen. Die Einwände sind vor allem, die Mission verdränge die einheimischen Religionen, zerstöre die gewachsenen Kulturen und Sozialstrukturen, sie entfremde die Menschen von ihren angestammten Lebensformen. So schaffe sie eine entfremdete Kirche, die ein Instrument zur Ausbreitung westlicher Kultur sei. Sie beschere damit anderen Kulturen unsere Krisen und Probleme. Zweifellos waren auch Missionare oft allzusehr Kinder ihrer Zeit, und nicht selten haben sie den anderen Völkern das Christentum in den westlichen Formen gebracht. Aber oft genug haben sie auch geholfen, den westlichen Kolonialismus und Imperialismus erträglicher zu machen. Von besonderer Bedeutung war etwa der Einsatz des hl. Petrus Claver († 1654) gegen den Sklavenhandel und für die Schwarzen, die pastorale Tätigkeit des hl. Turibius von Mogrovejo († 1606), des Patrons von Lima und Peru, sowie der Kampf des Bartolomé de Las Casas († 1566) für die Menschenrechte der Indianer.
In der Zwischenzeit hat sich die Situation der Mission tiefgreifend gewandelt. Einerseits ist es zu einer universalen Missionssituation gekommen, die auch unsere Verhältnisse betrifft. Auf der anderen Seite sind inzwischen in allen Kontinenten einheimische Ortskirchen entstanden, welche die Verantwortung für die Ausbreitung und Vertiefung des Christentums in ihrer jeweiligen Region eigenständig wahrnehmen. Die älteren Kirchen Europas und Nordamerikas müssen sie dabei personell wie finanziell unterstützen. Immer mehr erfahren sie aber auch, daß nicht sie allein die Gebenden, sondern auch die reichlich Empfangenden sind. Mission geschieht heute in einem weltweiten Austausch zwischen den verschiedenen Ortskirchen. Diese neuen Formen der Mission entsprechen der Tatsache, daß wir heute auf allen Gebieten auf einen weltweiten gegenseitigen Austausch angewiesen sind. Aber der wirtschaftlicheund technologische Austausch allein schafft keine Menschheitsfamilie, und die Entwicklungshilfe, so dringend notwendig sie ist, löst die Sinnfragen nicht. Damit die Menschen aller Völker und Rassen Freunde werden, bedarf es einer Einheit der Herzen im Bekenntnis des einen Gottes (vgl. Gem. Synode, Missionarischer Dienst an der Welt).
Die eigentliche Begründung der Mission ist der Auftrag, den die Kirche vom Herrn selbst empfangen hat: "Geht zu allen Völkern, und macht alle Menschen zu meinen Jüngern" (Mt 28,19, vgl. Mk 16,15). Mission ist deshalb nichts Zusätzliches zur Kirche und schon gar nicht einigen Missionaren und Missionsschwestern vorbehalten. Alle Christen sind gerufen, Zeugnis zu geben. Die Kirche ist ihrem Wesen nach missionarisch (vgl. AG 2). Denn die Mission, d. h. Sendung, beginnt in Gott selbst. Der Vater sendet den Sohn, dieser sendet den Heiligen Geist, und in der Kraft des Heiligen Geistes wissen sich seine Jünger dazu gesendet, die erfahrene Liebe und das Licht Gottes weiterzugeben. Die Mission ist so grundlegend, daß man sagen kann: Die Kirche entsteht aus der Mission und verwirklicht sich in der Mission.
Das Ziel der Mission ist nicht der Export westlicher Kultur, auch nicht die Ausbreitung der Kirche, so wie sie bei uns besteht, sondern "die Evangelisierung und die Einpflanzung der Kirche bei den Völkern und Gemeinschaften, bei denen sie noch nicht Wurzel gefaßt hat" (AG 6). Einpflanzung will besagen, daß die Kirche jeweils tief in der Kultur und in den Lebensgewohnheiten eines Volkes verwurzelt sein soll (vgl. AG 15). In dem Maße, als der Reichtum Jesu Christi allen Völkern zuteil wird und umgekehrt die Reichtümer der Völker und ihrer Kulturen in der Kirche heimisch werden, streben beide, Kirche und Welt, ihrer endzeitlichen Fülle entgegen. In diesem Sinn lehrt das II. Vatikanische Konzil: "Missionarische Tätigkeit ist nichts anderes und nichts weniger als Kundgabe oder Epiphanie und Erfüllung des Planes Gottes in der Welt und ihrer Geschichte, in der Gott durch die Mission die Heilsgeschichte sichtbar vollzieht" (AG 9).
2.4 Kirche als Ortskirche und als Weltkirche
Die Kirche lebt in Raum und Zeit. Sie verwirklicht die ihr von Jesus Christus ein für allemal gegebene Sendung nicht nur in den einzelnen Epochen ihrer Geschichte in verschiedener Weise. Sie verwirklicht ihr Kirche-Sein auch am jeweiligen Ort entsprechend den jeweiligen Lebensformen, Traditionen, sozialen, kulturellen, politischen Umständen und Mentalitäten. So ist die eine Kirche immer zugleich universale Weltkirche wie Kirche am Ort.
Wenn das Neue Testament von der Kirche spricht, meint es deshalb manchmal die universale Kirche, an anderen Stellen dagegen die jeweilige Ortskirche in Jerusalem, Korinth, Rom u. a. Der hl. Paulus spricht etwa von der "Kirche Gottes, die in Korinth ist" (1 Kor 1,2; 2 Kor 1,1). Damit will er sagen, daß die Ortskirche von Korinth nicht nur ein Ausschnitt, gleichsam ein Verwaltungsbezirk der universalen Kirche ist; sie ist vielmehr die Kirche Gottes so, wie sie sich in Korinth repräsentiert und realisiert. Die Ortskirche verwirklicht also das Wesen der Kirche in einer Weise, wie es ihrer geschichtlichen Situation entspricht. Aber eben weil die Ortskirche die Darstellung und Verwirklichung der einen Kirche Gottes ist, kann sie nicht isoliert existieren, sondern nur in Gemeinschaft mit allen anderen Ortskirchen. Um diese Einheit und Gemeinschaft hat sich gerade der Apostel Paulus unter Einsatz seines Lebens bemüht.
In der ersten Zeit hatte diese Gemeinschaft ihren Mittelpunkt in der Jerusalemer Urgemeinde. Später ging dieser Vorrang auf die Kirche von Rom über, die bereits Ignatius von Antiochien (um 110) als Vorsteherin in der Liebe bezeichnet. Dabei stellte sich die Einheit der Kirche in den ersten Jahrhunderten vor allem in der Gemeinschaft (communio) der verschiedenen Ortskirchen dar. Sie geschah im Austausch des Glaubens, in der gegenseitigen Zulassung zur Eucharistie, in der Fürbitte, in der Gastfreundschaft und im Briefverkehr der Bischöfe; die Synoden erwiesen sich schon bald als wichtige Instrumente und Ausdrucksformen der Gemeinschaft der Kirchen. Im zweiten Jahrtausend, nach dem Bruch der Kirchengemeinschaft mit den Kirchen des Ostens, bildete sich im Westen ein mehr monolithisches Einheitsverständnis heraus; die Ortskirchen traten mehr oder weniger als Teile der römischen Kirche in Erscheinung. Das II. Vatikanische Konzil (1962-1965) hat die altkirchliche Idee der Gemeinschaft der Ortskirchen wieder aufgegriffen und erneuert. Es hat deutlich ausgesprochen, daß die eine und einzige katholische Kirche nur in und aus den Ortskirchen existiert (vgl. LG 23). Das Konzil hat die Ortskirchen als Teilkirchen bestimmt, "in der die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche wahrhaft wirkt und gegenwärtig ist" (CD 11).
- "Diese Kirche Christi ist wahrhaft in allen rechtmäßigen Ortsgemeinschaften der Gläubigen anwesend, die in der Verbundenheit mit ihren Hirten im Neuen Testament auch selbst Kirchen heißen. Sie sind nämlich je an ihrem Ort... das von Gott gerufene neue Volk. In ihnen werden durch die Verkündigung der Frohbotschaft Christi die Gläubigen versammelt, in ihnen wird das Mysterium des Herrenmahls begangen... In diesen Gemeinden, auch wenn sie oft klein und arm sind oder in der Diaspora leben, ist Christus gegenwärtig, durch dessen Kraft die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche geeint wird." (LG 26)
Entsprechend hat das Konzil sowohl in der Liturgie wie im gesamten Leben und in der gesamten Disziplin der Kirche wieder mehr Raum gegeben für eine legitime Vielfalt innerhalb der Einheit der Kirche. Es hat damit wieder deutlicher die Katholizität der Kirche zur Geltung gebracht (vgl. SC 13, 37, LG 13, 24; AG 19).
Unter einer Teil- bzw. Ortskirche versteht das II. Vatikanische Konzil in der Regel die Kirche unter der Leitung eines Bischofs, also eine Diözese, ein Bistum (vgl. CD 11). Für den einzelnen Christen ist jedoch die Gemeinde, unter der Leitung eines Priesters, normalerweise der unmittelbare Lebensraum, der ihn im Heiligen Geist das Wirken Christi erfahren läßt.
Auf diese Beheimatung in einer Gemeinde ist der einzelne Christ in einer zunehmend säkularisierten Gesellschaft dringend angewiesen, um in seinem Glauben bestehen zu können. So spricht das II. Vatikanische Konzil auch von der Ortsgemeinde und sagt, "daß diese zu Recht mit jenem Namen benannt werden kann, der die Auszeichnung des einen und ganzen Gottesvolkes ist: Kirche Gottes" (LG 28, vgl. SC 42). Die Gemeinsame Synode beschreibt die Gemeinde folgendermaßen: "Die Gemeinde ist an einen bestimmten Ort oder innerhalb eines bestimmten Personenkreises die durch Wort und Sakrament begründete, durch den Dienst des Amtes geeinte und geleitete, zur Verherrlichung Gottes und zum Dienst an den Menschen berufene Gemeinschaft derer, die in der Einheit mit der Gesamtkirche an Jesus Christus glauben und das durch ihn geschenkte Heil bezeugen" (Gern. Synode, Dienste und Ämter 2.3.2). Doch ähnlich wie das Bistum als Ortskirche nur innerhalb der Gemeinschaft der Gesamtkirche existieren kann, so ist auch die Ortsgemeinde auf die Gemeinschaft mit dem Bischof und dem Bistum angewiesen. Durch die Taufe sind wir Glieder der einen katholischen Kirche aller Zeiten und aller Orte.
Im allerweitesten Sinn verwirklicht sich die Kirche Christi überall, wo zwei oder drei im Namen Jesu beisammen sind (vgl. Mt 18,20). Die wichtigste Zelle der Kirche sind die christlichen Ehen und Familien, die das II. Vatikanische Konzil ausdrücklich als eine Art Hauskirche bezeichnet (vgl. LG 11). Dem Aufbau und dem Wachstum der Gemeinde und der Kirche dienen aber auch vielerlei Gruppen, Kreise, Hausgemeinschaften, Basisgemeinschaften, geistliche Gemeinschaften am Ort sowie andere kirchliche Vereinigungen und Verbände. Sie helfen zur Einwurzelung und Beheimatung des einzelnen in der Gemeinde und in der Kirche.
Wenn die Kirche eine in Raum und in der Zeit so vielschichtige und vielfältige Größe darstellt, dann stellt sich jetzt um so mehr die Frage: Was ist die Kirche? Welches ist ihr bleibendes Wesen?
3. Das Wesen der Kirche
3.1 Die Kirche ist ein Geheimnis
Schon in den bisherigen Darlegungen wurde immer wieder deutlich: Die Kirche ist eine echt menschliche Größe, aber sie ist zugleich mehr als man sehen und feststellen kann. Letztlich kann man sie nur in der Perspektive des Glaubens angemessen verstehen. Denn die Wirklichkeit der Kirche gründet letztlich im Heilsratschluß Gottes des Vaters und im Heilswerk, das er durch Jesus Christus im Heiligen Geist wirkt. So ist die Kirche eine einzige komplexe Wirklichkeit. Auf der einen Seite ist sie sichtbare, irdische Kirche, die zur Erfüllung ihrer Sendung auch rechtlicher Ordnungen und Strukturen bedarf. Sie ist in dieser Welt als Gesellschaft verfaßt und geordnet und ist verwirklicht in der katholischen Kirche, die vom Nachfolger Petri und von den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet wird. Auf der anderen Seite ist sie eine geistliche, d. h. vom Geist Christi erfüllte Wirklichkeit, die nur im Glauben voll erfaßt werden kann (vgl. LG 8). In ihr ist das Heilsgeheimnis Gottes, das mit Jesus Christus ein für allemal in die Welt gekommen ist, bleibend in konkreter Weise in der Geschichte präsent (vgl. Eph 3,3-12; Kol 1,26-27).
Um beides auszudrücken, lehrt das II. Vatikanische Konzil: Die Kirche ist in Jesus Christus das Sakrament, d. h. das Zeichen und Werkzeug des universalen Heils der Menschheit (vgl. LG 1, 9, 48; GS 42, 45; AG 1 u. a.). Das Sichtbare gehört also wesentlich zur Kirche; aber es ist nur Zeichen und Werkzeug für die geistliche Dimension der Kirche. Damit ist ein Doppeltes gesagt: Die Kirche ist Mittel zur Vergegenwärtigung und Weitergabe des Heils. Aber sie kann nicht allein von ihrer Funktion her bestimmt werden. Die Kirche ist mehr! Sie ist als vergegenwärtigendes Zeichen zugleich Frucht des Heilswerks. Sie ist das öffentlich gewordene Geheimnis des Heils in der Welt.
Dieser geheimnishaften Wirklichkeit der Kirche entspricht es, daß man ihr Wesen nicht auf einen einzigen Begriff bringen kann. Man kann die Kirche nur mit Hilfe einer Vielzahl von einander ergänzenden Bildern und Begriffen beschreiben, die alle jeweils eine Seite ihres Wesens zum Ausdruck bringen. Das Neue Testament nennt die Kirche: die Kirche Gottes, Volk Gottes, Pflanzung und Ackerfeld Gottes, Herde, Bauwerk, Tempel, Haus Gottes, Familie Gottes - Kirche Jesu Christi, Leib Christi und Braut Christi - Tempel des Heiligen Geistes. Die Kirchenväter haben eine Reihe weiterer Bilder hinzugefügt und die Kirche vor allem als die Gemeinschaft der Glaubenden und als Gemeinschaft der Heiligen (d. i. der durch die Sakramente Geheiligten) bestimmt, eine Aussage, die auch in das Glaubensbekenntnis eingegangen ist. Inhaltlich bedeutungsvoll ist auch das griechische und lateinische Wort für Kirche; es lautet "ekklesia" bzw. "ecclesia" und bezeichnet die Kirche als Versammlung und als Gemeinde. Unser deutsches Wort "Kirche" kommt von "kyriaké" und meint "Haus des Herrn"; es drückt also die Zugehörigkeit der Kirche zum Herrn Jesus Christus aus und sagt, daß die Kirche die Kirche Jesu Christi ist.
Diese vielfältigen Bilder und Begriffe weisen in je verschiedener Weise auf Gott, den Vater, in dessen ewigem Ratschluß und Erwählung die Kirche gründet, auf Jesus Christus, Gottes Sohn, durch dessen Heilswerk sie in die Geschichte eintrat, und auf den Heiligen Geist, in dessen Kraft sie zusammengehalten wird, sich stets verjüngt und immerzu wirkt. "So erscheint die ganze Kirche" - nach den Worten des II. Vatikanischen Konzils - "als das von der Einheit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes her geeinte Volk"` (LG 4). Um dieses trinitarische Geheimnis der Kirche zu entfalten, halten wir uns im folgenden vor allem an die drei biblischen Bilder für die Kirche: Volk Gottes, Leib Christi, Tempel des Heiligen Geistes.
3.2 Die Kirche ist das Volk Gottes
"Volk Gottes" ist ein zentraler Begriff in den Aussagen des II. Vatikanischen Konzils über die Kirche. Dieses Wort hat in den beiden letzten Jahrzehnten viel zur Erneuerung und Verlebendigung des Bewußtseins und des Lebens in der Kirche beigetragen. Es hat vor allem geholfen, eine individualistische Art und Weise, den Glauben zu leben, zu überwinden und das Bewußtsein zu festigen, daß in der Kirche alle mitverantwortlich sind. Denn wenn die Heilige Schrift die Kirche als Volk Gottes beschreibt, dann sagt sie damit, daß das Heil nicht dem isolierten einzelnen für sich allein gilt, sondern einer Gemeinschaft, in die der einzelne aufgenommen wird, um so persönlich am Heil Anteil zu erlangen. Diese Gemeinschaft entsteht nicht durch den nachträglichen Zusammenschluß religiös Gleichgesinnter. Ähnlich wie ein Volk oder eine Familie ist auch die Kirche dem einzelnen vorgegeben; der einzelne wird in die Kirche aufgenommen, wächst in sie hinein, wird von ihr getragen und übernimmt selbst Verantwortung für sie. Dies gilt grundsätzlich für alle Christen, für Amtsträger wie für Laien. Volk Gottes meint also nicht das Volk oder - wie man heute mißverständlicherweise oft sagt - die Basis im Unterschied zu den Amtsträgern, sondern alle Christen in ihrer Gesamtheit wie in der Vielfalt ihrer Gaben, Dienste und Ämter. Kirche, Volk Gottes, das sind alle!
Nun ist die Kirche aber kein Volk im gewöhnlichen Sinn des Wortes, keine Gemeinschaft, die durch gemeinsame Abstammung, Geschichte und Kultur verbunden ist. Sie geht auch nicht aus dem Volk als einer natürlichen und geschichtlichen Größe hervor; ebensowenig entsteht sie aus den Kräften einer bestimmten Gruppe oder Klasse. Die Kirche ist das Volk Gottes; d. h. sie ist das Volk, das Gott aus den Völkern auserwählt und berufen hat, sein Eigentumsvolk, mit dem er einen Bund geschlossen hat. Sie ist ein universales Volk in und aus allen Völkern, Rassen und Klassen. Sie ist zugleich ein heiliges Volk. Deshalb wird man in die Kirche nicht hineingeboren, sondern durch den Glauben und durch die Taufe, das Sakrament des Glaubens und der Wiedergeburt zum neuen Leben (vgl. Joh 3,5), eingegliedert. Wenn deshalb das Volk Gottes sich versammelt, dann geschieht dies nicht wie in einer bürgerlich-politischen Versammlung, um über die gemeinsamen Angelegenheiten zu beraten und zu entscheiden, sondern um zu hören, was Gott entschieden, gesagt und getan hat, und um ihm für seine Heilsratschlüsse und seine Heilstaten zu danken. Die Kirche ist die Gemeinschaft der Glaubenden, die sich versammelt als dankende und feiernde Kultgemeinde, in deren Mitte Gott selbst wirksam gegenwärtig ist und die in die Welt gesandt ist, um das Evangelium durch Wort und Tat zu bezeugen.
Die Grundverheißung an das Gottesvolk des Alten Bundes lautet: "Ich bin euer Gott, und ihr seid mein Volk" (Lev 26,11-12; vgl. Ez 37,27; 2 Kor 6,16; Hebr 8,10; Offb 21,3). Diese Verheißung verbindet die Kirche mit Israel, dem Gottesvolk des Alten Bundes. Der Apostel Paulus hat diesen Zusammenhang ausführlich dargestellt (vgl. Röm 9-I1). Das II. Vatikanische Konzil hat sich nach einer langen Geschichte der Entfremdung, Verfeindung und der Schuld wieder zu dieser gemeinsamen Geschichte bekannt (vgl. NA 4). Ohne diesen Zusammenhang mit dem Alten Bund, in dem die Kirche vorbereitet und vorausgebildet wird (vgl. LG 9), kann man die Kirche nicht verstehen. Freilich muß man auch den Bruch sehen, der zwischen Israel und der Kirche, dem Gottesvolk des Neuen Bundes, besteht. Zum neuen Volk Gottes, dem neuen und wahren Israel, gehören auch die Heiden, die ursprünglich nicht Volk Gottes waren (vgl. 1 Petr 2,10). So ist erst in der Kirche aus Juden und Heiden (vgl. Eph 2,11-22) die Verheißung an Abraham wirksam geworden, daß in ihm alle Völker Segen erlangen werden (vgl. Gen 12,3; 18,18; 22,18; Gal 3,8).
Das Volk Gottes im Neuen Bund umfaßt also Menschen aller Völker und Rassen. "Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau; denn ihr alle seid ,einer' in Christus Jesus" (Gal 3,28; vgl. 1 Kor 12,13; Kol 3,11). Weil die Kirche an keine besondere Form der Kultur und an kein besonderes politisches, wirtschaftliches oder gesellschaftliches System gebunden ist, sondern vielmehr die Völker, Kulturen, die Rassen und Klassen umgreift, kann sie Zeichen und Werkzeug der Einheit und des Friedens in der Menschheit sein (vgl. GS 42). Sie ist das messianische Volk Gottes, das Zeichen der Hoffnung für die Völker (vgl. LG 9).
Als Zeichen und Werkzeug für die Einheit der ganzen Menschheit weist die Kirche über sich hinaus. Sie ist selbst wanderndes Volk Gottes, Volk Gottes unterwegs. Sie lebt in der Geschichte und hat selbst eine legitime Geschichte. Sie ist auf dem Weg und noch nicht am Ziel. So ist sie als Volk Gottes keine starre und statische, sondern eine dynamische Wirklichkeit, ein Zeichen der Hoffnung. Sie lebt in dieser Welt in der Diaspora und in der Fremde und hat keine bleibende Heimat (vgl. Jak 1,1; 1 Petr 1,1; 2,11; Hebr 3,7-4,11; 11,8-16.32-34). Sie darf sich deshalb nie auf Dauer einrichten; sie muß immer wieder neu aufbrechen zu dem, der außerhalb des Tores gelitten hat (vgl. Hebr 13,12). Am Ende, wenn Gott alles in allem sein wird, dann bedarf es der Kirche als Heilsmittel nicht mehr. Bei allem Endgültigen und Bleibenden, das sie zu bezeugen hat, lebt die Kirche als Volk Gottes von der Proklamation, daß nicht sie selbst das endgültige Ziel ist.
3.3 Die Kirche ist der Leib Christi
Der Vergleich zwischen dem menschlichen Organismus und der menschlichen Gemeinschaft war in der Antike allgemein bekannt. So wie im Leib ein Glied nicht ohne die anderen Glieder sein kann, so auch im Staat. Paulus greift diesen Vergleich auf und wendet ihn auf die Kirche an: Die Kirche ist ein Leib in und mit vielen unterschiedlichen Gliedern. Sie alle brauchen einander; sie alle müssen einträchtig zusammenwirken und zusammenstehen (vgl. Röm 12,4-9). Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit, wenn ein Glied sich freut, freuen sich alle anderen mit ihm (vgl. 1 Kor 12,26). In besonderer Weise bedürfen die armen, schwachen und verfolgten Glieder der Solidarität aller in der Kirche (vgl. LG 8). Doch Paulus korrigiert auch das bekannte und beliebte Bild. Er sagt nicht: Wie im Leib - so auch in der Kirche, sondern: so auch der Christus (vgl. 1 Kor 12,12). Damit sagt er: Die Kirche entsteht nicht durch das Zusammenwirken ihrer Glieder; die Kirche existiert ganz von Jesus Christus her. Nur durch ihn und in ihm sind wir Glieder seines Leibes.
Deshalb können der Epheser- und der Kolosserbrief sagen: Jesus Christus ist das Haupt des Leibes der Kirche (vgl. Eph 1,22-23; 4,15-16; Kol 1,18; 2,19). Damit wird die Kirche nicht nur mit einem Leib verglichen; es wird vielmehr gesagt: Die Kirche ist Jesus Christus in seinem Leib. Der hl. Augustinus sprach vom ganzen Christus nach Haupt und Gliedern. Das heißt nicht, Jesus Christus und Kirche seien dasselbe. Beide gehören zwar untrennbar zusammen, aber die Kirche ist nicht einfachhin der fortlebende Christus, wohl aber lebt und wirkt Jesus Christus in der Kirche fort. Bei aller Einheit von Jesus Christus und Kirche bleibt Jesus Christus doch Haupt und Herr der Kirche; er ist der Kirche übergeordnet, sie ist ihm im Gehorsam untergeordnet. Die Kirche lebt von Jesus Christus her und auf ihn hin. Von ihm geführt und von ihm erfüllt, steht die Kirche Jesus Christus auch gegenüber. Dieses Gegenüber und liebende Zueinander von Jesus Christus und Kirche bringt das Neue Testament vor allem durch das Bild von der Kirche als der Braut Jesu Christi zum Ausdruck (vgl. Eph 5,25, Offb 19,7; 21,2.9; 22,17; vgl. schon Hos 2,21-22).
Die Teilhabe der Kirche an Jesus Christus geschieht in dreifacher Weise: als Teilhabe am prophetischen Amt, am hohepriesterlichen Amt und am königlichen Hirtenamt. So geschieht die Auferbauung und das Wachstum des Leibes Christi durch die Verkündigung des Wortes Gottes, durch die Feier der Sakramente, besonders durch die Taufe und die Eucharistie, und durch den Hirtendienst.
Demnach ist die Kirche der Leib Christi, die Gemeinschaft derer, die das Wort Gottes hören und es der Welt bezeugen. Sie ist die Gemeinschaft der Glaubenden. Durch den Glauben werden wir ja in grundlegender Weise mit Christus verbunden. Das Wort Gottes verleiblicht sich in den Sakramenten. Durch die Taufe werden wir alle in dem einen Geist zu dem einen Leib (vgl. 1 Kor 12,13). In der Eucharistie nehmen wir alle an dem einen Brot, dem einen eucharistischen Leib Christi teil und werden so zu einem Leib (vgl. 1 Kor 10,16-17). So wird "durch das Sakrament des eucharistischen Brotes die Einheit der Gläubigen, die einen Leib in Christus bilden, dargestellt und verwirklicht" (LG 3 ; vgl. 7). Die Eucharistie ist deshalb "Quelle und Höhepunkt" des ganzen christlichen und kirchlichen Lebens (vgl. LG 11). Sie ist nach einem Wort des hl. Augustinus "das Zeichen der Einheit und das Band der Liebe" (vgl. DS 802; 1635; NR 375; 567; SC 47). Wir können freilich das eucharistische Brot nicht teilen, ohne zugleich das tägliche Brot miteinander zu teilen. Die Feier der Sakramente muß deshalb wirksam werden in der Tat und in der Gemeinschaft der Liebe. Wir begegnen Jesus Christus in den Armen, Schwachen, Ausgestoßenen, Verfolgten, in den Leidenden und Sterbenden (vgl. Mt 25,31-46). "Die Kosten, die uns dafür abverlangt werden, sind nicht ein nachträgliches Almosen, sie sind eigentlich die Unkosten unserer Katholizität, die Unkosten unseres Volk-Gottes-Sein, der Preis unserer Orthodoxie" (Gem. Synode, Unsere Hoffnung IV,3).
Als der Leib Jesu Christi steht die Kirche "in einer nicht unbedeutenden Analogie zum Mysterium des fleischgewordenen Wortes. Wie nämlich die angenommene Natur dem göttlichen Wort als lebendiges, ihm unlöslich geeintes Heilsorgan dient, so dient auf eine ganz ähnliche Weise das gesellschaftliche Gefüge der Kirche dem Geist Christi, der es belebt, zum Wachstum seines Leibes" (LG 8). In diesem umfassenden Sinn ist die Kirche der von Jesus Christus und seinem Geist erfüllte Raum, durch den er alles erfüllen will (vgl. Eph 1,23).
3.4 Die Kirche ist der Tempel Gottes im Heiligen Geist
Der Tempel bedeutete für die alte Welt den Ort der wirksamen Gegenwart Gottes in der Welt. Für Israel war es kennzeichnend, daß es lange Zeit keinen ortsfesten Tempel besaß; Gott war mitten unter seinem Volk bei seinem Weg durch die Wüste gegenwärtig. So kann auch das Neue Testament die Kirche bzw. die konkrete Gemeinde als Tempel, als Ort der Gegenwart Gottes und Jesu Christi bezeichnen. "Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen" (Mt 18,20). Die Kirche meint also nicht in erster Linie einen Bau aus toten Steinen, sondern einen geistigen Bau aus lebendigen Steinen, dessen Eckstein Jesus Christus ist (vgl. 1 Petr 2,4-5).
Die Gegenwart Gottes und Jesu Christi geschieht im Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist werden wir Volk Gottes des Neuen Bundes (vgl. Jer 31,31-33; Ez 11,19-20; 36,26-27). Durch den einen Geist werden wir auch ein Leib in Christus (vgl. 1 Kor 12,13-14). So kann Paulus sagen:
_"Wißt ihr nicht, daß ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn Gottes Tempel ist heilig, und der seid ihr."(1 Kor 3,16-17; vgl. 2 Kor 6,16; Eph 2,21)
Wenn das äußere Gefüge der Kirche Tempel und Wohnung des Heiligen Geistes ist, dann kann man auch sagen, der Heilige Geist sei ähnlich wie die Seele im Leib, das ist das Lebensprinzip der Kirche (Augustinus; vgl. LG 7). Aus dem Heiligen Geist muß sie leben und in ihm sich stets erneuern. Er ist es, der sie stets verjüngt und ihr immer neue Fruchtbarkeit und Lebenskraft verleiht. Er hält sie in der Wahrheit (vgl. Joh 14,26; 16,13-14; DV 7-9), er führt sie auf dem Weg der Mission (vgl. AG 4), er heiligt sie und alle ihre Glieder (vgl. LG 39-40).
In besonderer Weise ist der Heilige Geist das Prinzip der Einheit der Kirche in der Vielfalt der Geistgaben (vgl. 1 Kor 12,4-31a; Eph 4,3 u. a.; LG 12; UR 2). Die Fülle und der Reichtum der Geistgaben gehören zum Wesen der Kirche. Denn die Kirche lebt aus der Fülle des Geistes, der weht, wo er will (vgl. Joh 3,8). Das zeigt: Kirche und kirchliche Erneuerung kann man nicht einfach "machen"; man kann sie auch nicht einfach programmieren und organisieren. Das Entscheidende an der Kirche ist unverfügbar. Die Kirche muß deshalb immer wieder neu um den Geist beten, der sie verlebendigt, verjüngt und fruchtbar werden läßt.
Über das Wesen und Wirken der Geistgaben (Charismen) bestehen viele falsche Vorstellungen. Manche meinen, es handle sich vor allem um außerordentliche Gaben wie Ekstasen, Visionen, Wunder, Prophezeiungen, Zungenreden u. a. Paulus führt unter den Charismen jedoch auch Rede, die Weisheit oder Erkenntnis vermittelt, auf (vgl. 1 Kor 12,8), ferner die Tätigkeit von Aposteln, Propheten und Lehrern und andere Leitungs- und Hilfsaufgaben (vgl. 1 Kor 12,28). An anderer Stelle nennt Paulus auch die Ehelosigkeit: "Doch jeder hat seine Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so" (1 Kor 7,7). Wichtig ist, daß die ordentlichen wie die außerordentlichen Geistgaben dem Aufbau der Gemeinde zugute kommen (vgl. 1 Kor 12,7; 14,5.12.26) und sich an die "Analogie des Glaubens", an den gemeinsamen Glauben der Kirche halten (vgl. Röm 12,6).
Andere meinen, die außerordentlichen Gaben seien nur für die Anfangszeiten der Kirche bestimmt gewesen. Sie vergessen dabei, daß die Heiligen zu allen Zeiten außerordentliche Gaben empfingen, durch die sie zeichenhaft und stellvertretend für die anderen die Macht und Lebendigkeit des Geistes in der Kirche bezeugen sollten. Durch die charismatische Erneuerungsbewegung unserer Tage ist vieles jetzt in neuer Weise wieder bewußt geworden. - Schließlich darf man die Charismen, deren Lebendigkeit Paulus zu erhalten wünscht ("Löscht den Geist nicht aus!" 1 Thess 5,19), auch nicht überschätzen. Den mit reichen Geistgaben beschenkten Korinthern weist der Apostel einen "Höhenweg", der über allen Charismen steht: die Liebe, die er mit beredten Worten preist (vgl. 1 Kor 13). Die Liebe ist die höchste Frucht des Heiligen Geistes (vgl. Gal 5,22).
Charisma und Amt sind kein Gegensatz; sie können und müssen sich ergänzen und miteinander verbinden. Die kirchlichen Amtsträger dürfen charismatische Befähigung nicht für sich allein in Anspruch nehmen; andererseits dürften spontan auftretende Charismen nicht gegen fest umrissene, auf Dauer angelegte Ämter ausgespielt werden.
Die Urkirche hat die grundlegenden, unentbehrlichen Dienste der Apostel, Propheten und Lehrer in die Reihe der Charismen eingeordnet (vgl. 1 Kor 12,28) und "die Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer" als Gaben des erhöhten Herrn für seine Kirche angesehen (vgl. Eph 4,11). Nach den Pastoralbriefen wird den Amtsbewerbern bei der Handauflegung eine "Gnadengabe Gottes" verliehen (vgl. 2 Tim 1,6; 1 Tim 4,14). Das Amt ist freilich nicht das einzige Charisma. Es ist deshalb auf das Zusammenwirken mit allen anderen Charismen angewiesen, wie auch diese auf das Amt und auf die Gemeinschaft mit dem Amt verwiesen sind. Sache des kirchlichen Amtes ist es, den Geist nicht auszulöschen, sondern alles zu prüfen und das Gute zu behalten (vgl. 1 Thess 5,19-21). Das charismatische Wesen der Kirche wäre also mißverstanden, wenn man es schwärmerisch verstehen und gegen die Ordnung in der Kirche ausspielen würde. Gerade in den Kapiteln, in denen Paulus am ausführlichsten darüber spricht, kommt es ihm ganz darauf an, den Gedanken der Einheit und der Ordnung herauszustellen (vgl. 1 Kor 12; 14). "Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens" (1 Kor 14,33).
Gruppen, die einen neuen Aufbruch des Geistes verspüren, und die gefestigten amtlichen Strukturen der Kirche brauchen einander. Denn die Kirche bedarf, damit sie nicht erstarrt, immer wieder der Kräfte der Erneuerung; diese aber bedürfen zu ihrer kritischen Korrektur der kirchlichen Überlieferung, die den Glauben durch die Zeiten trägt, bis sich der Funke neu entzündet. In beidem wirkt der Geist Gottes, und Gottes Geist widerspricht sich nicht selbst. Das schließt fruchtbare Spannungen und klärende Konflikte nicht aus; aber es gilt auch das Wort: "Bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch den Frieden, der euch zusammenhält" (Eph 4,3).
Nicht zuletzt aufgrund der Fülle, des Reichtums und der Vielfalt der Geistgaben in der Kirche stellt sich die Frage: Wo und wie kann man im Konflikt erkennen, wo die wahre Kirche ist, wo wirklich Volk Gottes, Leib Christi und Tempel des Heiligen Geistes sich verwirklichen? Welches sind die Kennzeichen der wahren Kirche?
4. Die Kennzeichen der Kirche
Auf die Frage nach den Kennzeichen der Kirche antwortet das Glaubensbekenntnis: "Ich glaube (an) die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche". Damit sind vier Wesenseigenschaften benannt, welche die Kirche kennzeichnen und sie als wahre Kirche erkenntlich machen. Selbstverständlich kann man mit ihrer Hilfe den nicht-katholischen Christen die wahre Kirche nicht einfach andemonstrieren. Das Bekenntnis zur wahren Kirche setzt Begegnung und Bekehrung voraus. Aber die vier Kennzeichen der Kirche ergeben zusammengenommen doch ein Gesamtgefüge, das durch seine innere Stimmigkeit und Sinndichte Überzeugungskraft hat und vermittelt.
4.1 Die Einheit der Kirche
Die Einheit und Einzigkeit der Kirche Jesu Christi ist tief im Geheimnis der Kirche begründet. Aus dem Bekenntnis zum einen Gott, zum einen Mittler Jesus Christus, zum einen, alles durchwaltenden Geist, folgt mit innerer Notwendigkeit die eine Kirche in dem doppelten Sinn, daß es nach dem Willen Jesu Christi nur eine einzige Kirche gibt (Einzigkeit) und daß diese Kirche in sich eins ist (Einheit). So war es der letzte Wille Jesu:
- "Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, daß du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast; denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir." (Joh 17,21-23).
Im Epheserbrief finden wir dieselbe Begründung der Einheit und zugleich die Mahnung, die Gabe der Einheit als eine Aufgabe zu betrachten:
- "Seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt einander in Liebe, und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch den Frieden, der euch zusammenhält. Ein Leib und ein Geist, wie euch durch eure Berufung auch eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist; ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist." (Eph 4,2-6)
Beide Texte sagen: Die Einheit der Kirche ist kein bloßes Postulat, kein kirchenorganisatorisches Ziel, nicht etwas, das erst künstlich geschaffen werden müßte. Sie ist in Christus als Frucht des Geistes bereits Wirklichkeit. Die Gabe der Einheit ist freilich zugleich eine Aufgabe. Alle Spaltungen im Glauben sind deshalb letztlich Widerspruch gegen den Willen Gottes und die Wirklichkeit Jesu Christi; sie sind Ärgernis und Sünde. Sie verdunkeln das Erscheinungsbild der Kirche nach außen und versagen der Welt den Dienst der Einheit, des Friedens und der Versöhnung, welcher der Kirche aufgetragen ist. Wir dürfen uns deshalb mit der Zerrissenheit der Christenheit in verschiedene Konfessionen nicht abfinden.
Worin besteht die Einheit der Kirche? In der Apostelgeschichte wird bei der Beschreibung der Jerusalemer Urgemeinde darauf Wert gelegt, daß alle Gläubigen an der Lehre der Apostel und an der Gemeinschaft, ferner am Brechen des Brotes und an den Gebeten festhielten (vgl. Apg 2,42). Es war also eine Einheit im Glauben, in der Liebe und im Gottesdienst unter der Leitung der Apostel. Entsprechend spricht das II. Vatikanische Konzil vom dreifachen Band der Einheit: das Band des Glaubensbekenntnisses, der Sakramente und der kirchlichen Leitung und Gemeinschaft (vgl. LG 14).
Diese dreifache Einheit bedeutet keineswegs Uniformität. Innerhalb der umgreifenden Einheit ist eine Vielfalt der Verkündigungsweisen, Gottesdienst- und Frömmigkeitsformen, Theologien, Kirchengesetze, von Formen gesellschaftlichen Engagements und sozialen Dienstes möglich, ja wünschenswert. Anders könnte die Kirche nicht Menschen aus allen Völkern, Rassen, Kulturen, Sprachen, Denk- und Lebensformen vereinigen. Nur durch eine solche Vielfalt in der Einheit kann sie allen alles werden (vgl. 1 Kor 9,19-23). Die Gemeinschaft (communio) des Glaubens, der Sakramente, der Dienste und Ämter, die in der gemeinsamen Teilhabe an dem einen Geist Jesu Christi gründet, verwirklicht sich also in vielfältigem Austausch und in gegenseitiger Anerkennung, in Solidarität untereinander und gegenüber dem umfassenderen Ganzen. Solche Vielfalt in der Einheit ist zu unterscheiden von einer grenzenlosen Vielheit, von einem unverbindlichen Pluralismus, bei dem es sich nicht mehr um eine vielgestaltige Ausprägung des einen und selben, sondern um unversöhnliche Gegensätze handelt, wo die fruchtbaren, ja lebensnotwendigen Spannungen zu starren und unvereinbaren Gegensätzen werden. Ließe man in der Kirche Unvereinbares nebeneinander stehen und bestehen, dann würde sich die Einheit der Kirche auflösen; die Kirche würde dann ihre Konturen verlieren und könnte nicht mehr Zeichen für die Welt sein.
Gestalten solcher die Einheit aufhebender Vielheit sind Häresie und Schisma. Während das Schisma die Einheit der gelebten Gemeinschaft, besonders der Gottesdienstgemeinschaft, aufhebt, verletzt die Häresie die Einheit im einen Glauben, was dann notwendig zum Abbruch der Gottesdienstgemeinschaft führt. Freilich ist nicht jede irrige Meinung schon eine Häresie; zur Häresie wird sie erst dadurch, daß einer hartnäckig am Irrtum festhält und sich darauf versteift. Häresie setzt also persönliche Schuld voraus. Das bedeutet, daß man bei den von der katholischen Kirche getrennten Christen nicht ohne weiteres von Häresie sprechen kann. Im einzelnen kann es zur Häresie sowohl durch ein Zuviel wie durch ein Zuwenig kommen, durch Abstriche wie durch Übertreibungen und Zusätze, durch das einseitige Herausstellen und die Verabsolutierung einer Teilwahrheit wie durch die Leugnung einer verbindlichen Glaubenswahrheit.
Bei solchen Spaltungen spielen gewöhnlich auch weltliche Faktoren (nationale, politische, kulturelle, soziale und rassische Spannungen) eine Rolle, ebenso wie persönliche Veranlagungen (Rechthaberei, Rivalität, Selbstbehauptungswille, Hochmut u. a.). Das alles stellt jedoch nur einen Teilaspekt dar. Die großen Spaltungen im Glauben der Vergangenheit geschahen auch aus Verantwortung für die unverfälschte Heilsbotschaft, weil man der Überzeugung war, sich um der Wahrheit des Evangeliums willen trennen zu müssen. Sie lassen sich deshalb auch nicht allein durch Buße und Schuldbekenntnis überwinden; das gemeinsame Bemühen um das rechte Verständnis des Evangeliums muß hinzukommen. Die Einheit der Kirche muß eine Einheit in der Wahrheit sein; Liebe ohne Wahrheit wäre unwahr und unwahrhaftig.
Spaltungen hat es in der Kirchengeschichte von allem Anfang an gegeben. Vor allem zwei Spaltungen haben zu einem bis heute dauernden Bruch geführt: die Trennung zwischen Ost- und Westkirche im Jahr 1054, die eine lange dauernde gegenseitige Entfremdung besiegelte, und die abendländische Kirchenspaltung im 16. Jahrhundert im Gefolge der Reformation, die ihrerseits wiederum zahlreiche Spaltungen hervorgebracht hat.
Nach einer langen Epoche der Polemik, der Kontroverse und der konfessionellen Abkapselung kam es in der ökumenischen Bewegung unseres Jahrhunderts wieder zu einer gegenläufigen Bewegung. Unter der ökumenischen Bewegung versteht man die vom Heiligen Geist geleitete Reue über die Spaltung der Kirche, die Besinnung auf das allen Christen Gemeinsame, das Bemühen um die Überwindung der noch bestehenden Unterschiede und das Bestreben, die sichtbare Einheit der Kirche wiederherzustellen (vgl. UR 1; 4).
Hervorragende Ereignisse in der ökumenischen Bewegung sind die Konstituierung des "Ökumenischen Rates der Kirchen" im Jahr 1948 und das II. Vatikanische Konzil (1962-1965), durch das sich die katholische Kirche auch offiziell dem ökumenischen Anliegen verpflichtet hat. Maßgebend und grundlegend dafür ist das Dekret über den Ökumenismus, für die katholische Kirche in Deutschland außerdem der Beschluß der Gemeinsamen Synode "Pastorale Zusammenarbeit der Kirchen im Dienst an der christlichen Einheit".
Die glaubensmäßige Grundlage des Ökumenismus ist selbstverständlich kein Relativismus, der bestreitet, daß die Kirche Jesu Christi in der katholischen Kirche verwirklicht ist (vgl. LG 8). Die Einheit ist deshalb auch keine unsichtbare Größe "hinter" den getrennten Kirchentümern, noch kann man sich die Einheit nach Art verschiedener Zweige an einem einzigen Stamm vorstellen. Die Überzeugung der katholischen Kirche, die eine wahre Kirche Jesu Christi zu sein und die Fülle der Heilsmittel zu besitzen, schließt jedoch nicht aus,
"daß außerhalb ihres Gefüges vielfältige Elemente der Heiligung und der Wahrheit zu finden sind, die als der Kirche Christi eigene Gaben auf die katholische Einheit hindrängen" (LG 8). Zu dieser Gemeinsamkeit gehören: die Heilige Schrift als Grundlage und Norm des Lebens und Handelns, die altkirchlichen Glaubensbekenntnisse, die Taufe als Eingliederung in den Leib Christi, das Leben der Gnade, Glaube, Hoffnung und Liebe und andere Gaben des Heiligen Geistes (vgl. LG 15; UR 3). Bei den orthodoxen Kirchen des Ostens kommen hinzu: die Eucharistie als Sakrament der Einheit und das Bischofsamt als Dienst der Einheit. So kann das II. Vatikanum von den getrennten Kirchen und Gemeinschaften sagen, daß trotz der Mängel, die ihnen nach unserem Glauben anhaften, der Geist Christi sie gewürdigt hat, sie als Mittel des Heils zu gebrauchen (vgl. UR 3).
Aus alledem ergibt sich, daß das Motiv der ökumenischen Bewegung nicht die in der gegenwärtigen Welt häufig anzutreffende Gleichgültigkeit sein kann, welche die überlieferten Lehrunterschiede als unverständlich und überholt betrachtet. Das Motiv kann allein der Gehorsam gegenüber dem Willen Jesu Christi und gegenüber dem Drängen des Heiligen Geistes sein. Der Weg der ökumenischen Bewegung führt folglich nicht über pragmatische Kompromisse oder einen falschen Irenismus, welcher die Wahrheit des Evangeliums und die Reinheit der kirchlichen Lehre verdunkelt oder verwässert. Der Ökumenismus setzt vielmehr eigene Erneuerung durch Gebet, Bekehrung und Heiligung voraus.
Von zentraler Bedeutung ist das private und öffentliche Gebet um die Einheit der Christen. Der ökumenische Weg führt über den Dialog und die Zusammenarbeit zum Abbau von Vorurteilen und Mißverständnissen, zu einem besseren Sich-Kennen und Verstehen, zum Bemühen um ein gemeinsames Verständnis der christlichen Wahrheit und womöglich auch der noch bestehenden trennenden Unterschiede. Das Ziel der ökumenischen Bewegung ist die Einheit der Kirche. Damit ist nicht eine uniformistische Einheitskirche gemeint, sondern eine Einheit, die vielfältige Ausprägungen zuläßt und dadurch die Wiederaufnahme der Kirchengemeinschaft ermöglicht. Dieses Bemühen um die Einheit der Kirche dient zugleich der Einheit, der Versöhnung und dem Frieden der Welt.
4.2 Die Heiligkeit der Kirche
Die Heiligkeit der Kirche scheint in erheblicher Spannung zur konkreten Erfahrung der Kirche zu stehen. Niemand kann bestreiten, daß es in der Kirche Sünde gibt. Der Glaube erkennt jedoch auch eine tiefere Dimension der Kirche. Aus der Sicht des Glaubens gehört die Heiligkeit der Kirche zu ihrem tiefsten Wesen. Denn Gott, der Urgrund der Kirche, ist der Heilige schlechthin (vgl. Jes 6,3); er erwählt und schafft sich ein heiliges Volk (vgl. Ex 19,6; 1 Petr 2,9). Jesus Christus, "der Heilige Gottes" (Mk 1,24 u. a.), hat sich für die Kirche hingegeben, um sie "rein und heilig zu machen" (Eph 5,26). Schließlich ist die Kirche als Tempel des Heiligen Geistes selbst heilig (vgl. 1 Kor 3,17).
So werden die ersten Christen in der Heiligen Schrift als "die Heiligen" bezeichnet (vgl. Apg 9,13.32.41; Röm 8,27; 1 Kor 6,1 u. a.). Dennoch gab es von Anfang an Schwächen, Auseinandersetzungen, ja Skandale, die wir sowohl von der Jerusalemer Urgemeinde wie vor allem von der Gemeinde in Korinth wissen. In welchem Sinn ist also die Heiligkeit der Kirche gemeint?
Im Sprachgebrauch der Heiligen Schrift meint Heiligkeit nicht primär ethische Vollkommenheit, sondern Ausgesondertsein aus dem Bereich des Weltlichen und Zugehörigkeit zu Gott. In diesem Sinn leben die Christen und die Kirche zwar in der Welt, aber sie sind nicht aus der Welt (vgl. Joh 17,11.14-15). Die Kirche ist heilig, weil sie von Gott her und auf ihn hin ist. Sie ist heilig, weil ihr der heilige Gott, der von aller Welt Verschiedene, unbedingt die Treue hält und nicht den Mächten des Todes, der Vergänglichkeit der Welt anheimgibt (vgl. Mt 16,18). Sie ist heilig, weil Jesus Christus unauflöslich mit ihr verbunden ist (vgl. Mt 28,20) und weil ihr die machtvolle Gegenwart des Heiligen Geistes bleibend verheißen ist (vgl. Joh 14,26; 16,7-9). Sie ist heilig, weil ihr die Güter des Heils bleibend gegeben und zum Weitergeben aufgegeben sind: die Wahrheit des Glaubens, die Sakramente des neuen Lebens, die Dienste und Ämter.
Aus der "objektiven" Heiligkeit muß die ethische Verwirklichung, die "subjektive" Heiligkeit, folgen. "Seid heilig, weil ich heilig bin" (Lev 11,44; vgl. 45; 1 Petr 1,16; 1 Joh 3,3). Vor allem die Briefe des Apostels Paulus sind voll mit der Mahnung, aus dem neuen Sein der Gnade den neuen Wandel und das neue Tun folgen zu lassen (vgl. Röm 6,6-14, 8,2-17 u. a.) und das ganze Leben zu einem Gottesdienst zu machen (vgl. Röm 12,1). Zu dieser Heiligkeit sind alle Christen berufen, unabhängig davon, ob sie Laien oder Amtsträger sind, in der Welt oder in einer religiösen Gemeinschaft leben, verheiratet oder unverheiratet sind (vgl. LG 39-42). Von allen gilt: "Das ist es, was Gott will: eure Heiligung" (1 Thess 4,3).
Solche Heiligkeit ist kein Werk und keine Leistung, sondern Frucht des Heiligen Geistes und seiner Gaben. Sie besteht nicht primär in außerordentlichen oder gar auffälligen Taten, sondern in außerordentlicher Treue, Liebe und Geduld im ordentlichen und alltäglichen Leben, in der Verherrlichung Gottes und im Dienst an den Nächsten, besonders im Ertragen von Leiden, Verfolgungen und Widerwärtigkeiten aller Art. "Durch diese Heiligkeit wird auch in der irdischen Gesellschaft eine menschlichere Weise zu leben gefördert" (LG 40). Obwohl das Ziel der christlichen Heiligkeit für alle Christen dasselbe ist, gibt es doch unterschiedliche Wege und Formen, dieses Ziel zu erreichen. In allen christlichen Ständen ist nämlich eines entscheidend: die radikale Erfüllung des Hauptgebotes, Gott über alles und den Nächsten wie sich selbst zu lieben (vgl. Mk 12,30-31; Joh 13,34; 15,12; 1 Kor 13).
Das Leben nach den evangelischen Räten (freiwillige Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen, Armut und Gehorsam) ist eine besondere Form des christlichen Lebens, das der Berufung zur Heiligkeit zu entsprechen sich bemüht. Es ist in Wort und Beispiel Jesu, der selbst jungfräulich, arm und gehorsam lebte, begründet und wurde von der Kirche stets hoch geschätzt. Der Ordensstand beruht auf dem gemeinschaftlichen und durch die Gelübde auf Dauer angelegten Leben nach den evangelischen Räten. Das Ordensleben wurzelt in der Taufe, entspringt aber einem besonderen Ruf und einer besonderen Gnade, die zum besonderen Dienst für Gott und für die Menschen frei macht und verpflichtet. So sind die Orden ein wichtiges, ja unverzichtbares Zeichen der Heiligkeit der Kirche (vgl. LG 43-47; PC 5). Die Kirche verdankt ihnen viele geistliche Impulse, apostolischen und karitativen Einsatz, aber auch kulturelle, wissenschaftliche u. a. Beiträge. Sie können gerade heute gegenüber einem oft einseitigen Aktivismus und der Gefahr, im Materiellen aufzugehen, wichtige Zeichen erfüllter menschlicher und christlicher Freiheit sein. Die verschiedenen und sehr vielfältigen Orden haben je nach ihrer besonderen Berufung und Geschichte ihre Eigenprägung. Sie können mehr beschaulich oder mehr apostolisch und karitativ ausgerichtet sein. In neuerer Zeit sind zu den bisherigen Lebensgemeinschaften der evangelischen Räte die Säkularinstitute hinzugekommen, in denen Frauen und Männer, Laien und Kleriker mitten in der Welt und als Sauerteig der Welt nach den evangelischen Räten leben (vgl. PC 11).
Zu allen Zeiten hat es in der Kirche Menschen gegeben, die in einer überzeugenden, ja heroischen und von der Kirche anerkannten Weise diese Heiligkeit gelebt haben. Wir nennen sie die Heiligen (im engeren Sinn des Wortes). Sie sind die hervorragenden Repräsentanten der Kirche; denn an ihnen kann man am besten ablesen, was Kirche ist. Sie sind der glaubwürdige Ausweis ihrer Heiligkeit. Sie sind zugleich Maßstab und Vorbild des christlichen Lebens. Weil sie mit uns im einen Leib Christi, in der Gemeinschaft der Heiligen verbunden sind, dürfen wir sie um ihre Fürbitte anrufen.
Die heilige Kirche schließt immer auch die Sünder ein und kann insofern auch Kirche der Sünder genannt werden. Sie muß jeden Tag beten: "Vergib uns unsere Schuld" (vgl. Mt 6,12). Deshalb hat sich die Kirche immer wieder gegen rigoristische Strömungen gewandt, die entgegen der Mahnung des Evangeliums schon jetzt das Unkraut vom Weizen scheiden (vgl. Mt 13,24-30) und eine Kirche der Reinen aufrichten wollten. Demgegenüber hielt die Kirche daran fest, daß auch die getauften Sünder zur Kirche gehören und die Kirche erst am Ende der Zeit die Kirche "ohne Flecken und Falten" (vgl. Eph 5,27) sein wird. In dieser Welt aber bedürfen die Kirche und alle ihre Glieder täglich der Buße. Das II. Vatikanische Konzil sagt: "Während aber Christus heilig, schuldlos, unbefleckt war (Hehr 7,26) und Sünde nicht kannte (2 Kor 5,21), sondern allein die Sünden des Volkes zu sühnen gekommen ist (vgl. Hebr 2,17), umfaßt die Kirche Sünder in ihrem eigenen Schoße. Sie ist zugleich heilig und stets der Reinigung bedürftig, sie geht immerfort den Weg der Buße und Erneuerung" (LG 8).
Die Spannung zwischen der Heiligkeit der Kirche und der Sündigkeit ihrer Glieder kann zuweilen ein erschreckendes Ausmaß annehmen und - etwa im späten Mittelalter - Situationen hervorbringen, in denen das Antlitz der Kirche selbst schwer entstellt ist. Auf der anderen Seite ist die Geschichte der Kirche von Reform- und Erneuerungsbewegungen geprägt; dazu gehören vor allem die verschiedenen Mönchs- und Ordensbewegungen. Die Grenze zwischen legitimer und illegitimer Reform verläuft dort, wo unveränderliche Wesensstrukturen der Kirche verändert werden sollen. Sie müssen der Kirche als heilig, d. h. als unantastbar gelten. Man kann und muß sie erneuern, aber man kann und darf sie nicht verändern oder gar abschaffen. Die Seele solcher Erneuerung der Kirche ist die persönliche Umkehr durch die Erneuerung des Lebens aus dem Geist des Evangeliums. Durch solche private und öffentliche Buße wie durch Erneuerung aus dem Glauben erweist die Kirche ihre Heiligkeit. Nur auf diese Weise kann sie glaubwürdiges Zeichen der Anwesenheit des heiligen und heiligenden Gottes in der Welt sein.
4.3 Die Katholizität der Kirche
Das Wort "katholisch" findet sich noch nicht im Neuen Testament. Ignatius von Antiochien (um 110) wendet es erstmals auf die Kirche an (Brief an die Smyrnäer 8,2). Es meint ursprünglich: "was dem Ganzen entspricht". Gemeint ist ein Doppeltes: die ganze, weltweite und universale Kirche, welche den ganzen, wahren und echten Glauben verkündet. Die wahre Kirche ist also katholisch im Unterschied zu den Gemeinschaften, die nur einen Teil der Wahrheit herausschneiden oder nur für ein bestimmtes Volk, eine bestimmte Kultur, eine bestimmte Schicht und dergleichen Kirche sein wollen.
Diese Lehre von der Katholizität der Kirche ist der Sache nach biblisch bestens begründet. Denn nach der Heiligen Schrift ist Gott selbst die allumfassende Wirklichkeit, die in Jesus Christus die ganze Fülle ihrer Gottheit wohnen ließ, um alles mit sich zu versöhnen (vgl. Kol 1,19-20) und alles zusammenzufassen (vgl. Eph 1,9-10). Die Kirche ist durch den Heiligen Geist der von Jesus Christus erfüllte Raum, mit dem Christus das All erfüllt (vgl. Eph 1,23). Zur Fülle der Heilsbotschaft und Heilswirklichkeit gehört es, daß sie ihren ganzen Reichtum nur dadurch offenbaren kann, daß sie eingeht in die ganze Vielfalt der Völker und ihrer Kulturen (vgl. Eph 3,8-12; Kol 1,24-28). "Die Kirche ist katholisch" heißt also: Sie verkündet den ganzen Glauben und das ganze Heilfür den ganzen Menschen und die ganze Menschheit; alle Heilswahrheiten und alle Heilsmittel haben in ihr ihre Heimat.
Konkret verwirklicht sich die Katholizität der Kirche in dreifacher Weise:
1. Die Kirche ist katholisch, weil sie in die ganze Welt gesandt ist, um das Evangelium allen Geschöpfen zu verkünden (vgl. Mk 16,15; Mt 28,19-20). Sie ist zu allen Völkern und Kulturen, allen Rassen und Klassen gesandt und muß einerseits allen ihren Reichtum mitteilen und andererseits von den Reichtümern aller selbst bereichert werden (vgl. LG 13).
2. Die Kirche ist katholisch, indem sie Kirche am Ort, Kirche in einem ganz bestimmten geschichtlichen Raum und zugleich universale Weltkirche ist.
3. Jede Ortskirche und die Kirche insgesamt bedürfen in ihrer eigenen Mitte einer Fülle von Gaben, Diensten, Ständen, d. h. Gruppen, die das Christsein unterschiedlich, im Stand der Ehe oder im Ordensstand, als Laie oder als Kleriker verwirklichen.
Katholizität meint also nicht monotone Uniformität, sondern vielfarbigen Reichtum, im recht verstandenen Sinn auch Spannungsreichtum. Die katholische Kirche ist ein offenes und kein geschlossenes System, bei dem man alles von einem einzigen Prinzip ableiten könnte. Jeder Teil und jedes Element, jede Gruppe und jede Bewegung muß freilich, um als katholisch gelten zu können, den Spannungsbogen zu den anderen Teilen und Elementen aushalten und in Gemeinschaft mit ihnen bleiben. Die Katholizität ist Gabe und Aufgabe zugleich.
Denn die Kirche ist das messianische Volk Gottes, das, obwohl es tatsächlich nicht alle Menschen umfaßt und gar oft als kleine Herde erscheint, für das ganze Menschengeschlecht Keimzelle der Einheit, der Hoffnung und des Heils ist (vgl. LG 9). Die schon bestehende Katholizität will also durch missionarische Einpflanzung der Kirche in allen Völkern und Kulturen erst noch voll verwirklicht werden. Dies gilt auch noch unter einem zweiten Gesichtspunkt. Die Katholizität der Kirche wird nämlich verdunkelt durch die Existenz anderer Kirchen und Kirchengemeinschaften, die ihrerseits den Anspruch auf Katholizität erheben. Durch solche Spaltungen verliert die Kirche nicht ihre Katholizität, aber sie erschweren es der Kirche, die ihr eigene Fülle der Katholizität "unter jedem Aspekt in der Wirklichkeit des Lebens auszuprägen" (UR 4). Voll verwirklichte Katholizität ist also nur möglich auf dem Weg der Ökumenizität. Diese führt, recht verstanden und recht verwirklicht, nicht zu Abstrichen am Katholischen, sondern zur vollen Verwirklichung des Katholischen.
4.4 Die Apostolizität der Kirche
Die Evangelien berichten übereinstimmend, daß Jesus Christus seine vom Vater empfangene Sendung den Aposteln weitergegeben und sie beauftragt hat, an seiner Stelle in der Kraft des Heiligen Geistes das Evangelium allen Völkern zu verkünden bis zur Vollendung der Welt.
- "Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern, und macht alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiß: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt." (Mt 28,18-20; vgl. Mk 16,15-20; Lk 24,47-48; Apg 1,8).
- "Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch." (Joh 20,21)
- "Wer euch hört, der hört mich, und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab; wer aber mich ablehnt, der lehnt den ab, der mich gesandt hat." (Lk 10,16)
So ist die Kirche, deren Grund Jesus Christus ist, bleibend auf das von Jesus Christus gesetzte Fundament der Apostel gebaut und für immer an ihr Zeugnis gebunden (vgl. Mt 16,18; Eph 2,20; Offb 21,14; LG 19). Sie kann wahre Kirche Jesu Christi nur sein, wenn sie apostolische Kirche ist und über die Zeiten hinweg die Identität mit dem apostolischen Anfang bewahrt.
Doch wie ist das möglich? Die Apostel, deren Zeugnis "bis zur Vollendung der Welt" gilt, sind für ihr Zeugnis in den Tod gegangen und haben es mit ihrem Blut besiegelt. Wo begegnen wir also heute dem Wort der Apostel? Wie können sie gegenwärtig sein bis zum Ende der Zeit? Mit dieser Frage berühren wir den neuralgischen Punkt in der ökumenischen Auseinandersetzung um die wahre Kirche.
Um weiterzukommen, müssen wir zuerst fragen: Was und wer ist ein Apostel? Wir sind gewöhnt, von zwölf Aposteln zu sprechen. In der Tat hat Jesus die Zwölf in seine besondere Nachfolge und in seinen besonderen Dienst berufen (vgl. Mk 3,13-19; 6,6b-13). Nach Ostern nannte man Apostel die Erstzeugen der Auferstehung des Herrn, die vom Auferstandenen in alle Welt gesandt wurden, um die frohe Botschaft zu verkünden (vgl. 1 Kor 9,1-2; 15,7-8). Dazu gehörten außer den Zwölfen vor allem der Apostel Paulus (vgl. Gal 1,1; 2 Kor 1,1 u. a.), aber auch Jakobus, der Bruder des Herrn (vgl. Gal 1,19). Daneben gibt es im Neuen Testament noch einen weiteren Begriff von Apostel: Männer und Frauen, die als Abgesandte von Kirchen im missionarischen Dienst stehen. So sprechen wir noch heute etwa von Bonifatius als dem Apostel der Deutschen, von Cyrill und Methodius als den Aposteln der Slawen. Doch dies ist ein abgeleiteter und uneigentlicher Gebrauch des Wortes Apostel. Im eigentlichen Sinn ist das Apostolat einmalig, weil an die unmittelbare und weltweite Sendung des Auferstandenen gebunden. Die Apostel sind darum ein für allemal grundlegend für die Kirche. Das führt uns erneut zu der Frage: Wie können die Apostel und ihr Wort gegenwärtig sein bis zur Vollendung der Welt?
Im Neuen Testament finden sich deutliche Hinweise, wie die apostolische Sendung in der nachapostolischen Zeit weitergeführt werden soll. Es bezeugt, daß die Apostel noch zu ihren Lebzeiten nicht nur Helfer eingesetzt, sondern auch Männer beauftragt haben, nach ihrem Tod ihr Werk zu vollenden und zu kräftigen, damit die ihnen anvertraute Sendung bis ans Ende der Zeiten fortdauern kann. Dies geht deutlich aus der Abschiedsrede hervor, die Paulus nach der Apostelgeschichte in Milet vor den Presbytern der Gemeinde von Ephesus gehalten hat:
- "Gebt acht auf euch und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist zu Bischöfen bestellt hat, damit ihr als Hirten für die Kirche Gottes sorgt, die er sich durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben hat. Ich weiß: Nach meinem Weggang werden reißende Wölfe bei euch eindringen und die Herde nicht schonen. Und selbst aus eurer Mitte werden Männer auftreten, die mit ihren falschen Reden die Jünger auf ihre Seite ziehen.
- Seid also wachsam, und denkt daran, daß ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, unter Tränen jeden einzelnen zu ermahnen. Und jetzt vertraue ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das die Kraft hat, aufzubauen und das Erbe in der Gemeinschaft der Geheiligten zu verleihen." (Apg 20,28-32)
Auch die Pastoralbriefe (1. und 2. Brief an Timotheus, Brief an Titus) bezeugen diese Weitergabe der apostolischen Sendung. Wahrscheinlich stammen diese Briefe von einem Paulusschüler; dieser bezeugt, daß Paulus den Timotheus und Titus beauftragt hat, das anvertraute Gut und die reine und gesunde Lehre treu zu bewahren (vgl. 1 Tim 4,16; 6,20, 2 Tim 1,14; 4,3 u. a.), selbst wieder anderen Männern die Hände aufzulegen und in den apostolischen Dienst zu stellen (vgl. 1 Tim 4,14; 2 Tim 1,6; 2,2; Tit 1,5). So zeichnet sich bereits im Neuen Testament der Übergang von der apostolischen zur nachapostolischen Zeit ab. Daß dies erst in den späteren Schriften des Neuen Testaments geschieht, ist leicht verständlich, weil die Frage, wie es nach dem Tod der Apostel weitergehen soll, sich erst unmittelbar vor oder nach deren Tod ausdrücklich gestellt hat.
Von Anfang an hat die Tradition der Kirche die Hinweise des Neuen Testaments aufgegriffen. Bereits bei Clemens von Rom (um 95) und Ignatius von Antiochien (um 110) ist der Gedanke einer apostolischen Nachfolge lebendig; schon Hegesipp (um 180) stellt Bischofslisten auf, und bei Irenäus von Lyon (um 180) und bei Tertullian (um 200) finden wir schon eine ausführliche Theologie der apostolischen Nachfolge. Das II. Vatikanische Konzil faßt die Lehre von Schrift und Tradition zusammen, wenn es lehrt, "daß die Bischöfe aufgrund göttlicher Einsetzung an die Stelle der Apostel als Hirten der Kirche getreten sind" (LG 20). In ihnen ist die den Aposteln verliehene Sendung, ja Jesus Christus selbst, bleibend in der Kirche anwesend (vgl. LG 21).
Man darf die Lehre von der apostolischen Nachfolge nicht mißverstehen. Sie will nicht sagen, die Bischöfe seien neue Apostel. Das Apostelamt ist einmalig, aber bestimmte apostolische Funktionen müssen entsprechend dem Wort Jesu Christi über die Zeit der Apostel hinaus weitergeführt werden. Man muß also unterscheiden zwischen dem einmaligen Apostelamt und dem bleibenden apostolischen Amt. Nur in letzter Hinsicht sind die Bischöfe Nachfolger der Apostel. Diese Nachfolge darf nicht rein äußerlich im Sinn einer bloßen Kette der Handauflegungen oder einer ununterbrochenen Besetzung der Bischofssitze mißverstanden werden. Sie muß vielmehr im Gesamtzusammenhang gesehen werden:
1. Sie steht im Zusammenhang der Weitergabe des apostolischen Glaubens und ist an ihn gebunden. Die Sukzession ist die Gestalt der Tradition, und die Tradition ist der Gehalt der Sukzession. Ein Bischof, der aus dem apostolischen Glauben herausfällt, verliert eo ipso das Recht auf Ausübung seines Amtes.
2. Die apostolische Nachfolge eines einzelnen Bischofs steht im Zusammenhang mit der apostolischen Nachfolge des gesamten Kollegiums der Bischöfe. Die Zwölf waren ja in ihrer Gesamtheit Repräsentanten Israels. So folgt das Kollegium der Bischöfe dem Kollegium der Apostel nach. Als Glied des gesamten Episkopats steht der Einzelbischof in der apostolischen Sukzession. Deshalb geschieht nach altkirchlicher Tradition die Weihe eines Bischofs jeweils durch mindestens drei Bischöfe.
3. Die Kirche insgesamt ist apostolisch. Deshalb steht die apostolische Sukzession im Dienst der Kirche. Dies kommt vor allem in der Praxis zum Ausdruck, daß ein Bischof für den Dienst in einer bestimmten Ortskirche geweiht wird.
Die Kirche ist also apostolisch, wenn in ihr der Glaube der Apostel dadurch lebendig und fruchtbar ist, daß die apostolische Sendung, die dauern soll bis zur Vollendung der Tage, weitergeführt wird. Gestalt und Gehalt der apostolischen Sendung lassen sich nicht trennen. Deshalb kann die Apostolizität der Kirche nicht allein durch die Treue zu den apostolischen Schriften bewahrt werden. Es bedarf der lebendigen und vollmächtigen apostolischen Bezeugung des in die Schrift eingegangenen apostolischen Glaubens. Nur wo beides gegeben ist, ist wahre Kirche Jesu Christi. Deshalb muß nun abschließend noch von den Diensten und Ämtern in der Kirche die Rede sein.
5. Dienste und Ämter in der Kirche
5.1 Das gemeinsame Priestertum aller Getauften
Wir sagten es schon: Kirche, das sind alle getauften Christen. Alles bisher Gesagte gilt also nicht nur von Papst und Bischöfen, von einer "Klerikerkaste" oder einer kirchlichen "Funktionärsschicht", die man oft mit dem völlig verkehrten Wort "Amtskirche" bezeichnet. Die Wahrheit, daß alle getauften Christen Kirche sind, war freilich lange Zeit weithin vergessen, und noch heute klagen viele Pfarrer über die Schwierigkeit, Laien als Mitarbeiter zu gewinnen, wie umgekehrt viele Laien, die mitarbeiten möchten, sich beklagen, daß ihnen zu wenig Möglichkeit für eine verantwortliche Mitarbeit zugestanden wird. Eine Besinnung auf das gemeinsame Priestertum aller Getauften und auf die gemeinsame Verantwortung aller in der Kirche und für die Kirche tut also not.
Die Magna Charta des gemeinsamen Priestertums aller getauften Christen findet sich im 1. Petrusbrief:
- "Laßt euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen ... Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Einst wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk."(1 Petr 2,5.9-10; vgl. Offb 1,6; 5,10, 20,6)
Das II. Vatikanische Konzil hat diese Wahrheit vom gemeinsamen Priestertum aller Getauften neu herausgestellt und gesagt, daß alle Christen durch Taufe und Firmung teilhaben am prophetischen, priesterlichen und königlichen Amt Jesu Christi, so daß alle beauftragt und befähigt sind, beizutragen zum Wachstum und zur Heiligung der Kirche (vgl. LG 30-38; AA 1-8). Das Konzil hat mit Bedacht hinzugefügt, daß diese Wahrheit gerade in der heutigen Zeit von besonderer Bedeutung ist (vgl. LG 30). Sie ist eine wesentliche Grundlage der gegenwärtigen pastoralen Erneuerung.
Wer und was ist ein Laie? In unserer Alltagssprache bezeichnen wir als Laien einen Nicht-Fachmann, also einen, der von einer Sache nichts versteht, oder einen Dilettanten, bestenfalls einen Amateur, der zwar gewisse Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt, aber eine Sache nicht von Grund auf kennt. Anders in der Kirche! Hier ist das Wort Laie eine Würdebezeichnung. Denn Laie ist, wer durch die Taufe Jesus Christus und der Kirche eingegliedert ist. Die Laien unterscheiden sich von den Klerikern nicht dadurch, daß sie weniger Christen oder Christen zweiter Klasse sind, sondern dadurch, daß sie keine amtliche Sendung in der Kirche haben, von den Ordensleuten dadurch, daß sie in der Welt leben und wirken. Ihnen ist der "Weltcharakter" in besonderer Weise eigen. Das II. Vatikanische Konzil lehrt:
- "Sache der Laien ist es, kraft der ihnen eigenen Berufung in der Verwaltung und gottgemäßen Regelung der zeitlichen Dinge das Reich Gottes zu suchen. Sie leben in der Welt, das heißt in all den einzelnen irdischen Aufgaben und Werken und den normalen Verhältnissen des Familien- und Gesellschaftslebens, aus denen ihre Existenz gleichsam zusammengewoben ist. Dort sind sie von Gott gerufen, ihre eigentümliche Aufgabe, vom Geist des Evangeliums geleitet, auszuüben und so wie ein Sauerteig zur Heiligung der Welt gewissermaßen von innen her beizutragen und vor allem durch das Zeugnis ihres Lebens, im Glanz von Glaube, Hoffnung und Liebe Christus den anderen kund zu machen. Ihre Aufgabe ist es also in besonderer Weise, alle zeitlichen Dinge, mit denen sie eng verbunden sind, so zu durchleuchten und zu ordnen, daß sie immer Christus entsprechend geschehen und sich entwickeln und zum Lob des Schöpfers und Erlösers gereichen." (LG 31; vgl. GS 43)
Diese Weltverantwortung der Laien bringt eine wesentliche Dimension der Kirche zum Ausdruck. Die Kirche ist ja wesentlich Kirche in der Welt und für die Welt. Der Dienst der Kirche darf also nicht nur oder auch nur primär in der Gemeinde gesehen werden. Das wäre eine schlimme Verkürzung. Vor allem Ehe und Familie sind ein wichtiger Bereich des Apostolats der Laien. Sie sind Ursprung und Fundament der menschlichen Gesellschaft (vgl. AA 11) wie Kirche im Kleinen, eine Art Hauskirche (vgl. LG 11). Dazu kommen der Bereich der Erziehung, das soziale Milieu, der Arbeitsplatz, Wissenschaft, Kunst, Literatur, Wirtschaft und Politik. In diesen gerade heute wichtigen Bereichen wird die Sendung der Kirche primär von den Laien ausgeübt. Da die Gnadengaben (Charismen) den jeweiligen Nöten der Kirche angepaßt sind (vgl. LG 12), wird man sagen können, daß die Kirche heute vor allem charismatischer Laien im Bereich der Wissenschaft, der Kunst, der Technik, der Politik, der Erziehung, der Publizistik u. a. bedarf, damit der christliche Glaube in sichtbarer und wirksamer Beispielhaftigkeit inmitten der Welt vorgelebt und damit offenbar wird, was die Heilswirklichkeit für die wahre Gestalt der menschlichen Gemeinschaft bedeutet.
Die besondere Weltverantwortung der Laien schließt nicht aus, daß die Laien auch zur Mitwirkung und Mitverantwortung in der Kirche berufen sind. Im Gegenteil, das Apostolat der Laien bezieht sich sowohl auf die Kirche wie auf die Welt (vgl. AA 9). Sie sollen die Probleme, die Hoffnungen und Erwartungen, aber auch die Ängste und Sorgen der Welt in der Kirche präsent machen und zugleich nach Antworten aus dem Geist des Evangeliums suchen. Sie sollen sich also um einen selbstverantwortlichen Glauben bemühen und aus dem Glauben heraus das Leben der Gemeinde und der Kirche insgesamt mitbestimmen. Die Gemeinden müssen immer mehr zu Gemeinden werden, die in gemeinsamer Verantwortung aller sowie in unvertretbarer Verantwortung jedes einzelnen ihr Leben in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche selbst gestalten (vgl. Gem. Synode, Die pastoralen Dienste in der Gemeinde 1.3.2). Wir brauchen also gerade heute den mündigen Laien, mündig freilich im Glauben und in der Liebe. Dabei ist von besonderer Wichtigkeit, daß die Frauen in allen Bereichen des Apostolats der Laien einen ebenbürtigen Platz einnehmen (vgl. AA 9).
Die Mitverantwortung der Laien in der Gemeinde und in der Kirche kann in sehr unterschiedlicher Weise geschehen. Jeder hat sein Charisma! Die einen bemühen sich um Vorbereitung und Mitgestaltung des Gottesdienstes, besonders als Lektor, Akolyth, Cantor, Kommentator, andere um katechetische oder um karitative und soziale Dienste, um Betreuung von einzelnen Gruppen, Gemeindebezirken, Familien, einzelnen, wieder andere um die Durchführung besonderer Aktionen. Daneben gibt es die verantwortliche Mitarbeit in Gruppen, Kreisen, Vereinen und Verbänden. Ganz besonders ist das stellvertretende Gebet und das stellvertretende Leiden zu nennen; beides leistet einen unersetzlichen Beitrag zur Wirklichkeit der Kirche und ihrer Einheit mit dem leidenden Christus. Einzelne Laien können auch in verschiedener Weise zur unmittelbaren Mitarbeit am Apostolat des kirchlichen Amtes berufen und durch besondere Beauftragung zu bestimmten kirchlichen Diensten bestellt werden, sei es ehrenamtlich oder hauptamtlich, beruflich oder nebenberuflich (vgl. LG 33). Besonders in den ganz schwierigen Situationen der Kirche "treten die Laien, soweit es ihnen möglich ist, an die Stelle der Priester" (AA 17). In der Kirche in Deutschland nehmen Laien vor allem als Pastoral- oder Gemeindereferenten an manchen amtlichen Aufgaben der Kirche teil (vgl. Gem. Synode, Die pastoralen Dienste in der Gemeinde 3.3).
Auch in der Kirche gibt es eine Entsprechung von Rechten und Pflichten. Das neue Kirchenrecht hat sie deutlich herausgestellt (vgl. CIC can. 208-231). Das Grundrecht aller Christen besteht darin, "aus den geistlichen Gütern der Kirche vor allem die Hilfe des Wortes und der Sakramente von den geweihten Hirten reichlich zu empfangen". Sie haben außerdem das Recht, ihre Bedürfnisse und Wünsche vorzutragen und entsprechend dem Wissen, der Zuständigkeit und Stellung, die sie einnehmen, "bisweilen auch die Pflicht, ihre Meinung in dem, was das Wohl der Kirche angeht, zu erklären". Die Gläubigen sollen ihren Hirten in dem, was sie in Ausübung ihrer Sendung sagen und tun, bereitwillig folgen; umgekehrt sollen aber auch die Hirten die Würde und Verantwortung der Laien in der Kirche anerkennen und fördern und deren klugen Rat suchen. Sie sollen vor allem die gerechte Freiheit, die allen im irdischen, bürgerlichen Bereich zusteht, sorgfältig anerkennen. Aus solchem "vertrauten Umgang zwischen Laien und Hirten kann man viel Gutes für die Kirche erwarten" (LG 37).
Die Mitarbeit und Mitverantwortung der Laien bedarf auch bestimmter Institutionen und Gremien. Diese sollen nach dem Willen des II. Vatikanischen Konzils und der Gemeinsamen Synode auf allen Ebenen kirchlichen Lebens eingerichtet werden (vgl. CD 27; AA 26; Gem Synode, Verantwortung des ganzen Gottesvolkes für die Sendung der Kirche). Diese Gremien sollen anstehende Probleme zeitig wahrnehmen, sozusagen auf die Signale des Heiligen Geistes achten; sie sollen Informationen sammeln und weitergeben, die verschiedenen Dienste inspirieren und koordinieren, die gemeinsame Arbeit beraten, planen, für ihre Durchführung besorgt sein und nach ihrer Durchführung in einen Erfahrungsaustausch darüber eintreten. Soll dies alles nicht in einer aktionistischen, sondern in einer geistlichen Weise geschehen, dann werden sie sich immer wieder zu gemeinsamem Gebet und Gottesdienst versammeln müssen. Das macht deutlich, daß in der Kirche nicht der Amtsträger allein alles planen, beherrschen, organisieren, entscheiden und machen soll. Doch damit stehen wir am entscheidenden Punkt: Wie verhält sich das gemeinsame Priestertum aller getauften Christen zum Amt in der Kirche?
5.2 Das Amt in der Kirche
Die Schwierigkeiten, die viele mit dem Amt in der Kirche haben, sind teilweise darin begründet, daß das deutsche Wort "Amt" unpersönlich klingt. Es läßt uns an eine anonyme obrigkeitliche Behörde denken; entsprechend denken wir beim Wort Amtsträger zunächst an einen unpersönlichen Funktionär. Nur selten ist man sich bewußt, daß im ursprünglichen Sinn Amtmann soviel wie Dienstmann im Sinn des Boten und Botschafters bedeutet. Es ist freilich eine Tatsache, daß das kirchliche Amt im Laufe der Geschichte manchmal herrscherliche, obrigkeitliche und beamtenhafte Züge angenommen hat, vor allem seit die Bischöfe durch Kaiser Konstantin den Staatsbeamten gleichgestellt wurden und im Mittelalter sogar Reichsfürsten waren. Freilich gab es immer auch selbstlose und eifrige Seelsorger, sowohl unter den Priestern wie unter den Bischöfen und Päpsten. Sie haben ihr Amt im Sinn des Neuen Testaments nicht als Herrschaft, sondern als selbstlosen Dienst eines Boten, als personalen Zeugendienst verstanden.
Genauere Auskunft über Wesen und Struktur des kirchlichen Amtes erhalten wir, wenn wir nach der Stiftung Jesu Christi und nach deren Auslegung im Neuen Testament wie in der kirchlichen Überlieferung fragen. Nach dem Zeugnis des Neuen Testaments verkündete Jesus zwar dem ganzen Volk, aber er berief die Zwölf in seine engere Nachfolge und ließ sie in besonderer Weise teilhaben an seiner Sendung (vgl. Mk 3,13-19; 6,6b-13). Der Auferstandene erschien "nicht dem ganzen Volk, wohl aber den von Gott vorherbestimmten Zeugen" (Apg 10,41) und sandte sie aus in alle Welt (vgl. Mt 28,18-20). So gibt es nach dem Willen Jesu Christi neben der gemeinsamen Berufung und dem gemeinsamen Dienst aller die besondere apostolische Berufung und den besonderen apostolischen Dienst in der Kirche.
Besondere Dienstämter gab es in der Kirche von Anfang an. Verständlicherweise stand in der Urkirche und in den frühen Gemeinden zunächst die Autorität der Apostel im Vordergrund, die Frage der nachapostolischen Ämter stellte sich ausdrücklich erst unmittelbar vor oder nach deren Tod. Doch schon Paulus erwähnt Vorsteher und Sich-Mühende (vgl. 1 Thess 5,12), Episkopen und Diakone (vgl. Phil 1,1). In der Apostelgeschichte hören wir vor allem von Presbytern. Anfangs bestand also eine Vielgestaltigkeit der Ämterstrukturen und -bezeichnungen. Doch schon bald gewinnt das Verkündigungsund Leitungsamt in Fortführung der Tätigkeit der Apostel eine wesentliche Bedeutung. Die Evangelisten, Hirten und Lehrer (vgl. Eph 4,11) sorgen auf dem Fundament der Apostel und Propheten (vgl. Eph 2,20) für den Aufbau des Leibes Christi, d. i. der Kirche. Sie gewährleisten die Kontinuität mit dem apostolischen Ursprung und sollen die Einheit aller Glaubenden fördern (vgl. Eph 4,13). In Apg 20,17-38 und vor allem in den Pastoralbriefen beginnen sich die unterschiedlichen Ämterstrukturen bereits zu vereinheitlichen. Diese Entwicklung kam erst in der unmittelbar nachneutestamentlichen Zeit zum Abschluß. Ignatius von Antiochien (um 110) bezeugt uns schon das dreigegliederte Amt: ein Bischof als Leiter der Ortskirche, die Presbyter, die ihn dabei unterstützen, und die Diakone, die neben bestimmten liturgischen Funktionen vor allem karitative Dienste wahrnehmen.
Das II. Vatikanische Konzil (1962-1965) faßt die Auslegung der Stiftung Jesu durch die Heilige Schrift und die Tradition zusammen: "So wird das aus göttlicher Einsetzung kommende kirchliche Dienstamt in verschiedenen Ordnungen ausgeübt, von jenen, die schon seit alters Bischöfe, Priester, Diakone heißen" (LG 28). Die Fülle des Amts kommt den Bischöfen zu, die "aufgrund göttlicher Einsetzung an die Stelle der Apostel als Hirten der Kirche getreten sind" (LG 20). Die Priester nehmen am Amt des Bischofs Anteil (vgl. LG 28). Dies geschieht durch die Verkündigung, die Spendung der Sakramente, besonders die Feier der Eucharistie, und durch den Hirtendienst (vgl. PO 4-6). Die Diakone üben innerhalb des Amtes die Diakonie im Wort, in der Liturgie und in der Liebestätigkeit aus (vgl. LG 29).
Alle kirchlichen Ämter müssen in der Nachfolge und nach dem Auftrag Jesu Christi als Dienst verstanden werden. Die Mahnung Jesu ist hier völlig klar und eindeutig:
- "Ihr wißt, daß die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen mißbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein, und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele." (Mk 10,42-45)
Das II. Vatikanische Konzil hat den Dienstcharakter des kirchlichen Amtes nochmals deutlich herausgestellt:
- "Um Gottes Volk zu weiden und immerfort zu mehren, hat Christus, der Herr, in seiner Kirche verschiedene Dienstämter eingesetzt, die auf das Wohl des ganzen Leibes ausgerichtet sind. Denn die Amtsträger, die mit heiliger Vollmacht ausgestattet sind, stehen im Dienste ihrer Brüder, damit alle, die zum Volke Gottes gehören und sich daher der wahren Würde eines Christen erfreuen, in freier und geordneter Weise sich auf das nämliche Ziel hin ausstrecken und so zum Heile gelangen." (LG 18)
Der Dienst des kirchlichen Amtes setzt freilich Sendung und Vollmacht voraus. So wie Jesus Christus seine Sendung vom Vater empfangen hat, so hat er sie seinen Jüngern gegeben (vgl. Joh 20,21; 17,18). Niemand, kein einzelner und keine Gemeinde, kann sich ja das Evangelium selber verkünden; erst recht kann sich niemand die Gnade selber geben. Das Evangelium muß zugesprochen, die Gnade muß gegeben und geschenkt werden. Das setzt bevollmächtigte Boten voraus, deren Botschaft im Wort Christi gründet (vgl. Röm 10,14-17). Die Vollmacht des kirchlichen Amtes gründet also nicht in der Beauftragung durch die Kirche oder die Gemeinde, sondern in der Sendung durch Jesus Christus. Das kirchliche Amt tut seinen Dienst im Namen, ja in der Person Jesu Christi. Jesus selbst sagt: "Wer euch hört, der hört mich" (Lk 10,16). Paulus ruft an Christi Statt (vgl. 2 Kor 5,20). So nimmt das Amt teil am dreifachen Amt Jesu Christi; Christus selbst ist es, der durch seine Boten spricht und handelt (vgl. LG 21; 28; PO 1-2).
Aus dieser Wesensbestimmung des kirchlichen Amtes ergibt sich die Verhältnisbestimmung zwischen dem kirchlichen Amt und der Kirche bzw. der Gemeinde, genauer: zwischen dem gemeinsamen Priestertum aller Gläubigen und dem besonderen Priestertum des Dienstes. Das II. Vatikanische Konzil lehrt:
- "Das gemeinsame Priestertum der Gläubigen aber und das Priestertum des Dienstes ... unterscheiden sich zwar dem Wesen und nicht bloß dem Grade nach. Dennoch sind sie einander zugeordnet: das eine wie das andere nämlich nimmt je auf besondere Weise am Priestertum Christi teil." (LG 10)
Damit ist nicht gemeint, der Amtsträger sei ein besserer bzw. höherer Christ als der "gewöhnliche" Laie. Im Gegenteil, bezüglich des Christseins sind beide grundsätzlich gleichgestellt; es gibt sogar viele Laien, welche durch ihr heiligmäßiges Leben die Amtsträger tief beschämen. Der Unterschied zwischen dem gemeinsamen Priestertum der Gläubigen und dem Priestertum des Dienstes liegt nicht auf der Ebene der persönlichen Heiligkeit, sondern auf der Ebene des Dienstes und der Sendung. In diesem Sinn sind beide nicht graduell, sondern wesentlich unterschieden. Denn die Sendung des Amtes läßt sich nicht aus der der Gemeinde ableiten, sie kommt von Jesus Christus.
Zusammenfassend kann man sagen: Das kirchliche Amt steht der Gemeinde gegenüber, wie es zugleich in der Gemeinde steht. Diese Spannung zwischen dem "in" und dem "gegenüber" ist unaufhebbar und darf in keiner Richtung eingeebnet werden. Denn wie alle anderen Christen bedarf der Amtsträger täglich der Vergebung. Er wird vom Glauben der Kirche und der Gemeinden getragen und muß mit allen anderen Charismen und Diensten in der Kirche zusammenarbeiten. Seine Sendung stellt ihn aber auch der Kirche bzw. Gemeinde gegenüber. Dadurch sind die Amtsträger "innerhalb der Gemeinde des Gottesvolkes in bestimmter Hinsicht abgesondert, aber nicht, um von dieser, auch nicht von irgendeinem Menschen, getrennt zu werden". Ihr Dienst verlangt zwar, daß sie sich dieser Welt nicht gleichförmig machen (vgl. Röm 12,2); er erfordert aber zugleich, "daß sie in dieser Welt mitten unter den Menschen leben" (PO 3).
Der Dienstcharakter des kirchlichen Amtes kommt auch dadurch zum Ausdruck, daß das Amt nie einem einzelnen allein, sondern dem einzelnen nur in Gemeinschaft mit anderen Amtsträgern als Teilhabe an dem einen gemeinsamen Amt übertragen wird. Man spricht von der Kollegialität des Amtes. So hat jeder einzelne Bischof sein Amt innerhalb des Kollegiums der Bischöfe in Gemeinschaft mit und unter dem Bischof von Rom, dem Nachfolger des hl. Petrus (vgl. LG 22-23; CD 4). Jeder Priester hat sein Amt innerhalb des Presbyteriums einer Diözese unter der Leitung des Bischofs (vgl. LG 28; PO 7-8). Gerade heute kann kein einzelner Priester und kein einzelner Bischof sein Amt abgesondert und als einzelner hinreichend erfüllen, sondern nur in brüderlicher Verbundenheit und Zusammenarbeit mit den andern, die denselben Dienst ausüben. Diese gemeinsame Verantwortung kommt institutionell vor allem im Priesterrat einer Diözese, in den Bischofskonferenzen und in der Bischofssynode zum Ausdruck.
Bei aller grundsätzlichen Festigkeit der kirchlichen Lehre bestehen in der gegenwärtigen Kirche bezüglich des kirchlichen Amtes einige schwerwiegende Probleme, die wir hier nur andeuten, aber nicht vollständig behandeln können. Das II. Vatikanische Konzil hat den Diakonat als eigenständige, auf Dauer angelegte Weihestufe wieder erneuert (vgl. LG 29). In der nachkonziliaren Erneuerungsbewegung sind 1972 die sogenannten niederen Weihen durch die Beauftragung zum Lektor und Akolyth ersetzt worden. Daneben sind eineVielzahl von neuen Diensten in der Kirche entstanden. Sie haben das Leben der Kirche und der Gemeinden wesentlich bereichert; ihr Dienst ist aus dem Alltag der Kirche nicht mehr wegzudenken. Doch das Eigenprofil des Diakonats wie der neuen Dienste ist noch nicht in allem hinreichend geklärt. Vor allem ist die Zuordnung der neuen Dienste zum kirchlichen Amt in mancher Hinsicht noch klärungsbedürftig. Erste wichtige Klärungen für den Bereich der Kirche in Deutschland wurden durch die Gemeinsame Synode gegeben.
Eine andere vieldiskutierte Frage ist das Problem der Zulassung der Frauen zum Priesteramt. In ihrer menschlichen und christlichen Würde sind Frauen den Männern ebenbürtig. Deshalb sollen Frauen in allen Bereichen des Apostolats der Laien einen ebenbürtigen Platz einnehmen (vgl. AA 9). Bei den neuen Diensten leisten Frauen schon jetzt einen unersetzlichen Beitrag. Die römische Kongregation für die Glaubenslehre hat 1976 jedoch erneut festgestellt, daß der katholischen Kirche aufgrund des Beispiels Jesu wie aufgrund der gesamten kirchlichen Tradition die Zulassung der Frau zum priesterlichen Amt nicht möglich erscheint. Dies ist keine letztverbindliche dogmatische Entscheidung. Die Argumente aus Schrift und Tradition haben freilich erhebliches Gewicht und müssen in der Kirche gegenüber den Argumenten aus der Forderung nach gesellschaftlicher Gleichberechtigung von Mann und Frau eindeutig das Übergewicht haben. Anders als die Frage des Priestertums stellt sich die Frage nach der Zulassung von Frauen zum sakramentalen Diakonat. Sie bedarf jedoch noch weiterführender Diskussion, vor allem aber einer Konsensbildung in der gesamten Kirche.
Nach dem Konzil kam es zu einer breiten Diskussion um die Frage der "Demokratisierung" der Kirche. Nach allem bisher Gesagten ist in der Kirche die Einführung der Volkssouveränität oder des Mehrheitsprinzips ausgeschlossen. In der Kirche entscheidet nicht die Mehrheitsmeinung, sondern das Evangelium Jesu Christi, das bestimmten beauftragten Zeugen in besonderer Weise anvertraut ist. Anders ist es, wenn man an einen gewissen demokratischen Stil und an manche demokratische Verfahrensweisen denkt. Sie können zur Aktivierung der Gemeinden beitragen, mehr Mitarbeit ermöglichen, den Informationsfluß verbessern und die Voraussetzungen dafür schaffen, daß Entscheidungen, die nach eingehender Beratung getroffen wurden, bereitwilliger angenommen und verwirklicht werden. Dieser Aufgabe dienen die Gremien der gemeinsamen Mitverantwortung in der Kirche.
Die Frage des Amtes in der Kirche betrifft auch einen der wichtigsten Lehrunterschiede zwischen der römisch-katholischen Kirche und den aus der Reformation des 16. Jahrhunderts hervorgegangenen Kirchen und Kirchengemeinschaften. Die Bedeutung dieser Frage ergibt sich vor allem daraus, daß gegenseitige Anerkennung des Amtes eine Voraussetzung für Eucharistiegemeinschaft darstellt (vgl. UR 22). Dabei geht es vor allem um die göttliche Stiftung des Amtes, um die Sakramentalität der Ordination bzw. Priesterweihe, um die apostolische Nachfolge, die bischöfliche Struktur des Amtes und nicht zuletzt um das Petrusamt. In allen diesen Fragen ist man in der Zwischenzeit im ökumenischen Gespräch zu bemerkenswerten, wenngleich noch nicht vollständigen Gemeinsamkeiten gekommen (vgl. "Das geistliche Amt in der Kirche"; das Dokument von Lima "Taufe, Eucharistie und Amt"). Auch in der Frage des Petrusamtes in der Kirche haben sich weiterführende Ansätze gezeigt, obwohl gerade in dieser Frage die Diskussion nach wie vor sehr schwierig ist. So ist in der Ämterfrage noch ein gemeinsamer Lern- und Reflexionsprozeß zwischen den getrennten Kirchen notwendig. Dabei muß man sich bewußt sein, daß sich in der Amtsfrage die grundsätzliche Frage der Sichtbarkeit der Kirche und ihrer sakramentalen Bedeutung zuspitzt. Es geht also nicht um ein isoliertes Problem. Dennoch braucht man auch in dieser Frage nicht hoffnungslos zu sein. Denn auch wenn nach katholischer Lehre die Grundstrukturen des kirchlichen Amtes durch göttliche Stiftung der Kirche vor- und aufgegeben sind, so zeigt die Geschichte doch auch, daß das Bleibende gerade bei den Ämtern sehr eng mit geschichtlich Bedingtem verbunden ist. So darf man hoffen, daß in Zukunft durch Rückbesinnung auf den Ursprung und die Geschichte wie durch Entsprechung zu den gegenwärtigen pastoralen Erfordernissen Wandlungen und Erneuerungen möglich sein werden. Maßgebend muß freilich die Stiftung Jesu Christi sein.
5.3 Das Petrusamt als Dienst der Einheit
Primat und Unfehlbarkeit des Petrusamtes gelten allgemein als typisch für das katholische Verständnis der Kirche. Während die anderen Kirchen und Kirchengemeinschaften darin ein schweres Hindernis für die ökumenische Verständigung sehen, sieht die katholische Kirche darin einen besonders wichtigen Dienst der Einheit in der Kirche. Keine andere Kirche hat bisher ein vergleichbares überzeugendes Modell der sichtbaren Einheit vorgelegt. Das ist freilich kein Grund für einen Triumphalismus. Denn Petrus, der aufgrund der Verheißung des Herrn der Felsengrund der Kirche ist, war auch der wankelmütige Jünger, der den Herrn verleugnet hat; auch dies hat die Geschichte des Papsttums bestimmt. Um das bleibend Gültige vom geschichtlich Wandelbaren beim Papsttum zu unterscheiden, spricht man heute meist vom Petrusamt. Damit ist der biblische Grund von Primat und Unfehlbarkeit des Papsttums angegeben.
Die herausgehobene Stellung des Petrus begegnet uns in vielen wichtigen Texten und Überlieferungen des Neuen Testaments, die verschiedenen Räumen entstammen, ein unterschiedliches Alter haben und praktisch allen Epochen angehören, in denen die Schriften des Neuen Testaments entstanden sind. Die drei ersten Evangelien berichten übereinstimmend, daß Petrus der von Jesus zuerst Gerufene und zuerst Gesandte war (vgl. Mk 1,16-20 par.); er ist es, welcher die Jüngerkataloge anführt (vgl. Mk 3,16 par.). Petrus war offenkundig schon zu Lebzeiten Jesu Repräsentant und Sprecher der übrigen Jünger. Mit seiner Berufung war eine Namensänderung verbunden. Er, der ursprünglich Simon hieß, erhält von Jesus den Namen Kephas, griechisch: Petros, deutsch: Fels. In der Antike war der Name nicht einfach "Schall und Rauch"; er drückte vielmehr das Wesen und die Wesensfunktion der Menschen und der Dinge aus. Petrus erhielt also vom Herrn die Aufgabe, der erste felsige Grund der Jünger und der Kirche zu sein. Er soll seine Brüder stärken (vgl. Lk 22,32).
Dieser Auftrag wurde vom Auferstandenen bestätigt. In den Osterberichten begegnet uns Petrus jeweils als der Erstzeuge der Auferstehung (vgl. 1 Kor 15,5; Lk 24,34; andeutend auch Mk 16,7 par.). Entsprechend kommt dem Petrus nach dem Zeugnis der ersten zwölf Kapitel der Apostelgeschichte wie auf dem Apostelkonzil in Jerusalem (Apg 15,1-35) die erste Autorität zu. Als Petrus in Antiochien schwach wurde, hat ihm Paulus ins Angesicht widerstanden (vgl. Gal 2,14). Dennoch hat Paulus die Autorität des Kephas anerkannt (vgl. Gal 1,18; 2,7-9) und sich bis zum Einsatz seines Lebens um die Einheit bemüht, weil er wußte, daß er sonst ins Leere gelaufen wäre (vgl. Gal 2,2). Daß die Autorität des Petrus auch noch über seinen Tod hinaus galt, zeigen vor allem die dreimal bekräftigte Übertragung des Hirtenamtes auf Petrus durch den Auferstandenen (vgl. Joh 21,15-17) sowie die beiden Briefe, die unter dem Namen des Petrus in das Neue Testament eingegangen sind. Diese Texte gestatten nicht die Interpretation, daß Petrus nur als Hauptzeuge des irdischen Wirkens Jesu und als Erstzeuge der Auferstehung Ansehen gewann.
Die wichtigste neutestamentliche Petrusstelle ist das von Matthäus überlieferte Wort Jesu vor Cäsarea Philippi als Antwort auf das Messiasbekenntnis des Petrus:
- "Ich aber sage dir: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt
werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben; was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein." (Mt 16,18-19)
Dieser Text wirft für die Auslegung Fragen auf. Auch wenn ihn viele Schriftausleger im jetzigen Wortlaut nicht dem irdischen Jesus selber zuschreiben, so sind Auftrag und Vollmacht des Petrus, wie wir gesehen haben, doch im Wirken und Sprechen Jesu verankert. Dreierlei wird in diesem Text von Petrus ausgesagt: 1. Petrus selbst und nicht nur der von Petrus bezeugte Glaube ist das Fundament der Kirche. Das Zeugnis des Petrus kann vom Zeugen Petrus nicht abgelöst werden. 2. Die Schlüsselgewalt bedeutet die Vollmacht zur Verwaltung des Hauses Gottes, das die Kirche ist. 3. Die Vollmacht, zu "binden und zu lösen", bedeutet die Vollmacht verbindlicher Lehrentscheidung, verbunden mit der Disziplinargewalt zur Wahrung der Einheit der Kirche.
Offenkundig ist in allen diesen Texten nicht ausdrücklich von einer Nachfolge in den amtlichen Funktionen des Petrus, also von einem Petrusamt in der Kirche, die Rede. An dieser Stelle liegt der entscheidende Kontroverspunkt in der Diskussion mit den nicht römisch-katholischen Kirchen und Kirchengemeinschaften. Doch wenn man davon ausgeht, daß sowohl das Matthäusevangelium wie das Johannesevangelium und die beiden Petrusbriefe nach dem Märtyrertod des Petrus im Jahr 64 in Rom geschrieben sind, hat man einen deutlichen Hinweis darauf, daß die Petrusfunktion auch noch über den Tod des historischen Petrus hinaus von nicht nur historischer, sondern auch von aktueller Bedeutung war. Dazu kommt, daß Mt 16,18 von der Zukunft spricht ("Auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen") und die endzeitlichen Auseinandersetzungen zwischen den Mächten des Todes und der neuen, durch Jesus Christus in die Welt gekommenen Macht des Lebens im Blick hat. So stellt sich die Frage der Fortdauer des petrinischen Amts in der Kirche ähnlich wie bei der Frage der Fortdauer des apostolischen Amtes überhaupt. Es ist bis zur Vollendung der Zeit von aktueller Bedeutung für die Kirche. Es gibt also schon innerhalb des Neuen Testaments Hinweise für eine Fortdauer der Funktion des Petrus als Felsengrund der Kirche und als bleibender Garant des Glaubens (vgl. Lk 22,32).
Da der Apostel Petrus wahrscheinlich im Jahr 64 in Rom den Märtyrertod erlitten hat, kam der römischen Kirche schon sehr früh eine besondere Autorität zu. Schon Ignatius von Antiochien (um 110) nennt sie "Vorsteherin in der Liebe". Die Kirche von Rom war für die anderen Kirchen Vorbild und Kriterium des Glaubens. Sei es, daß man Rom als Entscheidungsinstanz anrief oder daß es selbst die Initiative ergriff, Rom wußte sich in besonderer Weise verantwortlich für die universale Kirche. Eine besondere Autorität des Bischofs von Rom finden wir vom 4. Jahrhundert an; voll ausgeprägt ist die Primatslehre bereits bei Papst Leo dem Großen (5. Jh.). Gehalt und Gestalt der altkirchlichen Primatslehre hatten ihren Schwerpunkt freilich auch schon vor der Kirchentrennung mit dem Osten in der lateinischen Kirche des Westens. Für die orthodoxen Kirchen des Ostens ist der Primatsanspruch des Bischofs von Rom bis heute der entscheidende Grund für die Aufrechterhaltung der Kirchentrennung von 1054. Die Verbreitung des Primats im Westen entsprang freilich nicht in erster Linie römischer Machtgier, sondern der Verantwortung für die Freiheit und Einheit der Kirche. Dieser Vorrang wurde oft mehr von außen an Rom herangetragen, als von Rom selbst gefordert. Einen lehramtlichen Ausdruck fand diese Praxis zunächst durch das zweite Konzil von Lyon (1274) (vgl. DS 861; NR 929) und durch das Konzil von Florenz (1439) (vgl. DS 1307; NR 434). Die Polemik der Reformatoren gegen den Papst als Antichrist sowie die Bedrängnisse, in welche die Kirche durch die Französische Revolution und die Säkularisation kam, trugen zu einer um so stärkeren Herausstellung des päpstlichen Primats bei. Der eigentliche Grund dieser Lehre liegt nach katholischer Auffassung freilich in den Zeugnissen der Offenbarung selbst.
Die Definition des Jurisdiktionsprimats des Papstes und die Unfehlbarkeit des Lehramts des römischen Bischofs geschahen durch das I. Vatikanische Konzil (1869/1870). Bezüglich des Jurisdiktionsprimats lehrt das Konzil:
- "Wer also sagt, der römische Bischof habe nur das Amt einer Aufsicht oder Leitung und nicht die volle und oberste Gewalt der Rechtsbefugnis über die ganze Kirche - und zwar nicht nur in Sachen des Glaubens und der Sitten, sondern auch in dem, was zur Ordnung und Regierung der über den ganzen Erdkreis verbreiteten Kirche gehört -; oder wer sagt, er habe nur einen größeren Anteil, nicht aber die ganze Fülle dieser höchsten Gewalt, oder diese seine Gewalt sei nicht ordentlich und unmittelbar, ebenso über die gesamten und die einzelnen Kirchen wie über die gesamten und einzelnen Hirten und Gläubigen, der sei ausgeschlossen." (DS 3064; NR 448)
Da die Leitung der Kirche vor allem durch die Verkündigung des Wortes Gottes geschieht, hängt der Jurisdiktionsprimat des Papstes eng mit der Lehre von der Unfehlbarkeit seines Amtes zusammen. Die entsprechende Definition lautet:
- "Wenn der römische Bischof in höchster Lehrgewalt (ex cathedra) spricht, das heißt, wenn er seines Amtes als Hirt und Lehrer aller Christen waltend, in höchster, apostolischer Amtsgewalt endgültig entscheidet, eine Lehre über Glauben oder Sitten sei von der ganzen Kirche festzuhalten, so besitzt er aufgrund des göttlichen Beistandes, der ihm im hl. Petrus verheißen ist, jene Unfehlbarkeit, mit der der göttliche Erlöser seine Kirche bei endgültigen Entscheidungen in Glaubens- und Sittenlehren ausgerüstet haben wollte. Diese endgültigen Entscheidungen des römischen Bischofs sind daher aus sich und nicht aufgrund der Zustimmung der Kirche unabänderlich." (DS 3074; NR 454)
Das II. Vatikanische Konzil hat beide Dogmen bestätigt (vgl. LG 18; 23; 25). Aber es hat beide Dogmen auch in den größeren Zusammenhang eingeordnet, in die Verantwortung und Unfehlbarkeit der gesamten Kirche (vgl. LG 12) und besonders in den Zusammenhang des ganzen Kollegiums der Bischöfe (vgl. LG 22-23; 25). Danach hat nicht nur der Papst "volle, höchste und universale Gewalt über die Kirche"; das Kollegium der Bischöfe "ist gemeinsam mit ihrem Haupt, dem Bischof von Rom, und niemals ohne dieses Haupt, gleichfalls Träger der höchsten und vollen Gewalt über die ganze Kirche ... Die höchste Gewalt über die ganze Kirche, die dieses Kollegium besitzt, wird in feierlicher Weise im ökumenischen Konzil ausgeübt... Die gleiche kollegiale Gewalt kann gemeinsam mit dem Papst von den in aller Welt lebenden Bischöfen ausgeübt werden, sofern nur das Haupt des Kollegiums sie zu einer kollegialen Handlung ruft oder wenigstens die gemeinsame Handlung der räumlich getrennten Bischöfe billigt oder frei annimmt, so daß ein eigentlich kollegialer Akt zustande kommt" (LG 22).
Dem Bischof von Rom als Nachfolger des Apostels Petrus kommt also ein besonderer Dienst der Einheit zu. Diesen Primat hat er nicht über der Kirche, sondern in der Kirche als Haupt des Bischofskollegiums. Seine Autorität ist deshalb niemals unbegrenzt und absolut; sie ist vielmehr an die Grundstruktur der Kirche gebunden, d. h. an das Evangelium und die kirchliche Überlieferung, die sakramentale und die bischöfliche Struktur der Kirche. Der Bischof von Rom soll nicht seinen persönlichen Glauben, sondern den Glauben der Kirche verbindlich vertreten; er soll mit seiner Autorität die Autorität und die Verantwortung der Bischöfe nicht verdrängen oder gar ersetzen, sondern diese vielmehr bestärken und verteidigen. Das I. Vatikanische Konzil lehrt deshalb: Das Petrusamt ist von Jesus Christus eingesetzt, damit "der Episkopat selbst einer und ungeteilt sei", um ihm "ein immerwährendes und sichtbares Prinzip und Fundament der Glaubenseinheit und der Gemeinschaft" zu geben (DS 3050; NR 436, vgl. LG 18). So ist das Petrusamt Dienst an der Einheit, die eine Einheit in der Vielheit der Ortskirchen ist. Durch das Petrusamt kann die universale Kirche konkret sprechen und handeln, in ihm findet sie zugleich ihre höchste personale Repräsentanz. Es würde der Kirche und wohl der Christenheit insgesamt etwas fehlen, wenn dieser Petrusdienst nicht da wäre, etwas, das für die Kirche wesentlich ist.
Die beiden Dogmen des I. Vatikanischen Konzils stellen den Abschluß einer langen geschichtlichen Entwicklung auf der Grundlage des Offenbarungszeugnisses der Heiligen Schrift dar. Wie nicht zuletzt das II. Vatikanische Konzil zeigt, ist die Geschichte des Papsttums mit dem I. Vatikanum jedoch nicht zu Ende, sondern zugleich an einen neuen Anfang gekommen.
Vor allem seit dem letzten Konzil erkennt man deutlicher, daß Jesus Christus der Kirche im Petrusamt zwar ein wichtiges Zentrum ihrer Einheit gegeben hat, daß dies aber nicht notwendig einen verwaltungsmäßigen Zentralismus und einen Uniformismus begründet. Man kann und muß vielmehr die wesentlichen und bleibenden Funktionen des Petrusamtes unterscheiden von den viel weitergehenden geschichtlich gewachsenen Funktionen, die der Papst vor allem als Patriarch der lateinischen Kirche innehat. Deshalb könnte eine Wiederaufnahme der vollen Kirchengemeinschaft mit den von Rom getrennten Patriarchaten der Ostkirche diesen in einem weitestgehenden Maß ihre liturgische und disziplinäre Eigenständigkeit belassen, wie das Beispiel der mit Rom unierten Ostkirchen zeigt.
Wir müssen uns freilich bewußt sein, daß im Petrusamt die Wahrheit und die Einheit der Kirche in konkreter Weise zum Ausdruck kommen. Deshalb wird das Petrusamt immer auch ein Zeichen des Widerspruchs sein. Doch dies gehört zum Wesen der Kirche, welche die Fleischwerdung des Wortes Gottes bezeugt. Dieselbe leibhaftige Konkretheit begegnet uns noch unmittelbarer in der Verkündigung und in den Sakramenten der Kirche, denen die kirchlichen Ämter dienend zugeordnet sind. Diesem Thema müssen wir uns nunmehr ausführlich zuwenden. Dabei wird nochmals der Dienstcharakter der Kirche und ihrer Ämter deutlich werden.
III. Gemeinschaft der Heiligen - durch Wort und Sakrament
1. Die Kirche als Gemeinschaft der Heiligen
Das Apostolische Glaubensbekenntnis fügt dem Bekenntnis zur einen heiligen Kirche hinzu: "Ich glaube ... die Gemeinschaft der Heiligen". Diese Aussage, die sich seit dem 4. Jahrhundert im Credo findet, deren Wurzeln aber im Neuen Testament selbst liegen, lenkt unseren Blick nochmals auf das, was in der Kirche wesentlich ist. Sie konfrontiert uns mit der Frage, woraus die Kirche lebt und worum es in ihr geht. Die ursprüngliche Bedeutung dieser Bekenntnisaussage ist nämlich: Die Kirche ist die Gemeinschaft am Heiligen; sie existiert durch die gemeinsame Anteilhabe an den Gütern des Heils, besonders an der Eucharistie. Nach dem Neuen Testament wird die Kirche auferbaut durch die gemeinschaftliche Anteilhabe am Glauben an das Evangelium (vgl. Phlm 6), durch die gemeinschaftliche Feier der Sakramente, besonders durch die Anteilhabe am Leib und Blut Jesu Christi (vgl. 1 Kor 10,16) und durch die Anteilnahme an der Not der Brüder (vgl. Röm 15,26; 2 Kor 8,4; Hebr 13,16). Die Kirche wird also Wirklichkeit durch das Wort des Evangeliums, durch die Sakramente und durch den gemeinsamen Dienst der Liebe. Vor allem ist es die eucharistische Gemeinschaft, welche die über die Erde zerstreute Kirche durch die Teilhabe an dem einen Leib des Herrn zu einer Kirche verbindet.
Durch die gemeinsame Anteilhabe am Heiligen werden wir untereinander zur Gemeinschaft der Heiligen zusammengefügt. Auch diese vor allem spätere Bedeutung will nochmals sagen, worauf es in der Kirche ankommt: Die Kirche ist eine Gemeinschaft (communio). Weil es Ämter in der Kirche gibt, kann man die Kirche auch als hierarchische Gemeinschaft bezeichnen. Der entscheidende Gesichtspunkt des Glaubensbekenntnisses ist jedoch ein anderer. Es geht bei der Gemeinschaft der Heiligen um eine Gemeinschaft, an der alle, das ganze Volk Gottes, teilhaben. Es geht um die Gemeinschaft mit Jesus Christus (vgl. 1 Kor 1,9), um die Gemeinschaft im Heiligen Geist (vgl. Phil 2,1; 2 Kor 13,13). Sie ist eine Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn (vgl. 1 Joh 1,3.6). Sie ist aber auch eine Gemeinschaft im Leiden (vgl. Phil 3,10) wie eine Gemeinschaft im Trost (vgl. 2 Kor 1,5.7) und in der künftigen Herrlichkeit (vgl. 1 Petr 1,4; Hebr 12,22-23). Diese Gemeinschaft ist zugleich Gabe und Aufgabe. Denn nur wenn wir im Licht leben und die Wahrheit tun, haben wir Gemeinschaft miteinander (vgl. 1 Joh 1,7).
Die Gemeinschaft der Heiligen umfaßt Gläubige aller Völker und Zeiten. Denn durch Jesus Christus und im Heiligen Geist werden wir zu einer Gemeinschaft untereinander verbunden, zu der nicht nur die jetzt lebenden Gläubigen, sondern auch die Gerechtfertigten aller Zeiten gehören. Die Gemeinschaft der Heiligen umfaßt darum die Kirche auf der Erde, die Seligen im Himmel und die Verstorbenen im Läuterungszustand. Sie alle bilden den einen Leib Jesu Christi, in dem alle Glieder füreinander vor Gott einstehen. Deshalb verehren wir die Heiligen des Himmels nicht nur als leuchtende Vorbilder des Glaubens; wir rufen sie auch um ihre Fürsprache an (vgl. DS 1821; NR 474). Desgleichen beten wir für die Verstorbenen im Läuterungszustand. Am intensivsten wird unsere Einheit mit der himmlischen Kirche in der Liturgie verwirklicht, wenn wir zusammen mit allen Engeln und Heiligen gemeinsam das Lob von Gottes Herrlichkeit und das Werk seiner Erlösung feiern (vgl. SC 104; LG 50-51). "Die Gemeinschaft der Heiligen ist das Gegengift und Gegengewicht zur babylonischen Zerstreuung; sie bezeugt eine so wunderbare menschliche und göttliche Solidarität, daß es einem menschlichen Wesen unmöglich ist, nicht auf alle übrigen zu antworten, zu welcher Zeit sie auch leben und wohin sie zu leben auch gerufen sein mögen. Der geringste unserer Akte widerhallt in unendliche Tiefen hinein und läßt alle Lebendigen und Toten erbeben" (L. Bloy). In besonderer Weise gedenken wir dieser Gemeinschaft der Heiligen am Fest Allerheiligen (1. November) und am Gedenktag Allerseelen (2. November).
Die ältere und die spätere Deutung des Bekenntnisses zur Gemeinschaft der Heiligen lassen sich also leicht miteinander verbinden. Da von der vornehmlich späteren Deutung der Sache nach bereits ausführlich die Rede war, als wir von der Kirche als Volk Gottes, Leib Christi und Tempel des Heiligen Geistes gesprochen haben, konzentrieren wir uns jetzt auf den ursprünglichen Sinn dieser Aussage. In diesem ursprünglichen Sinn stellt sie nicht nur eine Näherbestimmung des Bekenntnisses zur Kirche dar; sie führt dieses Bekenntnis vielmehr zugleich weiter, indem sie uns sagt, wodurch die Kirche konkret zum Volk Gottes, zum Leib Christi und zum Tempel des Heiligen Geistes wird und wie sie konkret die Gemeinschaft mit dem Vater durch Jesus Christus im Heiligen Geist erlangt. Sie sagt uns: Die Kirche als Gemeinschaft der Heiligen wird auferbaut und sie verwirklicht sich immer wieder neu durch die Gemeinschaft am Heiligen: durch die Verkündigung des Evangeliums, durch die Feier der Sakramente, besonders der Eucharistie, und durch den Dienst der Liebe.
2. Das Wort als hörbares Sakrament
2.1 Die Heilsbedeutung des Wortes
Im allgemeinen Verständnis wird das Wort häufig nur als Mittel des Gedankenaustausches, der Information oder der Belehrung angesehen. In der Wortflut unserer Zeit sind wir oft der vielen Worte müde und dem Wort gegenüber abgestumpft. Worte, denen keine Taten entsprechen, gelten als hohl und leer, ja als unehrlich und unwahrhaftig. Aber wir erfahren oft auch, was das rechte Wort zur rechten Zeit für uns und für andere bedeuten, wie es die Situation erhellen und verändern kann. Wir alle sind auf solche Worte der Anerkennung, des Trostes, des Vertrauens, der Ermutigung, der Freundschaft und der Liebe angewiesen. Oft kann uns ein einziges Wort eine ganze Welt erschließen. Vor allem die Innenwelt des andern, die Tiefe seiner Person ist uns in erster Linie durch sein Wort zugänglich. Im Wort teilen Menschen einander nicht nur etwas mit, im Wort teilen sie sich selber mit. So kann schon das menschliche Wort einen tätigen und wirksamen Charakter haben.
Das gilt in unvergleichlich höherem Maße vom Wort Gottes. Schon das Alte Testament sieht im Wort Gottes eine schöpferische Macht, die alle Dinge ins Sein rief (vgl. Gen 1,3-2,4a) und sie im Sein erhält (vgl. Ps 147,15-18). In höchster Weise wohnt die schöpferische Kraft des Wortes Gottes im personalen "Wort", dem Sohn Gottes. "Durch ihn ist alles geworden, und ohne ihn wurde nichts, was geworden ist" (Joh 1,3). In der Heilsgeschichte offenbart Gott durch sein Wort nicht nur, wer er ist, sondern auch, was er in Gnade für uns tut, ja, in seinem Wort handelt er heilshaft auf uns hin und an uns. So hat auch das heilsgeschichtliche Wort Gottes Tatcharakter; es bewirkt, was es sagt. Denn in seinem Wort ist Gott selbst lebendig gegenwärtig, Heil schaffend und richtend, begnadigend und zur Entscheidung und Tat herausfordernd. In seinem Wort begegnet uns Gott selbst in seiner heilschaffenden Macht. Dieser Tatcharakter des Wortes Gottes kommt an vielen Stellen der Heiligen Schrift zum Ausdruck:
- "Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt und sie zum Keimen und Sprossen bringt, wie er dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen, so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verläßt: Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will..."(Jes 55,10-11)
- "Denn lebendig ist das Wort Gottes, kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert; es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenk und Mark; es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens; vor ihm bleibt kein Geschöpf verborgen, sondern alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft schulden." (Hehr 4,12-13)
Im Neuen Testament erhält der tathaft-heilswirksame Charakter des Wortes Gottes die höchste Steigerung dadurch, daß Jesus Christus als das ewige, in der Zeit Fleisch gewordene Wort Gottes bezeugt wird. "In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen" (Joh 1,4); "aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade" (Joh 1,16). In Jesus Christus ist Gottes Wort nicht nur hörbar, sondern auch sichtbar geworden. In der Lesung und Verkündigung seines Wortes ist er in tätiger und heilswirksamer Weise bleibend in der Kirche gegenwärtig (vgl. SC 7).
Weil in Jesus Christus Gottes Wort unüberbietbar, endgültig und ganz ergangen ist, bleibt es fortan in der Kraft des Heiligen Geistes in der Kirche präsent. Der Geist der Wahrheit, der die Worte Jesu bezeugt und erschließt, wird bei den Jüngern bleiben und in ihnen sein (vgl. Joh 14,17.26). Die Kirche hat von Jesus Christus den Auftrag, das ein für allemal ergangene Wort Gottes treu zu bewahren, immer tiefer in es einzudringen, um es lebendig allen Menschen zu verkünden und auszulegen. Die Kirche beansprucht deshalb das Recht, das Wort Gottes unabhängig von jeglicher menschlichen Macht immer und überall allen Völkern zu verkünden. Das Zeugnis des Wortes Gottes ist grundsätzlich allen Christen aufgetragen. In ausgezeichneter Weise sind die Apostel und diejenigen, die mit und nach ihnen mit der Aufgabe der Verkündigung betraut sind, gesandt, das Evangelium allen Völkern zu verkünden (vgl. Mt 28,19-20; Mk 16,15). Der Heilige Geist wird sie dabei an alles erinnern, was Jesus gesagt und getan hat, und sie in die ganze Wahrheit führen (vgl. Joh 14,26; 16,13-14).
Aufgrund der wirksamen Gegenwart Jesu Christi im Heiligen Geist ist die Verkündigung des Wortes Gottes nicht nur ein Wort über Gott, sondern Wort "von Gott her und vor Gott" (2 Kor 2,17). Es ist nicht Menschen-, sondern Gotteswort (vgl. 1 Thess 2,13), "Gottes Kraft und Gottes Weisheit" (1 Kor 1,24), Wort des Heils (vgl. Apg 13,26) und der Gnade (vgl. Apg 14,3). Durch dieses Wort werden wir zum neuen Leben geboren (vgl. Jak 1,18; 1 Petr 1,23). So versteht sich der Apostel Paulus als Gesandter an "Christi Statt, und Gott ist es, der durch uns mahnt" (2 Kor 5,20). In der Verkündigung des Wortes Gottes ist also Gott selbst in der Welt präsent durch Jesus Christus im Heiligen Geist.
Das katholische Glaubensbewußtsein hat immer an der Heilsund Gnadenhaftigkeit des Wortes Gottes festgehalten. In der Liturgie wurde immer die Gegenwart Jesu Christi im Wort gefeiert. Man sprach von dem zweifachen Tisch, dem Tisch des Wortes und dem Tisch des Leibes Christi (vgl. DV 21, PO 18). Der heilige Augustinus bezeichnete das Wort als hörbares Sakrament. Zu ihrer vollen Bedeutung gelangte diese Überzeugung freilich erst in neuerer Zeit. Anregungen durch die reformatorischen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften trugen mit dazu bei. Das II. Vatikanische Konzil brachte die Überzeugung von der Bedeutung des Wortes Gottes klar zum Ausdruck (vgl. LG 9; DV 1-10; 21-26; AG 9, 15). Papst Paul VI. sagte in seinem Apostolischen Schreiben über die Evangelisierung in der Welt von heute (1975):
- "Evangelisieren ist in der Tat die Gnade und eigentliche Berufung der Kirche, ihre tiefste Identität. Sie ist da, um zu evangelisieren, d.h. um zu predigen und zu unterweisen..." (EN 14)
Es besteht eine mehrfache wechselseitige Beziehung zwischen Kirche und Verkündigung. Die Kirche entsteht aus der Verkündigung des Evangeliums; sie ist deren unmittelbares sichtbares Ergebnis. Die Kirche ist ihrerseits aber auch gesandt zum Dienst der Verkündigung. Als Trägerin der Evangeliumsverkündigung beginnt sie damit, sich selbst zu evangelisieren. "Als Gemeinschaft von Gläubigen, als Gemeinschaft gelebter und gepredigter Hoffnung, als Gemeinschaft brüderlicher Liebe muß die Kirche unablässig selbst vernehmen, was sie glauben muß, welches die Gründe ihrer Hoffnung sind und was das neue Gebot der Liebe ist" (EN 15). Die Kirche ist ferner Hüterin der Frohbotschaft, die es zu verkündigen gilt. Schließlich entsendet die Kirche, die selber gesandt und für das Evangelium gewonnen ist, wiederum Glaubensboten. "Sie sollen nicht ihre eigene Person oder ihre persönlichen Ideen predigen, sondern ein Evangelium", für das sie in Dienst genommen sind (EN 15).
Wenn Menschen das Evangelium des Heils verkünden, so geschieht dies im Auftrag, im Namen und mit der Gnade Jesu Christi. "Wie soll aber jemand verkündigen, wenn er nicht gesandt ist?" (Röm 10,15). Diese Sendung kommt grundsätzlich der Kirche insgesamt und allen Christen zu. Die ganze Kirche ist missionarisch, und das Werk der Evangelisierung ist eine Grundpflicht des Gottesvolkes (vgl. AG 35). Sie kommt in hervorragender Weise den Bischöfen, Priestern und Diakonen zu und ist deren erste und vornehmste Aufgabe. Das bedeutet, daß die Verkündigung des Evangeliums niemals das individuelle und isolierte Tun eines einzelnen ist, es ist vielmehr ein zutiefst kirchliches Tun. Wenn aber jemand das Evangelium im Namen der Kirche verkündet, die es ihrerseits im Auftrag des Herrn tut, dann ist kein Verkünder des Evangeliums absoluter Herr seiner Glaubensverkündigung, so daß er darüber selbst nach seinen persönlichen Maßstäben und Ansichten entscheiden könnte. Er muß es vielmehr in Gemeinschaft mit der Kirche und ihren Hirten tun (vgl. EN 60).
Die Bezeugung des Wortes Gottes bzw. des Evangeliums geschieht im einzelnen auf sehr vielfältige Weise: durch Predigt, Katechese, liturgisch-sakramentale Zeichen, durch Bücher und Zeitschriften, Bilder und künstlerische Gestaltungen, durch die Massenmedien und nicht zuletzt durch das einfache und spontane alltägliche Zeugnis in Wort und Tat, durch das Zeugnis des Lebens. Die dichteste Form der Verkündigung ist die Homilie; sie stellt einen Teil der Liturgie dar (vgl. SC 35) und ist deshalb den Bischöfen, Priestern und Diakonen vorbehalten. Andere Formen der Predigt sind, wenn es notwendig ist und angeraten erscheint, mit besonderer Beauftragung durch den Bischof auch Laien möglich.
Die Verkündigung muß die ein für allemal ergangene Botschaft des Evangeliums jeweils neu in die Sprache der Zeit übersetzen und auf die Fragen und Schwierigkeiten der Menschen ausrichten. So hat die Verkündigung immer eine dialogische Struktur. Der Mensch ist zwar nicht das Maß der Verkündigung, wohl aber deren Adressat. Auch gehören die fundamentalen Menschenrechte, die Würde und die Freiheit der menschlichen Person, die Gerechtigkeit in der menschlichen Gesellschaft, Wert und Wesen der Familie u. a. zur Verkündigungsaufgabe der Kirche. Schließlich muß sich die Verkündigung aller Mittel, die einer bestimmten Zeit zur Verfügung stehen (Schulen, Akademien, Massenkommunikationsmittel u. a.), bedienen (vgl. CD 12-14; PO 4). Das über alles Entscheidende ist jedoch, daß wir nichts anderes verkünden als Jesus Christus und diesen als den Gekreuzigten (vgl. 1 Kor 2,2).
2.2 Lehre und Lehramt der Kirche
Das Wort Gottes wird uns schon im Neuen Testament auch in Gestalt der Lehre bezeugt (vgl. Röm 6,17; 2 Tim 4,2; Tit 1,9). Schon im Neuen Testament finden wir feste Lehr- und Bekenntnisformeln. Die Verantwortung für die rechte Lehre wird vor allem denen anvertraut, die in der Nachfolge der Apostel die Leitung der Kirche innehaben:
- "Achte auf dich selbst und auf die Lehre; halte daran fest! Wenn du das tust, rettest du dich und alle, die auf dich hören." (1 Tim 4,16)
- "Halte dich an die gesunde Lehre, die du von mir gehört hast; nimm sie dir zum Vorbild; und bleibe beim Glauben und bei der Liebe, die uns in Christus Jesus geschenkt ist. Bewahre das dir anvertraute kostbare Gut durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wohnt." (2 Tim 1,13-14)
- "Ich beschwöre dich bei Gott und bei Christus Jesus, dem kommenden Richter der Lebenden und der Toten, bei seinem Erscheinen und bei seinem Reich: Verkünde das Wort, tritt dafür ein, ob man es hören will oder nicht; weise zurecht, tadle, ermahne in unermüdlicher und geduldiger Belehrung." (2 Tim 4,1-2)
Aus solchen Aussagen des Neuen Testaments hat sich die katholische Lehre und Praxis des Lehramtes entwickelt. Die Aufgabe des lebendigen Lehramts in der Kirche ist es, das Wort Gottes verbindlich zu erklären. Deshalb steht das Lehramt "nicht über dem Wort Gottes, sondern dient ihm, indem es nichts lehrt, als was überliefert ist" (DV 10). Aufgabe des Lehramts ist es, "zugleich auch die Prinzipien der sittlichen Ordnung, die aus dem Wesen des Menschen selbst hervorgehen, autoritativ zu erklären und zu bestätigen" (DH 14). Dieses Lehramt kommt allein den Bischöfen in Gemeinschaft mit dem Papst zu. Es kann in doppelter Weise ausgeübt werden: in ordentlicher Weise (ordentliches Lehramt), wenn die Bischöfe in Gemeinschaft mit dem Bischof von Rom, obwohl in der Welt räumlich getrennt, jedoch im Glauben und in ihrer Sendung eins, den Glauben einmütig verkünden, in außerordentlicher Weise (außerordentliches Lehramt), wenn die Bischöfe auf einem ökumenischen Konzil vereint als Lehrer und Richter in Fragen des Glaubens und der Sitten sprechen oder wenn der Bischof von Rom, als Haupt des Bischofskollegiums, kraft seines Amtes als oberster Hirt und Lehrer aller Christgläubigen eine Glaubens- oder Sittenlehre in einem endgültigen Akt verkündet (vgl. LG 25).
- "Mit göttlichem und katholischem Glauben ist also all das zu glauben, was im geschriebenen oder überlieferten Wort Gottes enthalten ist und von der Kirche in feierlichem Entscheid oder durch gewöhnliche und allgemeine Lehrverkündigung als von Gott geoffenbart zu glauben vorgelegt wird." (DS 3011; NR 34)
Bei den Kontroversen, in denen die Einheit des Glaubens in der Kirche in Gefahr ist, haben die Bischöfe Recht und Pflicht zur verbindlichen Entscheidung. Wo die Bischöfe in universaler Übereinstimmung untereinander und in Gemeinschaft mit dem Bischof von Rom den Offenbarungsglauben als endgültig verpflichtend vortragen, kommt ihrem Zeugnis Letztverbindlichkeit und Unfehlbarkeit zu. Unfehlbar ist also nicht der einzelne Bischof, sondern nur das gesamte Bischofskollegium in Gemeinschaft mit dem Bischof von Rom bzw. der Bischof von Rom als Haupt des Bischofskollegiums.
Das Wort Unfehlbarkeit ist sprachlich nicht ganz eindeutig; es löst fast unwillkürlich Vorstellungen von Makellosigkeit, Vollkommenheit in jeder Hinsicht oder gar von Sündlosigkeit aus. Fehlen aber ist menschlich, so sagt man, und auch der Papst und die Bischöfe sind als Menschen davon nicht ausgenommen. Deshalb versucht man seit längerem, das mißverständliche und für manche gar anstößige Wort unfehlbar durch andere zu ersetzen. Man spricht von Unverirrlichkeit, Untrüglichkeit, Irrtumsfreiheit. Der Sache nach geht es darum, daß mit Jesus Christus die Wahrheit Gottes geschichtlich unüberbietbar und endgültig in die Welt gekommen ist und daß sie der Kirche aufgrund der bleibenden Gegenwart des Herrn und seines Geistes für immer verheißen ist. Als Kirche des lebendigen Gottes ist sie Säule und Grundfeste der Wahrheit (vgl. 1 Tim 3,15). Deshalb ist es Grundüberzeugung aller christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, daß die Kirche nie endgültig aus der Wahrheit Jesu Christi herausfallen kann, wäre dies der Fall, dann hätte die Lüge über Gott und seine Wahrheit gesiegt. Nach katholischer Überzeugung wäre diese Verheißung freilich irgendwie vage, gäbe es keinen konkreten Mund dieser Wahrheit, so daß sie in bestimmten verbindlichen Glaubensaussagen konkret werden kann. Gerade im Streitfall oder im Fall einer anstehenden Entscheidung ist es notwendig, daß die Kirche ihren Gläubigen die Gewißheit gibt, daß, wer sich auf ihr Wort einläßt, sich auf die Wahrheit selbst einläßt. Anders wäre die Kirche in Gefahr, zu einem bloßen Diskussionsforum zu werden und nicht mehr die Gemeinschaft der Zeugen zu sein, die mit letztem Ernst für die Wahrheit des Glaubens eintritt. Die katholische Kirche ist überzeugt, daß ihr im Petrusamt als Haupt des Bischofskollegiums bzw. im Bischofskollegium in Gemeinschaft mit dem und in Unterordnung unter das Petrusamt dieser Hort und dieser Mund der Wahrheit gegeben sind.
Diese Glaubensüberzeugung will freilich im größeren Zusammenhang richtig verstanden werden. Drei Punkte sind von Bedeutung:
1. Unfehlbar im eigentlichen Sinn des Wortes ist allein Gott und sein Wort. Die Kirche und das kirchliche Lehramt sind untrüglich allein in der vom Heiligen Geist geleiteten Auslegung des ein für allemal gegebenen Wortes Gottes und der damit notwendig zusammenhängenden Wahrheiten. Die Unfehlbarkeit der Kirche reicht deshalb so weit, wie die Offenbarung Gottes es erfordert; sie bezieht sich nur auf Glaubens- und Sittenfragen, nicht aber etwa auf politische, naturwissenschaftliche und ähnliche Fragen (vgl. LG 25).
2. Das Lehramt steht im Zusammenhang der Unfehlbarkeit der gesamten Kirche (vgl. LG 12). Es hat seine Vollmacht zwar nicht durch "Delegation von unten", aber es ist auf den Glauben der Kirche verwiesen, nicht nur sofern dieser Ziel der Entscheidung, sondern auch sofern dieser Maßstab für sie ist. Bei der Feststellung des Glaubens der Kirche muß das Lehramt alle menschlichen Mittel der Wahrheitsfindung anwenden. Der Beistand des Geistes bewahrt es vor Irrtum, aber es ist ihm keine positive Inspiration oder gar eine neue Offenbarung verheißen. Wenn das Dogma deshalb formuliert, solche Entscheidungen des römischen Bischofs seien "aus sich und nicht aufgrund der Zustimmung der Kirche" unwiderruflich (DS 3074; NR 454), dann bedeutet dies nicht, der Papst könne sich vom Glauben der Kirche lösen; gemeint ist lediglich, daß seine Entscheidungen nicht nachträglich etwa durch ein allgemeines Konzil rechtlich ratifiziert werden müssen. Der Papst ist sich bei solchen Entscheidungen sozusagen der Zustimmung der Kirche gewiß. Das schließt nicht aus, daß solche Entscheidungen faktisch umfassender Rezeption bedürfen, damit sie in der Kirche Lebenskraft und geistliche Fruchtbarkeit erlangen.
3. Die Ausübung des Lehramts geschieht nur in relativ seltenen und außerordentlichen Fällen auf dem Weg einer unfehlbaren Lehrentscheidung. Der Papst oder ein Konzil müssen eigens zu erkennen geben, wenn sie eine solche Entscheidung treffen; wer behauptet, es liege eine solche Entscheidung vor, muß dies im Einzelfall beweisen. Im Normalfall ist die Unfehlbarkeit und Irrtumslosigkeit des Lehramtes "eingebettet" in das alltägliche Leben und Verkünden der Kirche, in ihr Gebet, den Gottesdienst, die Spendung der Sakramente und in die brüderliche Hilfe (vgl. LG 25). So wurden etwa die zentralen und fundamentalen christlichen Wahrheiten des Apostolischen Glaubensbekenntnisses nie formell definiert, aber immer geglaubt und gelehrt, was diesem Bekenntnis auch ohne formelle Definition eine unumstößliche Autorität in der Kirche verleiht.
Die Bischöfe und der Papst sind auch dann authentische Zeugen und Lehrer der Wahrheit des Evangeliums, wenn sie nicht mit letzter Verbindlichkeit und unfehlbar sprechen. Deshalb müssen die Gläubigen mit einem im Namen Christi vorgetragenen Spruch ihres Bischofs und erst recht des Bischofs von Rom in Glaubens- und Sittensachen übereinkommen und ihm mit religiös gegründetem Gehorsam anhangen (vgl. LG 25).
Die Bischöfe können ihre lehramtliche Aufgabe nur in Gemeinschaft mit der gesamten Kirche erfüllen. Denn das ganze Gottesvolk nimmt an dem prophetischen Amt Christi teil; die Gesamtheit der Gläubigen empfängt vom Heiligen Geist den übernatürlichen Glaubenssinn (vgl. LG 12). In besonderer Weise nehmen die Priester am prophetischen Amt Christi teil; sie sind Mitarbeiter am Verkündigungs- und Lehramt der Bischöfe (vgl. PO 4). Ferner bedürfen die Bischöfe, zumal heute, zur Ausübung ihres Auftrags der Zusammenarbeit mit den Theologen. Diese sollen den Glauben der Kirche wissenschaftlich durchdringen, indem sie ihn vom Zeugnis der Heiligen Schrift und der kirchlichen Überlieferung her interpretieren und dem Verstehen der Zeit zugänglich machen. Die Theologie steht also auf der Grundlage und unter der Norm der kirchlichen Lehre. Sie bedarf aber zur Verwirklichung ihres besonderen Auftrags eines angemessenen Raumes der Freiheit in der Kirche; man kann sogar von einer wissenschaftlichen Eigenständigkeit sprechen (vgl. CIC can. 809). Die Ausübung des bischöflichen Lehramtes geschieht also in vielfältigem Austausch des Glaubens mit den Gläubigen, den Priestern und den Theologen. Es steht nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem liturgisch-sakramentalen Leben der Kirche.
3. Die Sakramente als sichtbares Wort
3.1 Die Sakramente als Zeichen des Glaubens
Wir Menschen existieren in Leib und Seele. Der Leib wird von der Geistseele durchlebt und durchformt, und die Seele drückt sich im Leib aus. Deshalb gehört es zum Wesen des Menschen, daß er seine inneren Überzeugungen, sittlichen Grundhaltungen, seine Stimmungen und Gefühle leibhaftig zum Ausdruck bringt in Worten, Bildern, Symbolen, Handlungen. Da Gott ein Gott der Menschen ist, schenkt er uns sein Leben und seine Liebe in dieser leib-seelischen Ganzheit. Er spricht zu uns und handelt an uns durch sein Wort und durch geschichtliche Taten (vgl. DV 2). Auch der Glaube, mit dem wir Gott antworten, ist nicht nur eine innere Überzeugung oder eine Angelegenheit des Herzens; er drückt sich nicht nur in Worten aus, sondern auch in Bildern und Symbolen, in Handlungen und in Riten, in Liedern und in anderen künstlerischen Gestaltungen.
Die Sakramente sind solche sinnenhaften Gestalten der Gnade und der Liebe Gottes. Sie sind, wie der heilige Augustinus lehrt, sichtbar gewordenes Wort. Auf der anderen Seite sind sie, wie uns der heilige Thomas von Aquin sagt, auch Zeichen, mit denen wir unseren Glauben bekennen. Das II. Vatikanische Konzil sagt von den Sakramenten, daß sie den Glauben nicht nur voraussetzen, sondern ihn auch nähren, stärken und anzeigen; "deshalb heißen sie Sakramente des Glaubens" (SC 59).
Das Verhältnis von Glaube und Sakrament ist heute eines der Hauptprobleme der gesamten Pastoral. Denn in unseren Gemeinden haben wir es nicht selten mit Getauften zu tun, die, soweit man das beurteilen kann, Nicht-Glaubende sind. Das ganze Gefüge der Sakramente, besonders das Verhältnis von Glaube und Sakramenten gerät damit aus den Fugen. Dieses Problem spitzt sich außer bei der Säuglingstaufe vor allem bei der Erst-Beichte, Erst-Kommunion, Firmung und vor allem bei der Ehe zu. Kann man Nicht-Glaubenden die Sakramente spenden? Ohne ein Minimum von innerer Offenheit für den Glauben ist ein gültiger und erst recht ein fruchtbringender Sakramentenempfang nicht möglich. Die pastorale Aufgabe besteht vor allem darin, den schwachen Glauben zu stärken. Von daher verbieten sich Rigorismus und Laxismus in gleicher Weise. Das zeigt nochmals die Wichtigkeit einer lebendigen Gemeindekatechese, besonders einer gründlichen Sakramentenvorbereitung.
Weil die Sakramente sichtbar gewordenes Wort sind, gehören zu jedem sakramentalen Zeichen zwei Bestandteile, die eine innere Einheit bilden: das sakramentale Wort und das sakramentale Zeichen im engeren Sinn. Entsprechend sagt der Epheserbrief von der Taufe, Jesus Christus habe sich für die Kirche hingegeben, "um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen" (Eph 5,26). Was damit angedeutet ist, brachte der heilige Augustinus auf die prägnante Formel: "Es tritt das Wort zum Element, und es entsteht das Sakrament." Bei der sakramentalen Handlung im engeren Sinn wird wiederum ein Wort gesprochen, etwa bei der Taufe: "Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes", oder bei der Eucharistie die Einsetzungsworte Jesu. Dieses sakramentale Wort gilt sogar als die Seele des Sakraments (sogenannte Form des Sakraments). Das sakramentale Zeichen im engeren Sinn besteht nicht allein in einem körperlichen Element wie Wasser, Brot, Wein, Öl, sondern in einer Handlung: Abwaschen mit Wasser, Essen des Brotes, Salben mit Öl, manchmal nur in einer Handlung: Akte der Buße beim Bußsakrament, Ja-Wort bei der Ehe (sogenannte Materie des Sakraments). Diese Zusammengehörigkeit von Wort und Sakrament kommt auch dadurch zum Ausdruck, daß zur sakramentalen Feier außer im Notfall ein Wortgottesdienst gehört: liturgische Begrüßung, Lesung aus der Heiligen Schrift, Gesang, Gebet, Segen und liturgische Entlassung.
Betrachtet man die Struktur des sakramentalen Zeichens etwas tiefer, dann wird deutlich, daß sakramentale Handlungen menschliche Grundsituationen (Anfang eines neuen Lebens, Mahl, Krise durch schwere Schuld u. a.) aufnehmen und sie symbolisch darstellen. Dabei handelt es sich um Situationen, in denen der Mensch schon natürlicherweise nach Sinn, Leben, Heil fragt. Durch das Sakrament werden diese menschlichen Grundsituationen geheiligt; sie werden in das Geheimnis Jesu Christi, in sein Leben und Sterben, seine Auferstehung und Erhöhung hineingenommen, so daß wir daran Anteil erhalten. Die Sakramente begleiten also unser ganzes Leben in allen seinen wichtigen Situationen und Stationen. Sie sind als Glaubenszeichen zugleich Christuszeichen, durch die Jesus Christus in unserem Leben konkret und menschlich ganzheitlich Gestalt gewinnen will.
3.2 Die Sakramente als Christuszeichen
Das Sakrament Gottes für die Menschen, in dem die Gnade Gottes in ihrer ganzen Fülle erschienen ist, ist Jesus Christus. Jesus Christus ist darum das Ursakrament, von dem alle einzelnen Sakramente Ausfaltungen und Konkretisierungen sind. Die Kirche weiß sich wie der Apostel Paulus nur als Dienerin Jesu Christi und als Verwalterin von Gottes Geheimnissen (vgl. 1 Kor 4,1). Sie kann darum Sakramente nicht in eigener Vollmacht einsetzen. Die Einsetzung der Sakramente kann nur auf Jesus Christus, den einen Mittler zwischen Gott und den Menschen (vgl. 1 Tim 2,5), zurückgehen. Deshalb ist es verbindliche Lehre der Kirche: Alle Sakramente des Neuen Bundes sind durch Jesus Christus eingesetzt worden. (Vgl. DS 1601; NR 506)
Mit dieser Lehre ist nicht gemeint, daß Jesus während seines irdischen Lebens alle Sakramente ausdrücklich eingesetzt hat, wie dies etwa von der Eucharistie gilt. Die ausdrückliche Einsetzung kann auch durch den erhöhten Herrn geschehen, wie etwa bei der Taufe. Wir brauchen auch nicht in jedem Fall an ein ausdrückliches Stiftungswort oder einen ausdrücklichen Stiftungsakt Jesu zu denken. Wenn die Kirche dennoch davon ausgeht, daß alle Sakramente der Intention Jesu Christi entsprechen, dann deshalb, weil Jesus Christus durch den Heiligen Geist bleibend in der Kirche gegenwärtig ist, um sein ein für allemal geschehenes Heilswerk auszulegen und zu vergegenwärtigen. So dürfen wir von vornherein gar nicht erwarten, daß Jesus Christus selbst schon alle Einzelheiten des Ritus festgelegt hat, es genügt, wenn die Sakramente ihrem allgemeinen Wesen nach im Ganzen des Heilswerkes Jesu Christi grundgelegt sind.
Das von Jesus Christus Grundgelegte bedarf also der Auslegung in der apostolischen Überlieferung, die in der Kirche lebendig erhalten und vergegenwärtigt wird. So gilt von der Einsetzung der Sakramente durch Jesus Christus, was von der ganzen Verkündigung und vom gesamten Heilswerk Jesu Christi gilt, daß sie uns nämlich nur im Zeugnis der Kirche faßbar sind. Deshalb stellt es keinerlei Verlegenheit, sondern im Grunde etwas der Sache Gemäßes dar, wenn die Kirche die einzelnen Sakramente zwar von Anfang an vollzogen, aber erst im Lauf der Geschichte ausdrücklich als solche erkannt und von anderen Riten klar unterschieden hat. Daraus folgt, daß die Kirche das Wesen der Sakramente nicht verändern darf; sie kann und muß aber die liturgische Gestalt der Sakramente ausgestalten und dem Verständnis der jeweiligen Zeit und Kultur anpassen (vgl. DS 1728; NR 519; SC 62).
Das Gesagte ist vor allem für die Siebenzahl der Sakramente von Bedeutung. Zwar gehören alle sieben Sakramente seit unvordenklichen Zeiten zum Leben der Kirche. Auch die orthodoxen Kirchen stimmen in dieser Praxis mit der katholischen Kirche überein. Aber eine ausdrückliche Zusammenfassung und eine entsprechende Lehre von der Siebenzahl der Sakramente finden wir erst im 12. Jahrhundert. Seither ist es ausdrückliche Lehre der Kirche:
- Es gibt in der Kirche Jesu Christi sieben von Jesus Christus eingesetzte Sakramente: Taufe, Firmung, Eucharistie, Buße, Krankensalbung, Sakrament der Weihe und der Ehe. (Vgl. DS 860; 1310; 1601; Nr 928; 501; 506)
Diese Aufzählung darf nicht rein quantitativ verstanden werden. Die sieben Sakramente bilden eine organische Einheit, in deren Mitte Taufe und Eucharistie stehen. Die kirchliche Überlieferung unterscheidet deshalb zwischen den beiden "großen Sakramenten": Taufe und Eucharistie und den "kleinen Sakramenten", die auf die Vollendung (Firmung) oder Wiederherstellung (Buße, Krankensalbung) des durch die Taufe begründeten und auf die Eucharistie hingeordneten neuen Lebens in Jesus Christus hinzielen oder der natürlichen und gnadenhaften Auferbauung des Volkes Gottes dienen, das in der Eucharistie seinen Mittelpunkt hat (Weihe, Ehe).
Die Frage der Einsetzung und der Zahl der Sakramente gehört zu den klassischen Themen der konfessionellen Unterscheidung zwischen der katholischen und der protestantischen Lehre. Im Unterschied zur katholischen Kirche kennen die Reformatoren nur zwei Sakramente (Taufe und Abendmahl), manchmal auch drei Sakramente (Taufe, Abendmahl und Buße). Dabei spielt für die Reformatoren u. a. die Frage eines ausdrücklichen Einsetzungswortes Jesu eine entscheidende Rolle. Durch die moderne neutestamentliche Forschung ist jedoch deutlicher geworden, daß man nicht so scharf trennen kann zwischen dem Wort Jesu und dem Zeugnis der Urgemeinde; gerade bei den Sakramenten spielt die apostolische und die nachapostolische Überlieferung eine wichtige Rolle. Durch diese Einsichten hat sich das Problem der Einsetzung der Sakramente entschärft. Zur Frage der Einsetzung durch Jesus Christus kommt die unterschiedliche Bestimmung des Sakramentsbegriffs. Das hat zur Folge, daß die evangelischen Kirchen manche der Handlungen, die in der katholischen Kirche als Sakramente gelten, als Segenshandlungen betrachten (z. B. Konfirmation, Trauung, Ordination, Krankensegnung). Heute besinnt man sich gemeinsam darauf zurück, daß Jesus Christus das eine Ursakrament ist, das im Wort der Verkündigung und in den verschiedenen Sakramenten und Segenshandlungen der Kirche entfaltet und den Menschen nahegebracht wird. Auch diese Einsicht hat zu einer Annäherung der Standpunkte geführt. Es ist jedoch über viele dieser wichtigen Fragen bislang ökumenisch noch kaum diskutiert worden (vgl. Evangelischer Erwachsenenkatechismus, S. 1124-1125).
Der Christusbezug der Sakramente beschränkt sich nicht auf die Einsetzung am Anfang. Der erhöhte Herr ist uns in den Sakramenten und durch sie bleibend nahe mit seiner Gnade, seinem Erbarmen, seiner Versöhnung und seinem neuen Leben. Jesus Christus ist der eigentliche Spender der Sakramente. Jesus Christus also ist es, wie wiederum der heilige Augustinus lehrt, der tauft, der konsekriert und der die Sünden vergibt (vgl. SC 7). So begegnen wir in den sakramentalen Symbolen Jesus Christus selbst, die Sakramente sind personale Christusbegegnung. Der heilige Papst Leo der Große sagt uns: "Was an Christus sichtbar war, ist übergegangen in die Sakramente."
Indem Jesus Christus selbst heilschaffend in den Sakramenten gegenwärtig ist, macht er auch sein Heilswerk, besonders seinen Tod und seine Auferstehung, aus deren Kraft allein wir Gnade und Heil erlangen, gegenwärtig. Durch die Sakramente werden wir also hineingenommen in das Pascha-Mysterium Christi (vgl. SC 6). Der heilige Thomas von Aquin hat dargelegt, daß diese Hineinnahme in das Geheimnis Jesu Christi und seines Heilswerkes eine dreifache Dimension besitzt. Erstens: Die Sakramente sind Erinnerungszeichen an das ein für allemal geschehene Werk unserer Erlösung. Dabei meint Erinnerung im Sinn der Heiligen Schrift nicht nur ein subjektives Daran-denken, sondern ein erinnerndes Gegenwärtig-setzen. So kann die Liturgie in den Fest-Antiphonen singen: "Heute ist Christus geboren", "Heute führte der Stern die Weisen zum Kind in der Krippe", "Heute erschien der Heilige Geist den Jüngern im Zeichen des Feuers". Als Erinnerungszeichen sind die Sakramente zweitens Heilszeichen, die uns das gegenwärtige Heil anzeigen und schenken. In der Liturgie, besonders in der Eucharistie, vollzieht sich das Werk unserer Erlösung (vgl. SC 2). Doch das jetzt geschenkte Heil ist nur Angeld und Vorwegnahme des endzeitlichen Heils in der neuen Welt (vgl. SC 8). Deshalb sind die Sakramente drittens prophetisch-vorausweisende Zeichen der Hoffnung. Die Liturgie ist Vorfeier der himmlischen Liturgie. In der Fronleichnams-Antiphon kommen alle drei Dimensionen zum Ausdruck: "O heiliges Mahl, in dem Christus unsere Speise ist: Gedächtnis seines Leidens, Fülle der Gnade, Unterpfand der künftigen Herrlichkeit."
3.3 Die Sakramente als Heilszeichen
Als Gestalten des Wortes und der Gnade wie als Gestalten der Begegnung mit Jesus Christus sind die Sakramente zugleich Zeichen des Heils und der Gnade. Das Neue Testament spricht von einer Wiedergeburt aus dem Wasser und dem Heiligen Geist (vgl. Job 3,5), von einer Rettung durch das Bad der Wiedergeburt (vgl. Tit 3,5), einer Reinigung durch das Bad des Wassers im Wort (vgl. Eph 5,26). Die Sakramente weisen also auf das Heil nicht nur äußerlich hin; sie enthalten und schenken das Heil, das sie bezeichnen (vgl. DS 1310; 1606; NR 501; 511; SC 59). Im Anschluß an den heiligen Augustinus bestimmt deshalb das Trienter Konzil das Sakrament als
- "sinnenfälliges Zeichen einer heiligen Sache und sichtbare Gestalt der unsichtbaren Gnade." (DS 1639; NR 571)
Die Sakramente wecken und stärken nicht nur den Glauben, sondern schenken auch die Gnade, die sie bezeichnen; sie sind nicht nur Glaubensmittel, sondern auch Gnadenmittel (vgl. DS 1605; NR 510; SC 59; LG 11).
Die katholische Lehre spricht darüber hinaus davon, daß die Sakramente die Gnade schenken kraft der vollzogenen sakramentalen Handlung (ex opere operato) (vgl. DS 1608; NR 513). Diese Formel wird oft mißverstanden. Sie meint keine mechanische oder magische Wirksamkeit der Sakramente. Denn der eigentliche Grund und die Kraft, in der die Sakramente allein wirken, ist das Heilswerk Jesu Christi; Jesus Christus ist auch der eigentliche Spender der Sakramente (vgl. SC 7). Auf seiten des Menschen setzt die Heilswirksamkeit der Sakramente den Glauben voraus; ja, vom Maß der Offenheit und Bereitschaft des Menschen hängt das Maß der Gnade, das wir empfangen, ab. Aber der Glaube wirkt nicht die Gnade, er empfängt sie; er empfängt sie durch das Sakrament als zeichenhaft wahrnehmbare Gestalt der Christusbegegnung. Allein dies ist mit der genannten Formel gemeint. Sie drückt also nicht das Ganze des katholischen Sakramentenverständnisses aus und muß deshalb im Gesamtzusammenhang der katholischen Sakramentenlehre gedeutet werden.
Worin besteht nun das Heil bzw. die Gnade der Sakramente? Wir können bei der Antwort auf diese Frage all das voraussetzen, was wir über die Wirklichkeit der Erlösung und der Gnade bereits gesagt haben. Die Sakramente schenken uns also die Liebe Gottes, in der sich uns der Vater selbst mitteilt durch Jesus Christus im Heiligen Geist. Im einzelnen kann man eine doppelte Wirkung der Sakramente unterscheiden: Die Sakramente geben uns Anteil an Amt und Sendung Jesu Christi, und sie geben uns Anteil an seinem Leben.
Der Anteil an Amt und Sendung Jesu Christi ist gemeint mit dem sakramentalen Prägemal (sakramentaler Charakter), eine Bezeichnung, die manchmal mißverstanden wird. Sie meint, daß uns Taufe, Firmung und Weihe (vgl. DS 1313; 1609; NR 504; 514) an Amt und Sendung Jesu Christi teilhaben lassen und uns so für Jesus Christus und seine "Sache" endgültig in Dienst nehmen, so daß wir davon bleibend geprägt und gleichsam besiegelt sind. Sie können deshalb nicht wiederholt werden. Durch die genannten Sakramente werden wir in je spezifischer Weise dem Priestertum Jesu Christi gleichgestaltet. Sie nehmen uns also in Dienst zur Verherrlichung Gottes und zum Heil der Menschen. Damit kommt zum Ausdruck, daß es in den Sakramenten nie nur um das private Heil des einzelnen geht, sondern immer auch um das Heil der Welt und um die öffentliche Verherrlichung Gottes.
Die Teilhabe an der Sendung Jesu Christi kann freilich nur dann in der rechten Weise ausgeübt werden, wenn wir auch am Leben, Sterben und an der Auferstehung Jesu Christi teilhaben. So zielen alle Sakramente darauf hin, uns durch die sakramentale Gnade am Pascha-Mysterium Jesu Christi teilhaben zu lassen, damit wir im Heiligen Geist durch Jesus Christus in das Leben und in die Liebe Gottes hineingenommen werden. Jedes Sakrament schenkt oder stärkt diese eine Gnade in der Weise und in der Ausprägung, wie es dem jeweiligen sakramentalen Zeichen, der von ihm dargestellten menschlichen Situation und wie es dem Sinn des jeweiligen Sakraments entspricht. So wird in den Sakramenten gesamtmenschlich konkret, was wir in allgemeiner Weise bereits ausführlich über die Wirklichkeit der Gnade gesagt haben.
Aus dieser Heilsbedeutung der Sakramente ergibt sich, daß die Sakramente für die Gläubigen zum Heil notwendig sind (vgl. DS 1604, NR 509). Sie sind weder überflüssig noch eine feierliche Verzierung oder ein bloßes Bekenntnis zur brüderlichen Zusammengehörigkeit. Zu einem bewußten und entschiedenen Christsein gehört der regelmäßige Empfang der Buße und der Eucharistie, verbunden mit der Bemühung um einen personalen Mitvollzug aus dem Glauben heraus. Die sakramentale Praxis ist zwar nicht das einzige, aber doch ein wesentliches Kriterium für ein ernsthaftes christliches Leben.
3.4 Die Sakramente als Zeichen der Kirche
Außer im Notfall werden alle Sakramente im Zusammenhang einer liturgischen Feier gespendet. Die Sakramente haben ihren Ort also innerhalb der liturgisch versammelten und feiernden Gemeinde.
Die Liturgie ist nicht nur ein äußerer Vollzug von Riten und Zeremonien; in ihr geht es auch nicht primär um Belehrung und Aktion. In der Liturgie handelt Jesus Christus selbst; sie ist Vollzug seines Priestertums. Jesus Christus aber handelt in der Kirche und durch die Kirche. In der das Wort Gottes verkündenden, Gott Dank sagenden, "in Freude und Einfalt des Herzens" (Apg 2,46) das Vermächtnis des Herrn feiernden, opfernden, fürbittenden und auf die Ankunft des Herrn hoffenden Gemeinde ist Jesus Christus selbst gegenwärtig. Die Liturgie ist also der öffentliche Gottesdienst des ganzen mystischen Leibes Jesu Christi, des Hauptes und der Glieder. In ihr wird durch sinnenfällige Zeichen das Heil des Menschen wirksam bezeichnet und zugleich Gott in gemeinschaftlicher und öffentlicher Weise verherrlicht (vgl. SC 7).
Der letzte Grund, weshalb die Sakramente ihren Ort innerhalb der liturgisch feiernden Gemeinde haben, besteht darin, daß die Kirche in Jesus Christus das universale Sakrament des Heils ist (vgl. LG 48 u. a.). Die einzelnen Sakramente sind als Christuszeichen zugleich Zeichen der Kirche. Durch die Sakramente wird die Kirche einerseits auferbaut; andererseits drückt sich in den einzelnen Sakramenten die sakramentale Zeichenhaftigkeit der Kirche konkret aus. So begegnet uns Jesus Christus und sein Heil in den Sakramenten durch die Gemeinschaft der Glaubenden. Das geschieht entweder dadurch, daß wir durch die Sakramente in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen (Taufe) und zu voll mitverantwortlichen Gliedern der Kirche gemacht werden (Firmung), oder indem diese Gliedschaft vertieft und vollzogen wird (Eucharistie) und eine besondere Sendung in der Kirche gegeben wird (Weihe, Ehe) oder indem sie wieder voll hergestellt wird, wenn sie durch die Sünde gestört wurde (Buße, Krankensalbung). Die Sakramente sind also Zeichen, welche die Heilsbedeutung der Kirche ausdrücken; durch sie wird die Kirche aber auch als Heilszeichen immer wieder neu auferbaut, durch sie wächst und erneuert sich die Kirche. In der sakramentalen Feier ist die Kirche die Gemeinschaft der Heiligen in dem oben dargestellten doppelten Sinn des Wortes, die Gemeinschaft der durch die Sakramente geheiligten Menschen.
Die Sakramente haben also Gemeinschaftscharakter. Sie sind nicht private Handlungen, sondern liturgische Feiern der Kirche selbst (vgl. SC 26). Dies gilt in besonderer Weise von der Feier der Eucharistie, dem Zeichen der Einheit und dem Band der Liebe (vgl. SC 47). Bei der Feier der Sakramente sollen deshalb die Gläubigen nicht nur als stumme Zuschauer, sondern auf ihre Weise bewußt, tätig und mit geistlichem Gewinn teilnehmen (vgl. SC 11; 14 u. a.). Dieser Gemeinschaftscharakter der Sakramente kommt nicht zuletzt dadurch zum Ausdruck, daß die Spendung der Sakramente ein dialogisches Geschehen ist. Außer bei der Kommunion des zelebrierenden Priesters kann sich niemand ein Sakrament selber spenden; es wird ihm gespendet. So bedarf es bei jedem Sakrament eines Spenders, der im Auftrag und im Namen Jesu Christi, des eigentlichen Spenders, die sakramentale Handlung vollzieht, und des Empfängers, der das Sakrament im Glauben annimmt.
Der Spender des Sakraments muß ausdrücklich von Jesus Christus gesandt und beauftragt sein. Deshalb ist die Spendung der Sakramente - außer im Fall der Nottaufe und beim Sakrament der Ehe - dem Amt in der Kirche vorbehalten (vgl. DS 1610; NR 515). Das ist auch der Grund, weshalb Laien zur Kommunionausteilung einer eigenen Beauftragung durch den Bischof bedürfen. Da die Sakramente Zeichen und Feiern der Kirche sind, ist zur Gültigkeit der Sakramente außerdem erforderlich, daß der Spender das wesentliche Zeichen des Sakraments in der rechten, d. h. in der Kirche festgelegten Weise vollzieht und daß er ferner die Absicht hat zu tun, was die Kirche tut (vgl. DS 1312; 1611; NR 503; 516). Deshalb ist etwa eine Taufe, die nicht in trinitarischer Form gespendet wird, oder eine Taufe zum Scherz nicht gültig; ebenso ungültig ist das Ja-Wort bei der Ehe, bei dem wesentliche Inhalte des kirchlichen Verständnisses der Ehe ausgeschlossen werden. Für die würdige Spendung der Sakramente ist es notwendig, daß der Spender sich bemüht, das zu leben, was er sakramental vollzieht. Deshalb sagt der Bischof bei der Priesterweihe: "Bedenke, was du tust, ahme nach, was du vollziehst, und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes." Zur gültigen Spendung eines Sakraments ist die subjektive Heiligkeit und Rechtgläubigkeit des Spenders jedoch nicht erforderlich (vgl. DS 1612; NR 517). Zwar haben verschiedene schwärmerische Bewegungen schon in der alten Kirche und bis heute immer wieder versucht, die Gültigkeit der Sakramente von der persönlichen Heiligkeit und Glaubwürdigkeit des Spenders abhängig zu machen. Doch damit ist verkannt, daß die Sakramente ihre Kraft nicht aus der menschlichen Heiligkeit des Spenders, sondern aus dem Heilswerk Jesu Christi schöpfen und daß Jesus Christus selbst der eigentliche Spender des Sakramentes ist, der sich auch unwürdiger Diener bedienen kann. Andernfalls entstünde in der Gemeinde eine ständige Unruhe und Ungewißheit; die Gemeinde müßte immer fragen und nachforschen, ob der Priester auch würdig ist; das führte notwendig zur Bildung von Schwarmgemeinden und zur Auflösung der Einheit der Kirche. Alle Großkirchen, auch die Lutheraner und die Reformierten, haben sich für die "Objektivität" der kirchlichen Heilsvermittlung entschieden.
Für den Empfänger des Sakraments sind zu einem würdigen und fruchtbringenden Empfang ein lebendiger Glaube und ein gläubiges Bereitetsein (Disposition) für die sakramentale Gnade notwendig. Ein unwürdig empfangenes Sakrament wirkt nicht das Heil, sondern das Gericht (vgl. 1 Kor 11,27-29). Deshalb müssen wir uns für den Empfang der Sakramente in der rechten Weise bereiten: durch Besinnung, Gebet, Buße. Ist diese positive Disposition nicht gegeben, so ist für einen gültigen Empfang auf jeden Fall die Intention, das Sakrament zu empfangen, notwendig. Unter physischem oder psychischem Zwang kommt also kein gültiges Sakrament zustande. Das ist etwa für die Gültigkeit der Priesterweihe und der Ehe von Bedeutung. Dagegen ist für die bloße Gültigkeit weder die persönliche Rechtgläubigkeit noch die persönliche Heiligkeit erforderlich. Allein das Bußsakrament macht hier eine Ausnahme. So kann etwa ein Nichtkatholik (sofern er getauft ist) gültig das Sakrament der Ehe und ein Unwürdiger gültig die Priesterweihe empfangen, solange beide nicht positiv den Empfang des Sakramentes und seine wesentlichen Gehalte direkt ausschließen. Das alles zeigt noch einmal, daß die Sakramente nicht magische oder mechanische Zaubermittel, sondern Sakramente des Glaubens sind.
3.5 Die Sakramentalien
Die Sakramente sind nicht nur punktuelle Ereignisse in unserem Leben. Sie müssen vorbereitet werden und sich auswirken in der "Liturgie der Welt". Die Heiligung des Alltags geschieht in erster Linie durch den Gottesdienst des Lebens aus dem Glauben heraus (vgl. Röm 12,1). Doch dazu bedarf der Mensch auch und gerade in unserer industrialisierten, wissenschaftlich und technisch rationalen Welt der Zeichen, die ihn an Gott erinnern und ihn seines Segens vergewissern. Nur durch solche Zeichen kann eine Atmosphäre des Glaubens geschaffen werden, in der uns immer wieder bewußt wird, daß unser ganzes Leben auf Gott hingeordnet und in ihm geborgen ist. Wenn solche Zeichen fehlen, verarmt das christliche Leben.
Zu diesem Zweck hat die Kirche Sakramentalien eingesetzt. Darunter versteht man heilige Zeichen, die den Sakramenten ähnlich sind. Sie sind jedoch nicht wie die Sakramente von Jesus Christus, sondern von der Kirche eingesetzt; sie bringen Früchte, vor allem geistlicher Art, hervor, freilich nicht wie die Sakramente kraft ihres Vollzugs, sondern kraft der Fürbitte der Kirche und der Mittätigkeit des Empfängers. Sie schenken auch nicht unmittelbar die heiligmachende Gnade, sondern bereiten uns auf deren Empfang vor und bringen sie zur Auswirkung. Durch diese Zeichen werden die verschiedenen Bereiche und Situationen des Lebens geheiligt (vgl. SC 60). "Die Wirkung der Liturgie der Sakramente und Sakramentalien ist also diese: Wenn die Gläubigen recht bereitet sind, wird ihnen nahezu jedes Ereignis ihres Lebens geheiligt durch die göttliche Gnade, die ausströmt vom Pascha-Mysterium des Leidens, des Todes und der Auferstehung Christi, aus dem alle Sakramente und Sakramentalien ihre Kraft ableiten. Auch bewirken sie, daß es kaum einen rechten Gebrauch der materiellen Dinge gibt, der nicht auf das Ziel ausgerichtet werden kann, den Menschen zu heiligen und Gott zu loben" (SC 61).
Zu den Sakramentalien gehören in erster Linie die Segnungen für die verschiedenen Bereiche des Lebens. Sie bringen zum Ausdruck: Der Mensch ist segensbedürftig. Er verlangt nach Heil, Schutz, Glück und Erfüllung seines Lebens. Darum sprechen sich Menschen gegenseitig Segen zu: Sie wünschen sich Gutes. Vor allem aber erhoffen und erbitten sie Segen von Gott. Gott ist die Quelle alles Guten und allen Segens in der Schöpfung und in der Geschichte des Heils. Jesus Christus ist die Fülle des Segens. Die Heilige Schrift bezeugt, daß Jesus "umherzog, Gutes tat und alle heilte" (Apg 10,38); er schloß Kinder in seine Arme und segnete sie (vgl. Mk 10,16); er legte Kranken die Hände auf (vgl. Lk 4,40); denen, die ihn hörten, brach er das Brot und segnete es (vgl. Mk 6,41). In Christus sind die Christen von Gott dem Vater "mit allem Segen seines Geistes gesegnet" (Eph 1,3) und zugleich berufen, zu segnen und Segen zu erlangen (vgl. 1 Petr 3,9). Die Kirche vermittelt den Segen deshalb unter Anrufung des Namens Jesu. Jede Segnung ist ein Lobpreis Gottes und eine Bitte um seinen Segen. Der eigentliche Segensgestus bei allen Segnungen ist das Kreuzeszeichen. So setzen Segnungen zumindest beim Spender den Glauben voraus. Damit ist ein magisches Mißverständnis der Segnungen grundsätzlich ausgeschlossen.
Am bekanntesten und am "alltäglichsten" und zugleich zutiefst biblisch begründet ist der Tischsegen (Tischgebet). Eine größere Bedeutung hat auch der Wettersegen mit der Bitte um gute Witterung und Gedeihen der Früchte der Erde, die Segnung eines Hauses oder einer Wohnung, der Reisesegen, der Krankensegen u. a. Oft sind solche Segnungen mit altem Brauchtum verbunden wie die Segnung des Johannesweins, der Blasiussegen, der Speisesegen an Ostern, die Kräutersegnung am Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel u. a. Die Segnung des Weihwassers, das bei den anderen Segnungen verwendet wird (z. B. Kreuze und Rosenkränze) und das wir auch sonst im Alltag benutzen können, soll uns an das Taufwasser erinnern und uns so helfen, die gesamte Schöpfung von der Sklaverei und Verlorenheit zu befreien (vgl. Röm 8,21) und mit dem neuen Leben in Jesus Christus zu erfüllen. Das kommt vor allem beim sonntäglichen Taufgedächtnis, der Segnung und Ausspendung des Weihwassers zum Ausdruck.
Mit bestimmten Segnungen ist eine Wirkung bleibender Art verbunden. Durch sie werden Personen oder Dinge aus dem profanen Bereich ausgesondert und ganz für Gott und für den Gottesdienst geweiht. In diesen Fällen spricht man zumeist von einer Weihe. Als Weihe von Personen ist - im Unterschied zu der sakramentalen Weihe der Bischöfe, Priester und Diakone - besonders die Abtsweihe, die Mönchs- und Jungfrauenweihe von Bedeutung. Als Weihe von Dingen ist vor allem die Weihe einer Kirche, eines Altars, liturgischer Geräte u. a. zu nennen.Wenn die Kirche amtlich und vollmächtig im Namen Jesu Christi um den Schutz vor den Anfechtungen des bösen Feindes und um Befreiung von seiner Macht bittet, spricht man von Exorzismus. Jesus hat ihn selbst geübt (vgl. Mk 1,25 u. a.). Auch Vollmacht und Auftrag der Kirche zum Exorzismus stammen von Jesus Christus selbst (vgl. Mk 3,15; 6,7.13; 16,17). In einfacher Form wird der Exorzismus bei der Taufe, bei der Weihe des Weihwassers u. a. gebraucht.
Der feierliche, sogenannte große Exorzismus darf nur mit Erlaubnis des Bischofs vorgenommen werden. Dabei ist mit Klugheit und Nüchternheit streng nach den von der Kirche aufgestellten Kriterien vorzugehen. In keinem Fall ist der Exorzismus ein Ersatz für ärztliche Bemühungen.
Die Sakramentalien und das damit oft verbundene Brauchtum haben ihren Sinn in der Hinführung zu den Sakramenten, besonders zur Eucharistie, in der Ausschmückung und Ausdeutung der Liturgie der Sakramente und in deren Fruchtbarmachung im christlichen Alltag. Sie sind aber niemals selbst das Zentrum. Von diesem Zentrum, von der Feier der Sakramente, muß jetzt ausführlich die Rede sein.
IV. Die sieben Sakramente
1. Die Taufe
1.1 Die Taufe - Sakrament des Glaubens
Als Petrus nach der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten Jesus Christus, den Gekreuzigten, als Herrn und Messias verkündete, da traf es seine Hörer mitten ins Herz, und sie fragten ihn und die übrigen Apostel: "Was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen: Kehrt um, und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung seiner Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen" (Apg 2,37-38). Dieser Text zeigt, daß Bekehrung zu Jesus Christus von allem Anfang an mit der Taufe auf den Namen Jesu Christi verbunden war. Schon immer war in der Kirche die Taufe das Eingangstor und die Grundlage des gesamten Christseins. Sie ist mit der Firmung und der Eucharistie zusammen das Sakrament der christlichen Initiation, der Einführung und Einweihung in das Christsein (vgl. SC 71).
Die kirchliche Glaubensüberlieferung kennt viele Vorbilder und Vorzeichen für die Taufe schon im Alten Testament. So verstand die Kirche das Schweben des Schöpfergeistes Gottes über den Urfluten ebenso wie die Errettung der Sippe des Noach aus den Wassern der Sündflut und die Errettung des Volkes Israel beim Durchzug durch das Rote Meer als Hinweise auf die Wirklichkeit und Bedeutung der Taufe. Grundlegend für die Urkirche wurde die Tatsache, daß Jesus sich der Johannestaufe unterzogen hat und dabei als Sohn Gottes und als der geisterfüllte Messias proklamiert wurde (vgl. Mk 1,9-11 par.). Die Johannestaufe ist sozusagen das letzte Angebot Gottes an Israel, bevor der als nahe erwartete Gerichtstag anbricht. Das Neue an der urchristlichen Taufpraxis gegenüber der Johannestaufe bestand darin, daß die christliche Taufe "auf den Namen Jesu Christi" vollzogen wurde. Sie verhieß nicht allein Rettung aus dem künftigen Gericht, sondern schenkte schon jetzt Anteil am Heil, das durch Tod und Auferstehung Jesu Christi wie durch die Ausgießung des Heiligen Geistes bereits erschienen war. Die christliche Taufe ist also vorbereitet im Alten Testament, grundgelegt in Jesu eigener Taufe, sie schöpft ihre Kraft aus Tod und Auferweckung Jesu wie aus der Sendung des Geistes, und sie wird gespendet im Auftrag und in der Vollmacht des auferstandenen und erhöhten Herrn:
- "Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern, und macht alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe." (Mt 28,18-20; vgl. Mk 16,15-16)
Aus diesem Ursprung ergibt sich, daß die christliche Taufe vor allem Zeichen des Glaubens, d. h. das Zeichen der Bekehrung und der Lebenswende hin zu Jesus Christus und des Bekenntnisses zu ihm ist. Deshalb geht seit altkirchlicher Zeit der Taufe von Erwachsenen eine längere Zeit der Einführung in den Glauben und in das Leben aus dem Glauben (Katechumenat) voraus. Vor der Kindertaufe soll ein Taufgespräch mit den Eltern und Paten, die das getaufte Kind später in den Glauben einführen sollen, stattfinden. Bei der Tauffeier selbst muß der Täufling bzw. müssen die Eltern und die Paten dem Bösen (bzw. dem Satan) widersagen und den Glauben an Gott, den allmächtigen Vater, an Jesus Christus und an den Heiligen Geist bekennen. Aufgrund dieses Bekenntnisses wird die Taufe gespendet "im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes". Der Glaube ist jedoch nicht nur für den Empfang der Taufe notwendig, aus der Taufe ergibt sich vielmehr die Aufgabe eines lebenslänglichen Wachsens und Reifens im Glauben. Zum Zeichen dafür erneuert die Gemeinde bei der Feier der Osternacht jedes Jahr das Taufbekenntnis.
1.2 Die Taufe - Sakrament des neuen Lebens
Das Zeichen der Taufe besteht im Abwaschen mit Wasser und im Aussprechen des Namens des dreifaltigen Gottes über dem Täufling: "Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes." Das Wasser ist Symbol der Reinigung wie Symbol des Lebens. Es bringt die doppelte Frucht der Taufe zum Ausdruck: Reinigung von der Sünde und Geschenk des neuen Lebens. Die Taufe wäscht und reinigt uns von der Sünde (vgl. 1 Kor 6,11; Apg 22,16). Sie löst uns aus der verhängnisvollen Schicksalsgemeinschaft aller Menschen unter der Macht der Sünde und befreit uns von der Erbsünde wie von allen bisher begangenen persönlichen Sünden. Positiv ausgedrückt ist die Taufe Wiedergeburt zum neuen Leben (vgl. 231-247 Joh 3,3.5; Tit 3,5; 1 Petr 1,3.23). Sie schenkt Rechtfertigung und Heiligung (vgl. 1 Kor 6,11), sie gibt uns die Gabe des Heiligen Geistes (vgl. Apg 2,38; 1 Kor 12,13) und das Geschenk der heiligmachenden Gnade. Sie macht uns zu Kindern Gottes und damit auch zu Erben Gottes und Miterben Christi (vgl. Röm 8,17; DS 1316; NR 531; LG 11). Das neue Leben wirkt sich aus in Glaube, Hoffnung und Liebe, die uns durch die Taufe ebenfalls eingegossen werden. Weil die Taufe das Licht des Glaubens schenkt, kann sie in der Heiligen Schrift auch als Erleuchtung bezeichnet werden (vgl. Hebr 6,4; 10,32). Deshalb wird bei der feierlichen Taufe dem Täufling die Taufkerze überreicht: "Empfange das Licht Christi."
Aus dieser umfassenden Heilsbedeutung ergibt sich die Heilsnotwendigkeit der Taufe.
- "Wer glaubt und sich taufen läßt, wird gerettet; wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden." (Mk 16,16)
- "Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen." (Joh 3,5)
Die Kirche lehrt die Heilsnotwendigkeit der Taufe nur für diejenigen, denen die Taufe verkündet wurde und die die Möglichkeit hatten, sich für die Taufe zu entscheiden. Da Gott das Heil aller Menschen will (vgl. 1 Tim 2,4-6), kann ein Mensch, der nach seinem Gewissen lebt und den Willen Gottes so tut, wie er ihn konkret erkennt, und der deshalb gewiß die Taufe begehrt hätte, wenn er um ihre Bedeutung gewußt hätte, aufgrund einer solchen "Begierdetaufe" das Heil erlangen.
Die Vergebung der Sünden und die Gabe des neuen Lebens ist uns konkret durch Jesus Christus geschenkt worden. Deshalb schenkt uns die Taufe Teilhabe an der Sendung und am neuen Leben Jesu Christi. Nach dem Neuen Testament wird die Taufe "auf den Namen Jesu Christi" gespendet (Apg 2,38; vgl. 10,48; Röm 6,3; Gal 3,27 u. a.). Damit ist gemeint, daß wir in der Taufe an den Herrn Jesus Christus übereignet und seinem Herrschaftsbereich unterstellt werden.
Die Teilhabe an der Sendung Jesu, nämlich an seinem dreifachen Amt als Priester, Prophet und König, kommt bei der Feier der Taufe vor allem durch die Salbung mit Chrisam, dem Zeichen prophetischer, priesterlicher und königlicher Würde, zum Ausdruck. So begründet die Taufe das gemeinsame Priestertum aller Christen (vgl. LG 10; 33; AA 3). Jeder Getaufte soll in seinem Leben, in Familie und Beruf Jesus Christus bezeugen und vergegenwärtigen. So wie Jesus Christus das Werk der Erlösung ein für allemal getan hat, so werden auch wir in der Taufe ein für allemal in seinen Dienst gestellt. Sie prägt der Seele des Täuflings ein bleibendes "unauslöschliches geistiges Prägemal", den "Taufcharakter", ein. Damit ist gemeint,daß der Getaufte ein für allemal Jesus Christus zugeeignet und bleibend von ihm berufen, geprägt und gesandt ist. Zwar kann der Getaufte durch die Sünde und im Extremfall durch Abfall vom Glauben der Taufe untreu werden und das uns in Jesus Christus und im Heiligen Geist geschenkte neue Leben verlieren. Die Berufung, die Indienstnahme und die Prägung durch Jesus Christus bleiben jedoch bestehen. Deshalb ist die Taufe einmalig und kann nicht wiederholt werden.
Die Teilhabe am neuen Leben Jesu Christi durch die Taufe ist vor allem vom Apostel Paulus entfaltet und gedeutet worden als Hineingenommenwerden in Tod und Auferweckung Jesu Christi:
- "Wißt ihr denn nicht, daß wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod; und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben. Wenn wir nämlich ihm gleich geworden sind in seinem Tod, dann werden wir mit ihm auch in seiner Auferstehung vereinigt sein." (Röm 6,3-5; vgl. Kol 2,12)
Weil wir durch die Taufe hineingenommen wurden in das Pascha-Mysterium Jesu Christi, in seinen Tod und in seine Auferstehung, sollen wir als Christen tot sein für die Sünde und leben für Gott. So ist die Taufe die Grundlage des ganzen christlichen Lebens wie des christlichen Sterbens. Aufgrund der Taufe gilt: Christ, werde, was du bist! Das ganze christliche Leben muß deshalb eine ständige Bekehrung und ein ständiger Kampf mit den Mächten der Sünde sein wie ein beständiges Wachsen im neuen Leben, in Glaube, Hoffnung und Liebe. Dazu gehören auch Askese, d. h. das beharrliche Bemühen, alles abzulegen, was nicht dem Geist Jesu Christi entspricht, und die Einübung ins Christsein, d. h. das Bemühen, dem Bild Jesu Christi gleichgestaltet zu werden und in seiner Kraft zu erstarken (vgl. Phil 3,10; Röm 8,29, Kol 3,9-10). Als Mittel dazu nennt die kirchliche Überlieferung Fasten, Gebet und Almosen (vgl. Tob 12,8; Mt 6,1-18). Ebenso gehört zum Leben des Getauften, daß er schon jetzt in vorläufiger Weise teilnimmt an dem verklärten Leben des auferstandenen Herrn in Erfahrungen der Gewißheit, des Trostes und der Freude bis hin zu den mystischen Formen der Erfahrung der Gemeinschaft und der Freundschaft mit Gott. Eine besondere Ausprägung des in der Taufe geschenkten neuen Lebens ist das Leben nach den evangelischen Räten in freigewählter Armut und Ehelosigkeit sowie im Leben aus dem Gehorsam gemäß der Regel einer geistlichen Gemeinschaft. Die höchste Erfüllung der Taufe und zugleich die Höchstform christlicher Existenz in der Nachfolge Jesu ist das Martyrium, die Hingabe des eigenen Lebens für Jesus Christus und die Brüder und Schwestern. Die Kirchenväter sprachen von der Bluttaufe; sie ist nach der Wassertaufe die zweite Eintauchung (Tertullian).
1.3 Die Taufe - Eingliederung in die Kirche
Wie der einzelne Mensch nur in Gemeinschaft lebensfähig ist, so bedarf auch der einzelne Christ, der in der Taufe zum neuen Leben wiedergeboren wird, des bergenden Lebensraumes des ganzen Volkes Gottes, der Kirche. Die Taufe wurde deshalb von Anfang an als Eingliederung in die Kirche verstanden (vgl. Apg 2,41.47 u. a.; DS 1314; NR 528; LG 11). Sie ist das grundlegende Sakrament der christlichen Initiation (Einführung, Einweihung). Das hat seinen tiefsten Grund darin, daß die Taufe uns in die Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus versetzt und uns dem Leib Christi eingliedert. Indem wir alle durch die eine Taufe mit Christus verbunden werden, werden wir in Christus auch untereinander verbunden. So entsteht durch die Taufe das Volk Gottes des Neuen Bundes, das alle natürlichen Grenzen der Völker, Kulturen, Klassen, Rassen wie des Geschlechts überschreitet. Paulus kann deshalb sagen:
- "Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und Freie; und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt." (1 Kor 12,13)
- "Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus (als Gewand) angelegt. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau; denn ihr alle seid ,einer' in Christus Jesus." (Gal 3,27-28; vgl. Kol 3,11)
- "Seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt einander in Liebe, und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch den Frieden, der euch zusammenhält. Ein Leib und ein Geist, wie euch durch eure Berufung auch eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist." (Eph 4,2-6)
Durch die eine Taufe sind wir eingegliedert in die Gemeinschaft der Kirche aller Zeiten und aller Orte. Die Eingliederung in die Kirche findet konkreten Ausdruck in der Aufnahme in die Gottesdienstgemeinde, in eine Gemeinde also, die "zu Recht mit jenem Namen benannt werden kann, der die Auszeichnung des einen und ganzen Gottesvolkes ist: Kirche Gottes" (LG 28). Deshalb soll die Taufe in der Regel in der Pfarrkirche im Rahmen der Feier des Sonntags, einige Male im Jahr auch innerhalb der Eucharistiefeier stattfinden. Die Taufe Jugendlicher und Erwachsener soll möglichst in der Osternacht gespendet werden.
Da die Taufe in die Gemeinschaft der Kirche eingliedert, ist die feierliche liturgische Spendung der Taufe Sache des kirchlichen Amtes. In der alten Kirche war die Spendung der Taufe sogar das Vorrecht des Bischofs. Erst später ging die feierliche Spendung der Taufe auch auf die Priester und Diakone über. Da die Taufe jedoch heilsnotwendig ist, kann im Notfall jeder Christ, ja jeder Mensch, also auch ein Ungetaufter, die Taufe gültig spenden, wenn er dies in der Form und gemäß der Absicht der Kirche tut (vgl. DS 1315; NR 530; LG 17). Der eigentliche Spender der Taufe ist ja Jesus Christus selbst (vgl. SC 7).
Zum kirchlichen Charakter der Taufe gehört auch, daß die gesamte Gemeinde verantwortlich ist für den Glauben des Neugetauften. Eine besondere Verantwortung kommt dabei den Taufpaten zu. Durch die eine Taufe sind alle Brüder und Schwestern. Diese grundlegende Einheit aller Getauften über alle natürlichen Schranken hinweg muß konkret werden durch gegenseitige Hilfeleistung, durch Austausch von irdischen wie geistlichen Gaben. Vor allem die Armen, Kranken, Behinderten und Fremden müssen einen Ehrenplatz in der Gemeinde einnehmen. Seit altchristlicher Zeit galt die Gastfreundschaft als wichtiger Ausdruck der gemeinsamen Verbundenheit in Christus durch die eine Taufe. In der Regel des hl. Benedikt heißt es: "Alle ankommenden Gäste sollen wie Christus aufgenommen werden, weil dieser selbst einst sprechen wird: Ich war ein Fremder, und ihr habt mich aufgenommen." So soll der Getaufte, der auf Erden ein Fremdling und Gast ist und keine bleibende Stätte hat, in der weltweiten Kirche überall zu Hause sein.
Durch die eine gemeinsame Taufe sind wir auch mit den getauften Christen, die nicht zur Gemeinschaft der römisch-katholischen Kirche gehören, verbunden. Nach mancherlei Auseinandersetzungen hat die Kirche sich bereits im Ketzertaufstreit im 4. Jahrhundert und im Donatistenstreit im 5. Jahrhundert für die Gültigkeit der in der rechten Form außerhalb der katholischen Kirche gespendeten Taufe ausgesprochen. So ist die Taufe die Grundlage der ökumenischen Gemeinschaft und der ökumenischen Bemühung um die volle Kirchengemeinschaft, die vor allem in der Eucharistiegemeinschaft zum Ausdruck kommt. In diesem Sinn konnte das II. Vatikanische Konzil sagen:
- "Mit jenen, die durch die Taufe der Ehre des Christennamens teilhaft sind, den vollen Glauben aber nicht bekennen oder die Einheit der Gemeinschaft unter dem Nachfolger Petri nicht wahren, weiß sich die Kirche aus mehrfachem Grund verbunden." (LG 15)
- "Denn wer an Christus glaubt und in der rechten Weise die Taufe empfangen hat, steht dadurch in einer gewissen, wenn auch nicht vollkommenen Gemeinschaft mit der katholischen Kirche." (UR 3)
- "Die Taufe begründet also ein sakramentales Band der Einheit zwischen allen, die durch sie wiedergeboren sind. Dennoch ist die Taufe nur ein Anfang und Ausgangspunkt, da sie ihrem ganzen Wesen nach hinzielt auf die Erlangung der Fülle des Lebens in Christus. Daher ist die Taufe hingeordnet auf das vollständige Bekenntnis des Glaubens, auf die völlige Eingliederung in die Heilsveranstaltung, wie Christus sie gewollt hat, schließlich auf die vollständige Einfügung in die eucharistische Gemeinschaft." (UR 22)
Man kann heute ohne Schwierigkeiten davon ausgehen, daß die in den orthodoxen Kirchen, in der altkatholischen Kirche, der anglikanischen Kirche und in den evangelischen Großkirchen gespendete Taufe im Vollzug und in der Intention der in der katholischen Kirche gespendeten Taufe entspricht und also gültig ist. Deshalb ist die früher übliche bedingte Taufe bei Konversionen unzulässig. Als gültig anerkannt ist auch die Taufe der Baptisten, Methodisten, Mennoniten, der Herrnhuter Brüdergemeinde, der Siebentage-Adventisten. Umstritten ist die Gültigkeit bei der Neuapostolischen Kirche und bei den Mormonen. Die Taufe der Zeugen Jehovas ist sicher keine christliche Taufe im Sinne des Neuen Testaments. Heilsarmee, Quäker, Christian Science kennen keine Taufe.
1.4 Die Frage der Säuglingstaufe
Am Anfang der Kirche steht selbstverständlich die Erwachsenentaufe. Dies ist in den Missionsgebieten der Kirche bis heute so geblieben. Die Taufe unmündiger Kinder kann immer erst in der zweiten Generation zum Problem bzw. zur Praxis werden. Im Neuen Testament selbst gibt es dafür keine direkten Zeugnisse. Das Neue Testament spricht jedoch mehrfach von der Taufe eines ganzen "Hauses", d. h. ganzer Familien samt ihrem Gesinde (vgl. Apg 16,15.33-34; 18,8; 1 Kor 1,16). Es ist möglich, daß dabei auch Kinder mit eingeschlossen waren. Die ersten ausdrücklichen und klaren Zeugnisse für die Säuglingstaufe finden sich vom 2. Jahrhundert an. So ist die Taufe unmündiger Kinder sowohl in der Kirche des Ostens wie des Westens eine Praxis seit unvordenklichen Zeiten. Verschiedene Päpste und Synoden, vor allem das Trienter Konzil (vgl. DS 1514; 1626-1627; NR 356; 544-545), haben diese Lehre und Praxis bestätigt und verteidigt.
In unserem Jahrhundert ist eine neue Diskussion über die Säuglingstaufe aufgekommen. Als Argument gegen die Säuglingstaufe weist man oft auf die gewandelte gesellschaftliche Situation hin. In der älteren christlichen und konfessionell einheitlichen Gesellschaft - so sagt man - war die religiöse Erziehung der Kinder sichergestellt. In unserer pluralistischen und säkularisierten Gesellschaft dagegen kommen sehr viele als unmündige Kinder Getaufte später nie zu einem bewußten und persönlichen Glaubensakt. Außerdem sieht man in der Taufe von unmündigen Kindern oft auch einen Angriff auf deren individuelle Freiheit; deshalb wollen manche die Taufe auf ein Alter verschieben, in dem der junge Mensch selbst entscheiden kann.
Auf diese kritischen Anfragen an die Praxis der Kirche läßt sich antworten, daß die gesellschaftliche Situation für die Kirche nur einen hinweisenden Wert haben kann, aber nicht letztlich normgebend sein darf. Die Sendung der Kirche muß zwar in den jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnissen verwirklicht werden, sie darf sich jedoch nicht den gesellschaftlichen Normen unterstellen, sondern muß sich einzig und allein an der Sendung Jesu Christi orientieren. Zum andern: Eine religiöse und weltanschaulich freie Erziehung wäre eine völlige Illusion. Eltern und Erzieher prägen und beeinflussen heranwachsende Kinder auf jeden Fall, entweder durch ihren Glauben oder durch ihre Indifferenz, die in einer religiös vermeintlich freien und neutralen Erziehung zum Ausdruck kommen würde. Schließlich kann man fragen, ob hinter der heutigen Infragestellung der Säuglingstaufe nicht ein individuell verengtes Glaubensverständnis steht, das nicht mehr sieht, daß der Glaube in das Miteinander und in die Gemeinschaftlichkeit der Kirche eingebettet ist. Ja, man muß fragen, ob das Argument vom personalen, sich selbst verpflichtenden Glauben den Glauben nicht als eigenes Werk und als vorher zu erbringende Leistung mißversteht und ob damit nicht der Geschenkcharakter des Glaubens und der Taufe übersehen wird.
Positiv lassen sich vor allem drei Gesichtspunkte zur Begründung der Praxis der Säuglingstaufe geltend machen.
1. Das durch die Taufe begründete Christsein ist freie, unverdiente Gnade, mit der Gott all unserem Tun zuvorkommt und unser Leben von Anfang an umgibt (vgl. 1 Joh 4,10.19; Tit 3,5) und deren wir aufgrund der Erbsünde auch von allem Anfang an bedürfen. Diese allem Tun und Verdienst zuvorkommende Gnade kommt bei der Säuglingstaufe besonders deutlich zum Ausdruck. Die Kirche und die christlichen Eltern würden deshalb dem Kind ein wesentliches Gut vorenthalten, würden sie ihm nicht bald nach seiner Geburt das Sakrament der Taufe schenken.
2. Der Glaube ist grundsätzlich auf die Gemeinschaft der Gläubigen verwiesen und auf sie angewiesen. Die Säuglingstaufe artikuliert besonders deutlich das Angewiesensein und Einbezogensein in die tragende Gemeinschaft, ohne die das Kind auch menschlich nicht lebensfähig ist. So ist das unmündige Kind durch seine Eltern und auch durch seine Paten hineingenommen in die ganze Gemeinschaft der Glaubenden, die für dieses Kind vor Gott und vor den Menschen einzutreten hat. Das ist auch der Grund, weshalb ein unmündiges Kind nur dann getauft werden darf, wenn von den Eltern oder Verwandten die spätere christliche Erziehung gewährleistet ist. Ist diese Gewähr nach menschlichem Ermessen nicht gegeben, dann muß die Taufe in kluger Weise aufgeschoben werden.
3. Der Glaube ist kein punktuelles Geschehen, sondern ein Wachstumsprozeß. So gibt es für den getauften Christen die Aufgabe eines lebenslangen Hineinwachsens in Christus und in den Glauben an ihn. Schon im Neuen Testament gibt es nicht nur die Bewegung, die vom Glauben zur Taufe hinführt und in ihr die dichteste Form seiner Verleiblichung findet (vgl. Apg 8,12-13; 18,8; 10,47 u. a.). Es gibt auch die umgekehrte Bewegung, in der die bereits Getauften an ihre Taufe erinnert und immer tiefer in die Taufwirklichkeit eingeführt werden (vgl. Röm 6,3-4, 1 Kor 6,9-11; Eph 5,8-9; 1 Petr 2,1-5). Schließlich ist die Taufe nicht nur Zeichen des Glaubens, sondern auch dessen Kraftquelle; sie ist das Sakrament der Erleuchtung. Als solche ist sie der Anfang eines Weges und eines lebenslangen Wachstums im Glauben.
Aus dieser Begründung ergibt sich die Notwendigkeit einer erneuerten Taufpastoral. Im Grunde besteht das gesamte pastorale Bemühen in der Hinführung zur Taufe und in der Entfaltung des in der Taufe grundgelegten neuen Lebens im einzelnen Christen wie in der Gemeinde. Zur Taufpastoral im engeren Sinn gehören das Erwachsenenkatechumenat, im Hinblick auf die Kindertaufe das Taufgespräch mit den Eltern und Paten, die Seelsorge an Brautleuten und jungverheirateten Eheleuten, die Aktivierung der Verantwortung der ganzen Gemeinde für die Glaubenserziehung der Kinder. In diesem Zusammenhang ist vor allem von Bedeutung die Erneuerung der Gemeindekatechese, durch die heranwachsende Kinder in den Glauben und das Leben der Kirche eingeführt werden sollen (vgl. Gem. Synode, Schwerpunkte heutiger Sakramentenpastoral 2-3). Das Sakrament dieses Wachstums ist die Firmung.
2. Die Firmung
Ähnlich wie jedes Leben muß auch das in der Taufe grundgelegte christliche Leben wachsen und reifen. Dieser Wachstumsprozeß ist Frucht der Gnade Gottes. Der Stärkung und Vollendung der Taufe dient vor allem das Sakrament der Firmung. Es ist, obwohl ein eigenes Sakrament, doch eng mit der Taufe verbunden und soll das in der Taufe Grundgelegte entfalten, bekräftigen und vollenden. Diese enge Zusammengehörigkeit von Taufe, Firmung und Eucharistie als den drei Sakramenten der Initiation (Einführung, Einweihung) wurde durch das II. Vatikanische Konzil (1962-1965) erneut herausgestellt (vgl. SC 71).
Schon die Taufe schenkt uns den Heiligen Geist. Damit steht das ganze christliche Leben von allem Anfang an im Zeichen des Geistes Gottes. Schon das Neue Testament deutet auch eine von der Taufe verschiedene Geistverleihung durch Handauflegung an. Die Apostelgeschichte berichtet uns:
- "Als die Apostel in Jerusalem hörten, daß Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Diese zogen hinab und beteten für sie, sie möchten den Heiligen Geist empfangen. Denn er war noch auf keinen von ihnen herabgekommen; sie waren nur auf den Namen Jesu, des Herrn, getauft. Dann legten sie ihnen die Hände auf, und sie empfingen den Heiligen Geist." (Apg 8,14-17; vgl. 19,6; Hebr 6,2)
In diesem Text ist ein Doppeltes gesagt: Durch die Handauflegung der Apostel wird die zunächst relativ eigenständige Gemeinde von Samaria fester mit der Kirche von Jerusalem, dem Zentrum der Einheit, verbunden. Zugleich wird durch die Handauflegung den dortigen Christen in besonderer Weise die Gabe des Heiligen Geistes geschenkt. Damit klingen bereits zwei Motive an, die für das Sakrament der Firmung von Bedeutung wurden: engere Verbindung mit der Kirche und Stärkung durch die Kraft des Heiligen Geistes.
An diese Unterscheidung zwischen Taufe und Handauflegung konnte die kirchliche Überlieferung anknüpfen. Historisch betrachtet ist die Entwicklung recht kompliziert verlaufen. Während im Osten die Salbung im Mittelpunkt stand, stellte der Westen die Handauflegung in den Vordergrund; sie wurde schon bald mit einer Salbung verbunden bzw. als in der Salbung enthalten betrachtet. Beides, Handauflegung und Salbung, bildete zunächst mit der Taufe zusammen eine Gesamthandlung oder, wie Bischof Cyprian (3. Jh.) sagte, ein Doppelsakrament. Doch während die Taufe immer mehr vom Priester gespendet wurde, blieb im Westen die Firmung dem Bischof vorbehalten. Das führte in der lateinischen Kirche des Westens, als die Kindertaufe zur Normalform der Taufe und die Diözesen größer wurden, zu einer zeitlichen Trennung von Taufe und Firmung.
Das Zeichen der Firmung hat eine wandlungsreiche Geschichte erlebt, wobei aber die Bedeutung einer Mitteilung des Heiligen Geistes unverändert blieb. Bei der vom letzten Konzil angestoßenen Erneuerung der Firmung durch Papst Paul Vl. im Jahr 1971 wurde festgelegt: Die Firmung wird gespendet durch Salbung mit Chrisam auf die Stirn unter Auflegung der Hand. Dabei werden die Worte gesprochen: "Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist."
Die Salbung mit Öl ist ein uraltes Zeichen. Sie bedeutet nicht nur Reinigung und Kräftigung, sondern auch Ermächtigung und gibt Kraft, Macht und Glanz. Sie findet sich von alters her bei der Einsetzung von Königen und Priestern (vgl. 2 Sam 2,4.7; 5,3.17 u. a.). In diesem Sinn ist Jesus der Christus, d. h. der mit Heiligem Geist Gesalbte. Durch die Firmung nehmen die Christen, d. h. die Gesalbten, in vollerem Maß an Jesu Christi königlicher und priesterlicher Vollmacht und an seiner messianischen Geistfülle teil. Die Handauflegung bedeutet Besitzergreifung und zugleich Segen und Bevollmächtigung. Sie besagt, daß der Firmling vollkommen für Jesus Christus und die Kirche in Anspruch genommen wird und daß ihm zugleich eine Verantwortung übertragen wird, nämlich in der Kraft des Heiligen Geistes als Zeuge Jesu Christi den Glauben durch Wort und Tat zu verbreiten und zu verteidigen und so zum Aufbau und Wachstum des Leibes Christi, der Kirche, beizutragen.
So deutet das Zeichen der Firmung bereits auf die durch das Sakrament geschenkte Gnadengabe hin. Zunächst läßt uns die Firmung intensiver teilhaben an der Sendung Jesu Christi und der Kirche. Sie bestellt uns zu öffentlichen Zeugen des Glaubens und sendet uns zur verantwortlichen Mitarbeit in der Kirche. Da dies wie bei der Taufe ein für allemal geschieht, prägt auch die Firmung der Seele ein unauslöschliches geistiges Prägemal, den Firmcharakter, ein als Zeichen bleibenden In-Dienst-genommen-Seins von Jesus Christus. Deshalb kann die Firmung wie die Taufe nur einmal empfangen werden (vgl. DS 1609; N R 514).
Die Geistgabe der Firmung wird in dem Gebet, das der Bischof unter Ausbreitung der Hände vor der Handauflegung und Chrisamsalbung spricht, das zur Vollgestalt des Ritus gehört und zum umfassenden Verständnis des Sakraments beiträgt, ausgedeutet: "Allmächtiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, du hast diese Christen in der Taufe von der Schuld Adams befreit, du hast ihnen aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt. Wir bitten dich, Herr, sende ihnen den Heiligen Geist, den Beistand. Gib ihnen den Geist der Weisheit und der Einsicht, des Rates, der Erkenntnis und der Stärke, den Geist der Frömmigkeit und der Gottesfurcht. Durch Christus, unseren Herrn." Aus dieser Fülle der Geistgaben hat die Tradition der Kirche vor allem entfaltet, daß durch die Firmung "der Heilige Geist zur Stärkung gegeben wird..., damit der Christ mit Mut Christi Namen bekenne" (DS 1319; NR 554). Der Heilige Geist macht den Gefirmten vollkommener Jesus Christus ähnlich und stärkt ihn, für Jesus Christus Zeugnis abzulegen zur Auferbauung seines Leibes in Glaube, Hoffnung und Liebe. So ist die Firmung Entfaltung, Bestärkung und Fülle des schon bei der Taufe geschenkten Heiligen Geistes, verbunden mit der Sendung zu verantwortlichem Einsatz in der Kirche zum Dienst an den Menschen.
Der erstberufene Spender der Firmung ist der Bischof (vgl. LG 26). Die Spendung durch den Bischof, der die Fülle des Amtes in der Kirche innehat, verdeutlicht auch die engere Verbindung des Gefirmten mit der Kirche und die Verantwortung, die der Gefirmte durch das Zeugnis für Jesus Christus in der Kirche und für die Kirche übernimmt. Wenn der Bischof wegen der Größe der Diözese nicht häufig genug in einzelne Pfarreien kommen kann, kann auch ein vom Bischof beauftragter Priester, in der Regel ein engerer Mitarbeiter des Bischofs, in der Verantwortung für die Diözese und die Weltkirche die Firmung spenden. Bei Lebensgefahr eines noch nicht gefirmten Getauften ist der Pfarrer und sogar jeder Priester zur Spendung der Firmung bevollmächtigt und verpflichtet. Dasselbe gilt für einen Priester, der jemanden, der dem Kindesalter entwachsen ist, tauft oder als bereits Getauften in die volle Gemeinschaft der katholischen Kirche aufnimmt.
Lange Zeit hat die Firmung nur eine geringe Rolle im Bewußtsein der Christen gespielt. In jüngster Zeit gibt es Bemühungen um eine eigene Firmpastoral. Die Gemeinsame Synode hat dazu wichtige Anstöße gegeben. Die Firmvorbereitung ist Aufgabe der gesamten Gemeinde. Sie soll im Zusammenhang mit der Katechese in kleineren Gruppen gehalten und durch gemeinsame Erlebnisse und Aktionen (Einkehrtage, Wochenendfahrten, soziale Aufgaben u. a.) unterstützt werden. Dabei ist die Mitarbeit von geeigneten Laien hilfreich; die Eltern und die Firmpaten (möglichst dieselben wie die Taufpaten) sollen dabei mitwirken. Es ist darauf zu achten, daß sich am Ende der Vorbereitung jeder Firmbewerber bewußt und freiwillig selbst zur Firmung anmeldet. Die Feier der Firmung soll in einem festlichen eucharistischen Gottesdienst der ganzen Gemeinde geschehen. Dabei wiederholen und bekräftigen die Firmlinge vor der gesamten Gemeinde ihr Taufbekenntnis. Der die Spendung der Firmung abschließende Friedensgruß bringt die engere Verbindung des Gefirmten mit der Kirche zum Ausdruck. Deshalb sollen die Gefirmten durch Jugendgruppen u. a. lebendig in das Leben der Gemeinde einbezogen werden. Die Übernahme von Laiendiensten in der Gemeinde soll den Gefirmten, die durch die Firmung voll in die Kirche eingegliedert sind, vorbehalten bleiben (Gern. Synode, Schwerpunkte heutiger Sakramentenpastoral B.1.2.6).
Eine besondere Frage ist das Firmalter. Es handelt sich hier weniger um ein dogmatisches Problem als um eine pastorale Ermessensfrage. In den ersten Jahrhunderten wurde die Firmung unmittelbar nach der Taufe gespendet. In der Ostkirche ist dies bis heute so geblieben. Auch in der lateinischen Kirche des Westens bilden bei der Erwachsenentaufe Taufe, Firmung und erstmalige Zulassung zur Eucharistie eine Einheit. Bei der Kindertaufe wird die Firmung jedoch auf ein späteres Alter verschoben, nach der kirchenrechtlichen Ordnung bis zum Unterscheidungsalter. Entsprechend wollen heute manche auch bei uns die alte Reihenfolge Taufe - Firmung - Eucharistie wieder herstellen und treten deshalb für ein Firmalter von etwa sieben Jahren ein. Andere treten dafür ein, die Firmung jungen Erwachsenen zu spenden, also in einem Alter, da sie sich eigenständig und endgültig für Jesus Christus und die Kirche entscheiden können.
Es gibt aber auch gute Gründe für die gegenwärtige bei uns gültige Praxis, die Firmung etwa im 12. Lebensjahr zu spenden. Dazu sagt die Gemeinsame Synode: In diesem Alter kann das Kind bereits manches von der Bedeutung der Firmung erkennen und verwirklichen und deshalb sinnvoll um dieses Sakrament bitten. Es beginnt, sich aus der kindlichen Welt und dem kindgemäßen Glauben herauszulösen und geht die ersten Schritte eines bewußten Glaubens. In seiner Weise kann und muß es bereits Zeuge für Jesus Christus sein. Das Hauptgebot der Gottes- und Nächstenliebe kann es in seinem Bereich als Verpflichtung annehmen und befolgen. In diesem Alter kann es über Jugend- und Ministrantengruppen in seiner Weise bereits aktiv am Leben der Gemeinde teilnehmen. Die wichtigste Form der Teilnahme ist die Mitfeier der Eucharistie. Durch sie findet die Eingliederung in die Kirche ihren Abschluß und ihren Höhepunkt.
3. Die Eucharistie
3.1 Die Eucharistie - Danksagung an den Vater
Die Eucharistie ist Quelle und Höhepunkt des christlichen und des kirchlichen Lebens (vgl. LG 11). Schon von der Jerusalemer Urgemeinde berichtet uns die Apostelgeschichte: "Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten" (Apg 2,42, vgl. 46). Besonders am ersten Tag der Woche, dem Herrentag (vgl. Offb 1,10), versammelten sich schon die frühen Gemeinden zum Brotbrechen (vgl. Apg 20,7; 1 Kor 16,2). Der Märtyrerbischof Ignatius von Antiochien sagt uns bereits zu Beginn des 2. Jahrhunderts, Christsein heiße "gemäß dem Sonntag" leben. Kurz danach gibt uns der Märtyrer Justin eine anschauliche Beschreibung der urchristlichen sonntäglichen Eucharistiefeier. "Am Sonntage aber halten wir alle gemeinsam die Zusammenkunft, weil er der erste Tag ist, an welchem Gott durch Umwandlung der Finsternis und des Urstoffes die Welt schuf, und weil Jesus Christus, unser Erlöser, an diesem Tage von den Toten auferstanden ist." Im Grunde ist es bis heute so geblieben. Die sonntägliche Eucharistiefeier ist der wichtigste Ausdruck des christlichen Lebens und des Lebens einer christlichen Gemeinde (vgl. SC 106). Aber auch die Eucharistiefeier am Werktag ist für den einzelnen wie für die Gemeinde von großer Bedeutung.
Diese zentrale Stellung der Eucharistie ist durch die liturgische Bewegung in unserem Jahrhundert neu bewußt geworden. Durch die schon unter Papst Pius XII. begonnene, durch das II. Vatikanische Konzil geforderte (vgl. SC 47-49) und durch die Einführung des neuen Meßbuchs durch Papst Paul VI. im Jahr 1969 vollzogene Erneuerung der liturgischen Gestalt der Eucharistiefeier ist der innere Mitvollzug und die tätige Mitfeier der gesamten Gemeinde wesentlich gefördert worden. Man kann deshalb die Förderung und Erneuerung der Liturgie in unserem Jahrhundert "als ein Zeichen für die Fügungen der göttlichen Vorsehung" und "als ein Hindurchgehen des Heiligen Geistes durch seine Kirche" bezeichnen (SC 43).
Um die Eucharistie von ihrer innersten Wesensmitte her zu verstehen, müssen wir nach ihrem Ursprung in Jesus Christus, insbesondere nach ihrem Zusammenhang mit der Reich-Gottes-Verkündigung Jesu, seinem Tod und seiner Auferstehung fragen. Denn die von allem Anfang an bestehende eucharistische Praxis der Kirche geht auf Jesus Christus selbst zurück und ist durch ihn begründet. Näherhin können wir von einer dreifachen Begründung der Eucharistie bei Jesus Christus sprechen: Sie wird vorbereitet in der Mahlgemeinschaft des irdischen Jesus, sie ist grundgelegt im letzten Mahl Jesu am Abend vor seinem Tod, und sie wird bekräftigt in den österlichen Erscheinungen des auferstandenen Christus im Zusammenhang von Mählern seiner Jünger.
Die Mahlgemeinschaften, die Jesus während seines irdischen Lebens mit seinen Jüngern gehalten hat, waren Vorfeier und Vorwegnahme des schon von den Propheten verheißenen Mahls der Endzeit, des himmlischen Hochzeitsmahles. Sie waren zugleich Zeichen für die Aufnahme der Verlorenen in die endgültige Heilsgemeinschaft. Verherrlichung Gottes und Vergebung der Sünden gehörten schon hier eng zusammen. Die Mähler Jesu waren also Zeichen des anbrechenden eschatologischen Heils (schalom), der neuen Gemeinschaft mit Gott und der Gemeinschaft untereinander. - Das letzte Mahl, das Jesus am Abend vor seinem Leiden mit seinen Jüngern gehalten hat, hatte demgegenüber einen besonderen Charakter. Denn was der Herr in der Nacht, da er verraten wurde, tat, war zugleich etwas Neues. Beim Lob- und Dankgebet nahm Jesus in den Gesten der Austeilung von Brot und Wein und durch die begleitenden und deutenden Worte seine Hingabe im Tod "für die vielen" vorweg und ließ seine Jünger daran teilnehmen. Zugleich sah er seinen bevorstehenden Tod im Licht des endgültigen Kommens des Reiches Gottes: "Amen, ich sage euch: Ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich von neuem davon trinke im Reich Gottes" (Mk 14,25). - Durch Kreuz und Auferstehung Jesu fanden die Abendmahlsworte Jesu ihre Bekräftigung. So erschien Jesus nach der Auferstehung seinen Jüngern wieder bei Mahlgemeinschaften. Am eindrucksvollsten wird dies in der Begegnung der beiden Jünger mit dem Auferstandenen auf dem Weg nach Emmaus beschrieben, sie erkannten ihn, als er das Brot brach (vgl. Lk 24,13-35; vgl. 36-43; Joh 21,1-14). Dieses Brotbrechen war in der Urgemeinde wiederum von eschatologischer Vorfreude geprägt (vgl. Apg 2,46).
Die neutestamentlichen Texte vom Letzten Abendmahl (vgl. Mk 14,22-25; Mt 26,26-29; Lk 22,14-20; 1 Kor 11,23-26) stellen uns heute viele historische Fragen, auf die wir in diesem Zusammenhang nicht im einzelnen eingehen können. Keiner dieser Texte stimmt wörtlich mit den anderen überein. Sie zeigen bereits Spuren späterer liturgischer Prägung und theologischer Reflexion. So sind diese Texte Zeugnisse dafür, daß die Urkirche das Vermächtnis des Herrn von allem Anfang an lebendig aufgegriffen hat. Dies wäre jedoch ohne Anhalt am letzten Mahl und am Auftrag Jesu schwerlich zu erklären. Auch wenn wir den genauen Hergang und den genauen ursprünglichen Wortlaut dessen, was Jesus bei seinem letzten Mahl gesagt hat, nicht mehr in allen Einzelheiten rekonstruieren können, so lassen sich diese Berichte doch nicht einfach als nachträgliche Projektion aus der Praxis der Urgemeinde in die Situation des irdischen Jesus verstehen. Der Bericht des Markusevangeliums trägt deutlich unmittelbar historisch erzählende Züge; auch der von Paulus überlieferte Text geht auf eine sehr alte Überlieferung, die Paulus bereits in den Gemeinden vorfand, zurück. Vor allem der Ausblick auf das endgültige Kommen des Reiches Gottes (vgl. Mk 14,25; Lk 22,16.18) kann als ursprüngliches Wort des Herrn beim Letzten Abendmahl nicht bezweifelt werden.
So ergibt sich für das Verständnis der Eucharistie: Sowohl die Mähler des irdischen Jesus wie das Letzte Abendmahl und die eucharistischen Mähler der Urgemeinde stehen im Zeichen der kommenden Herrschaft Gottes. Die Feier der Eucharistie nimmt das himmlische Hochzeitsmahl (vgl. Offb 19,9) vorweg. Deshalb hat jede Eucharistiefeier österlichen Charakter. Wir feiern sie seit den Tagen der Urkirche vor allem am Sonntag als dem Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist (Erstes, Zweites und Drittes Hochgebet). So ist die Eucharistie vorwegnehmende Teilhabe an der himmlischen Liturgie und Vorgeschmack der künftigen Herrlichkeit. Sie ist Zeichen der Verheißung und der Hoffnung der neuen von aller Knechtschaft befreiten, verklärten Schöpfung. In ihr wird offenbar und in Zeichen vorweggenommen, was einmal sein wird, wenn Gott alles und in allem ist (vgl. 1 Kor 15,28). Wer deshalb vom eucharistischen Brot ißt, der hat schon jetzt das ewige Leben, und er wird auferweckt am Letzten Tag (vgl. Joh 6,54). Wie das Manna im Alten Bund ist die Eucharistie Speise und Wegzehrung des Gottesvolkes des Neuen Bundes (vgl. 1 Kor 10,3-4). Aber das Manna in der Wüste war nur ein Vorzeichen des wahren Gottesbrotes, das vom Himmel herabgestiegen ist und der Welt das Leben gibt (vgl. Joh 6,33). Wer von diesem Brot ißt, wird in Ewigkeit nicht sterben (vgl. Joh 6,49-50.58).
Weil wir in der Eucharistie die österliche Befreiung von der Macht des Todes und das Geschenk des neuen, des ewigen Lebens feiern, ist die Eucharistie mehr als ein bloßes Mahl. Sie ist ein "Opfer des Lobes" (Erstes Hochgebet; vgl. Hebr 13,15), in dem das eine Opfer Jesu am Kreuz vergegenwärtigt und die künftige Herrlichkeit vorweggenommen wird. Wir nennen sie deshalb schon seit dem 2. Jahrhundert Eucharistie, d. h. Danksagung. In ihr bringen wir Gott, dem Vater, Lob und Dank dar für alle Gaben der Schöpfung wie der Erlösung. Ihr Sinn ist darum Heil (schalom) und Leben in der Anbetung und Verherrlichung Gottes. Dieser Lobpreis kommt vor allem in der Präfation und im Sanctus zum Ausdruck. Am Schluß des Hochgebets wird er zusammengefaßt im Großen Lobpreis:
- "Durch ihn und mit ihm
- und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater,
- in der Einheit des Heiligen Geistes
- alle Herrlichkeit und Ehre
- jetzt und in Ewigkeit."
Ausdruck der eschatologischen Freude sind auch der Gesang, die Gewänder, die ganze Festlichkeit und Feierlichkeit, die künstlerische Gestaltung und der Schmuck bei der Feier der Eucharistie. Gerade in unserer auf Leistung, Nutzen und Durchsetzung bedachten Zeit sind innerweltlich zweckfreies Festen und Feiern wichtige Zeichen der neuen Welt, auf die wir hoffen. Gerade heute bedürfen wir einer erneuerten Sonntagskultur, in deren Mitte die Feier der Eucharistie steht (vgl. Gem. Synode, Gottesdienst 2). Wirkliche Festfeier, die mehr ist als Zerstreuung und Belustigung, setzt nämlich die Gewißheit voraus, daß die Macht des Bösen und des Todes überwunden ist. So gilt die Freude und die Danksagung bei der Eucharistie dem Pascha Jesu Christi, seinem Durchgang durch den Tod zum Leben, in den wir bei dieser Feier einbezogen werden. Dadurch wird uns bei der Eucharistie auch Mut und Hoffnung geschenkt, um in aller Schwachheit bis ans Ende in Leiden und Kämpfen durchzuhalten. Deshalb betete die Urkirche bei der Feier der Eucharistie:
- "Du, allmächtiger Herrscher, hast alles erschaffen um deines Namens willen, hast Speise und Trank gegeben den Menschen zum Genusse, damit sie dir danken; uns aber hast du gegeben geistliche Speise und Trank und ewiges Leben durch Jesus, deinen Knecht. Vor allem sagen wir dir Dank, daß du allmächtig bist. Dir sei Ehre in Ewigkeit!
- Gedenke, o Herr, deiner Kirche, sie zu erlösen aus allem Bösen und sie zu vollenden in deiner Liebe. Und führe sie heim von den vier Winden, die geheiligte, in dein Reich, das du ihr bereitet hast. Denn dein ist die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Es komme die Gnade und vergehe diese Welt! Hosanna dem Gotte Davids ... Marána tha (komm, Herr).Amen." (Did 10,3-6)
3.2 Die eucharistische Gegenwart Jesu Christi
Das von Jesus verkündete und verheißene Reich Gottes ist in Wort, Werk und Person Jesu Christi bereits Gegenwart geworden. Die feiernde Vorwegnahme des Reiches in der Eucharistie geschieht deshalb durch die Gegenwart Jesu Christi selbst.
Die Gegenwart Jesu Christi geschieht in der Eucharistiefeier in vielfacher Weise: Jesus Christus ist gegenwärtig in der feiernden Gemeinde. "Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen" (Mt 18,20). Gegenwärtig ist Jesus Christus in seinem Wort wie in der Person dessen, der den priesterlichen Dienst vollzieht. Denn Jesus Christus selbst ist es, der zu uns spricht, der uns zum eucharistischen Mahl einlädt, der in der Eucharistie handelt, sich dem Vater hingibt und sich uns schenkt. Jesus Christus ist in der Eucharistie aber vor allem dadurch gegenwärtig, daß das eucharistische Lobgebet als Segensgebet über Brot und Wein gesprochen wird und Jesus Christus kraft dieser Worte unter den eucharistischen Gestalten wahrhaft, wirklich und wesentlich gegenwärtig wird (vgl. SC 7). Diese wirkliche Gegenwart Jesu Christi ist das Herzstück der Eucharistie, deren Vorrang vor den anderen Sakramenten darin besteht, daß sie uns nicht nur die Frucht der Heilstat schenkt, sondern die Quelle des Heils, Jesus Christus selbst, in einer ganz besonderen Weise vergegenwärtigt.
Die wahre und wirkliche Gegenwart Jesu Christi unter den Gestalten von Brot und Wein ist nach der Glaubenslehre der Kirche begründet in dem Wort Jesu: "Das ist mein Leib" - "Das ist mein Blut" (Mk 14,22.24 par.). "Leib" meint im semitischen Sprachgebrauch nicht nur einen Teil am Menschen, sondern die ganze konkret-leibhaftige Person. Wenn es heißt: "Das ist mein Leib für euch" (1 Kor 11,24) bzw.: "Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird" (Lk 22,19), dann wird deutlich, daß es um die Gegenwart der Person Jesu Christi in ihrer Selbsthingabe für uns geht. Ähnlich meint das Wort "Blut" im Semitischen die Lebenssubstanz des Menschen. Das Blut, "das, für viele vergossen wird" (Mt 26,28), meint also Jesus selbst in seiner Lebenshingabe für uns. Indem die Kirche diese Worte des Herrn am Abend vor seinem Tod in seinem Auftrag wiederholt, berichtet sie nicht nur vom Letzten Abendmahl, sie verkündet vielmehr "den Tod des Herrn, bis er kommt" (1 Kor 11,26). Solche Verkündigung meint eine feierliche Ansage, die das wirkt, was sie sagt. So ist das Sprechen des Einsetzungsberichtes ein im Namen und in der Person Jesu Christi gesprochenes Segensgebet über Brot und Wein, durch welches unter den Gestalten von Brot und Wein Leib und Blut Jesu Christi, d. h. die konkret-leibhaftige Person Jesu Christi in ihrer Selbsthingabe für uns gegenwärtig wird.
Die Vergegenwärtigung Jesu Christi in der Eucharistie ist keine magische oder mechanische Handlung. Sie geschieht vielmehr durch ein im Namen Jesu Christi an Gott den Vater gerichtetes Gebet um die Gabe des Heiligen Geistes (Epiklese). Jesus hat ja zeit seines Lebens alles im Heiligen Geist getan; in ihm hat er sich vor allem zum Opfer dargebracht (vgl. Hebr 9,14). Durch den Heiligen Geist ist er bleibend in der Kirche und in der Welt gegenwärtig. Auch die eucharistische Gegenwart Jesu Christi geschieht in der Kraft des Heiligen Geistes. Darum betet der Priester, bevor er die Einsetzungsworte spricht:
- "Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus." (Zweites Hochgebet)
Im Lauf ihrer Geschichte mußte die Kirche die wirkliche Gegenwart Jesu Christi in der Eucharistie mehrfach verteidigen und zugleich tiefer klären. Bereits im ersten und im zweiten Abendmahlsstreit im 9. bzw. im 11. Jahrhundert hatte sich die Kirche gegen ein rein geistiges und rein symbolisches Verständnis der Eucharistie zur Wehr zu setzen. Auf der anderen Seite mußte sie sich damals ebenso gegen ein grob-sinnliches Mißverständnis abgrenzen, ähnlich wie es die Leute von Kafarnaum hatten, die meinten, man könne in der Eucharistie Christus empfangen, so wie man natürliches Brot ißt (vgl. Joh 6,52). Gegenüber beiden Mißverständnissen lehrte das IV. Laterankonzil (1215) die Wesensverwandlung von Brot und Wein in der Eucharistie. In den Auseinandersetzungen mit den Reformatoren im 16. Jahrhundert mußten diese Fragen in neuer Weise wieder aufgegriffen werden. Luther hielt zwar gegenüber dem rein symbolischen Verständnis von Zwingli entschieden an der wirklichen Gegenwart von Leib und Blut Jesu Christi "in und unter dem Brot und Wein" (Großer Katechismus) fest. Aber er verwarf die katholische Lehre von der Wesensverwandlung wegen der damit verbundenen begrifflichen Probleme und wandte sich gegen die Fortdauer der Gegenwart Jesu Christi über die Abendmahlsfeier hinaus, weil das Abendmahl für den Gebrauch der Gemeinde eingesetzt sei. Calvin lehnte auch die Gegenwart "in und unter Brot und Wein" ab und lehrte, der zum Himmel erhöhte Jesus Christus sei beim Empfang des Abendmahls durch den Heiligen Geist gegenwärtig. Erst in unserem Jahrhundert kam es zu einer gewissen Verständigung zwischen Lutheranern und Reformierten und zu einer gegenseitigen Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft (Leuenberger Konkordie). Eine ökumenische Annäherung, aber noch keine volle Übereinstimmung wurde auch zwischen der lutherischen und der katholischen Lehre erreicht (Das Herrenmahl; in einem größeren ökumenischen Kontext: das Lima-Dokument). Vor allem in der Frage der fortdauernden Gegenwart Jesu Christi besteht aber noch kein Konsens.
Gegenüber den im Laufe der Geschichte aufgetretenen Mißdeutungen mußte die Kirche die wahre, wirkliche und wesentliche Gegenwart Jesu Christi herausstellen und andererseits doch sagen, daß diese Gegenwart als "Geheimnis des Glaubens" ganz einmaliger und unvergleichlicher Art ist. Um zugleich die Wahrheit wie das Geheimnis der Gegenwart Jesu Christi in der Eucharistie festzuhalten, gebrauchten das IV. Laterankonzil (1215) und das Trienter Konzil (1551) den Begriff der Wesensverwandlung (Transsubstantiation). In jüngerer Zeit haben die Päpste Pius XII. und Paul VI. diese Ausdrucksweise verteidigt und bekräftigt (vgl. DS 3891; NR 617-620).
- "Sein Leib und Blut ist im Sakrament des Altares unter den Gestalten von Brot und Wein wahrhaft enthalten, nachdem durch Gottes Macht das Brot in den Leib und der Wein in das Blut wesensverwandelt sind."(DS 802; NR 920)
- Die Kirche lehrt und bekennt "offen und ohne Rückhalt, daß in dem erhabenen Sakrament der heiligen Eucharistie nach der Weihe (Konsekration) von Brot und Wein unser Herr Jesus Christus als wahrer Gott und Mensch wahrhaft, wirklich und wesentlich unter der Gestalt jener sichtbaren Dinge gegenwärtig ist." (DS 1636, NR 568)
- "Durch die Weihe von Brot und Wein vollzieht sich die Wandlung der ganzen Brotsubstanz in die Substanz des Leibes Christi, unseres Herrn, und der ganzen Weinsubstanz in die Substanz seines Blutes. Und diese Wandlung ist von der katholischen Kirche zutreffend und im eigentlichen Sinn Wesensverwandlung (transsubstantiatio) genannt worden." (DS 1642; NR 572)
Die Lehre von der Wesensverwandlung bei der Eucharistie will keine rationale Erklärung des nur im Glauben erfaßbaren Geheimnisses der Eucharistie sein. Sie will vielmehr gegen einseitige Auslegungen der Einsetzungsworte Jesu deren wörtliche Deutung wahren. Diese Lehre besagt, daß die wirkliche und wesenhafte Gegenwart Christi nicht das erfahrungsmäßige Erscheinungsbild von Brot und Wein (Größe, Geruch, Geschmack, chemische Zusammensetzung u. a.) verändert, daß man also die Gegenwart Christi in der Eucharistie auch nicht raumhaft verstehen darf. Der Glaube an die wirkliche Gegenwart Jesu Christi in der Eucharistie bezieht sich damit nicht auf den Bereich dessen, was der naturwissenschaftlichen Betrachtung zugänglich ist und was in den Naturwissenschaften als Substanz bezeichnet wird. Die Dinge sind ja schon natürlicherweise mehr als das, was man greifen, messen, berechnen kann. Die Gegenwart Christi betrifft das der menschlichen Erfahrung nicht zugängliche Wesen (Substanz) von Brot und Wein. Brot und Wein verlieren in der Eucharistie ihre natürliche Seins- und Sinnbestimmung als leibliche Nahrung und erhalten eine neue Seins- und Sinnbestimmung. Sie sind nun wirklichkeitserfüllte Zeichen der personalen Gegenwart und des personalen Sich-Schenkens Jesu Christi. In den sinnenhaften Zeichen von Brot und Wein verkörpert sich die sich uns mitteilende und schenkende Liebe Jesu Christi derart, daß unter diesen Gestalten Jesus Christus in seiner Hingabe "für uns" gegenwärtig ist. So will das Wort "Wesensverwandlung" festhalten, daß in der Eucharistie unter den Zeichen von Brot und Wein eine neue, die neue Wirklichkeit gegenwärtig wird.
Gottes Handeln in Jesus Christus geschieht ein für allemal. Dem entspricht die fortdauernde Gegenwart Jesu Christi in der Eucharistie über die eucharistische Feier hinaus. Die katholische Kirche hat an der fortdauernden eucharistischen Gegenwart Jesu Christi immer festgehalten. Das kommt vor allem in dem alten Brauch zum Ausdruck, die bei der eucharistischen Feier übriggebliebenen Elemente ehrfürchtig aufzubewahren und die Kommunion außerhalb der Eucharistiefeier den Kranken zu bringen (vgl. DS 1645; NR 574). Der ursprüngliche und primäre Sinn der Aufbewahrung der Eucharistie ist also die Krankenkommunion bzw. die Wegzehrung für die Sterbenden. Die Austeilung der hl. Kommunion außerhalb der Eucharistiefeier und die Verehrung und Anbetung des unterden eucharistischen Gestalten bleibend gegenwärtigen Herrn kommen erst in zweiter Linie hinzu. Zu diesen Formen eucharistischer Frömmigkeit außerhalb der Eucharistie gehören vor allem die eucharistische Anbetung, eucharistische Prozessionen, besonders das Fronleichnamsfest, sowie privates Gebet vor dem Allerheiligsten. Sie verbreiteten sich erst im Mittelalter und haben ihren Sinn in der Vorbereitung und in der Auswirkung der eucharistischen Feier, näherhin in der Kommunion (vgl. DS 1643; NR 573; SC 47). Werden diese Formen eucharistischer Frömmigkeit in diesem Zusammenhang verstanden, dann haben sie eine bleibende Bedeutung in der Kirche (vgl. DS 1644). Sie bedürfen deshalb im Leben jeder Gemeinde und jedes einzelnen Gläubigen der Pflege und der Verlebendigung.
Den wesentlichen Inhalt des eucharistischen Glaubens der Kirche hat Thomas von Aquin in den berühmten Fronleichnamshymnen "Lauda Sion" ("Lobe, Zion, deinen Hirten") (Gotteslob 545), "Pange, lingua" ("Das Geheimnis laßt uns künden") (Gotteslob 543-544) und "Adoro te devote" ("Gottheit tief verborgen") (Gotteslob 546 - Übertragung Petronia Steiner 1951) treffend zum Ausdruck gebracht:
- "Gottheit tief verborgen, betend nah ich dir. Unter diesen Zeichen bist du wahrhaft hier. Sieh, mit ganzem Herzen schenk ich dir mich hin, weil vor solchem Wunder ich nur Armut bin.
- Augen, Mund und Hände täuschen sich in dir, doch des Wortes Botschaft offenbart dich mir. Was Gott Sohn gesprochen, nehm ich glaubend an; er ist selbst die Wahrheit, die nicht trügen kann."
3.3 Die Eucharistie - Gedächtnis des Opfers Jesu Christi
Das Reich Gottes, das wir im eucharistischen Lobpreis vorwegnehmen und dessen Gabe wir schon jetzt in der Eucharistie vorauskostend empfangen, ist in der Menschwerdung, in Tod und Auferstehung Jesu Christi bereits angebrochen. Die Gegenwart Jesu Christi in der Eucharistie bedeutet deshalb nicht nur die Gegenwart seiner Person, sondern auch die Gegenwärtigsetzung seines Heilswerkes, besonders seines Kreuzesopfers. Dies ist gemeint, wenn wir vom Meßopfer bzw. vom Opfercharakter der Eucharistie sprechen.
Der Opfercharakter der Eucharistie wird im Neuen Testament angedeutet im Kelchwort des Matthäusevangeliums: "Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden" (Mt 26,28). Diese Aussage schließt sich engstens an den Bericht des Alten Testaments an, wonach Mose beim Sinaiopfer das Opferblut hälftig an den Altar, hälftig über das Volk mit den Worten sprengt: "Das ist das Blut des Bundes, den der Herr aufgrund all dieser Worte mit euch geschlossen hat" (Ex 24,8).
Um diese Aussagen tiefer zu verstehen, müssen wir sehen, daß schon die alttestamentlichen Propheten und erst recht das Neue Testament das kultische Opferverständnis der anderen Religionen grundlegend umgeprägt haben. Es geht ihnen nicht um äußere Opfergaben; diese können nur Zeichen der personalen Opferhingabe sein. In diesem Sinn läßt der Hebräerbrief Christus beim Eintritt in die Welt mit dem Psalm 40 sprechen: "Schlacht- und Speiseopfer hast du nicht gefordert, doch einen Leib hast du mir geschaffen, an Brand- und Sündopfern hast du kein Gefallen. Da sagte ich: Ja, ich komme - so steht es über mich in der Schriftrolle -, um deinen Willen, Gott, zu tun" (Hehr 10,5-7; vgl. Ps 40,7-9; 51,18-19). So bringt Jesus am Kreuz dem Vater nicht etwas dar, er bringt sich selber dar "als Gabe und als Opfer" (Eph 5,2). Im Unterschied zum Alten Testament bringt er auch nicht viele Opfer dar, sondern ein einziges Opfer, das ein für allemal gilt (vgl. Hebr 9,11-28; 10,10.14).
Die Gegenwärtigsetzung des einen Opfers Jesu Christi in der Eucharistie entspringt dem Auftrag des Herrn: "Tut dies zu meinem Gedächtnis!" (Lk 22,19; 1 Kor 11,24. vgl. 25). Gedächtnis meint im Sinne der Heiligen Schrift nicht nur ein Daran-Denken, sondern vielmehr das rühmende Erzählen der Großtaten Gottes, die durch die kultische Feier hier und heute gegenwärtig werden (vgl. Ex 13,3). In dieser Weise hat Israel im Paschamahl der Befreiung aus Ägypten gedacht. Das neutestamentliche Gedächtnis hat noch eine wesentlich tiefere Bedeutung. Die Kirche gedenkt im Lobopfer der Eucharistie durch Danksagung und durch die Zeichen von Brot und Wein der Befreiung von der Macht der Sünde und des Todes durch Kreuz und Auferstehung Jesu. Durch die Feier der Eucharistie verkünden wir also den Tod des Herrn (vgl. 1 Kor 11,26). So wird in der Eucharistie durch Wort und sakramentale Zeichen das Kreuzesopfer Jesu, ja das ganze Heilswerk Jesu Christi sakramental gegenwärtig.
Die eucharistischen Hochgebete bringen diesen Aspekt nachdrücklich zur Geltung. Unmittelbar nach dem Einsetzungsbericht ruft die liturgisch versammelte Gemeinde bzw. spricht der Priester:
- "Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit."
- "Darum, gütiger Vater, feiern wir ... das Gedächtnis deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine Auferstehung von den Toten und seine glorreiche Himmelfahrt. So bringen wir aus den Gaben, die du uns geschenkt hast, dir ... die reine, heilige und makellose Opfergabe dar."
(Erstes Hochgebet)
Der Zusammenhang zwischen Kreuzesopfer und Meßopfer wurde im späten Mittelalter vielfach nicht mehr richtig verstanden; das Verständnis des Meßopfers war zudem durch Mißbräuche verdunkelt. Das führte die Reformatoren zu einer grundsätzlichen Leugnung des Opfercharakters der Eucharistie. Sie meinten, mit dieser Lehre sei die Einmaligkeit des Kreuzesopfers in Frage gestellt, und bezeichneten die Messe deshalb als den größten und schrecklichsten Greuel (Schmalkaldische Artikel) und als eine vermaledeite Abgötterei (Heidelberger Katechismus). Dem Konzil von Trient, das sich mit diesen massiven Angriffen auseinandersetzen mußte, gelang es, den entscheidenden Kerngedanken wieder gültig zu formulieren. Es hielt an der Einmaligkeit des Kreuzesopfers fest und drückte den Bezug zu Kreuzesopfer und Meßopfer mit Hilfe von drei Begriffen aus: Das Meßopfer ist sakramentale Vergegenwärtigung, Gedächtnis und Zuwendung des Kreuzesopfers (vgl. DS 1740; NR 597). Die Eucharistie ist also kein neues und kein eigenständiges Opfer, welches das Kreuzesopfer ersetzt oder auch nur ergänzt. Sie ist die sakramentale Gegenwärtigsetzung des ein für allemal geschehenen Opfers am Kreuz.
- "Denn es ist ein und dieselbe Opfergabe, und es ist derselbe, der jetzt durch den Dienst der Priester opfert und der sich selbst damals am Kreuz darbrachte, nur die Art der Darbringung ist verschieden." (DS 1743; NR 599)
Heute gibt es ökumenische Ansätze, um die alten Polemiken und Mißverständnisse in dieser Frage abzubauen und ein gegenseitiges Verständnis aufzubauen (vgl. Das Herrenmahl; Lima-Dokument; Bericht des Ökumenischen Arbeitskreises "Das Opfer Jesu Christi und der Kirche"; "Kirchengemeinschaft in Wort und Sakrament"). Dabei hat sich vor allem ein erneuertes Verständnis des biblischen Gedankens des Gedächtnisses (memoria) als Gegenwärtigsetzung einer vergangenen Heilstat als hilfreich erwiesen. Dieser Gedanke ist in den liturgischen Texten zentral; er wurde vom II. Vatikanischen Konzil aufgegriffen (vgl. SC 47; AG 14):
Die eigentliche ökumenische Frage ist, ob und inwiefern die Eucharistie als sakramentale Gegenwärtigsetzung des einen und einmaligen Opfers Jesu Christi zugleich Opfer der Kirche ist. Nach katholischem Verständnis zieht uns Jesus Christus, weil wir durch die Taufe mit ihm verbunden sein Leib sind, auch in sein Opfer hinein: Da die christliche Gemeinde durch die Taufe in das Pascha-Mysterium Christi eingefügt ist (vgl. SC 6), kann und soll sie sich selbst als lebendiges und heiliges Opfer darbringen (vgl. Röm 12,1; SC 48). Im eucharistischen Hochgebet beten wir darum: "Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt" (Drittes Hochgebet). In der Eucharistie bringt der erhöhte Herr sein Opfer durch den Dienst der liturgisch versammelten Gemeinde und durch ihr Opfer des Lobes dar. So ist die Eucharistie "in, mit und durch Christus" zugleich Opfer der Kirche: Das Lob- und Dankopfer der versammelten Gemeinde ist sozusagen die sakramentale Gestalt für die Gegenwart des einen Opfers Jesu Christi: Damit ist die Eucharistie Zusammenfassung, Höhepunkt und Erfüllung des Gottesdienstes des christlichen Lebens; sie ist höchster Ausdruck unserer Gottesverehrung wie Quelle des Einsatzes unseres Lebens für die Brüder und Schwestern. Doch dies ist nur möglich, weil wir in der Eucharistie "ein Leib und ein Geist werden in Christus" (Drittes Hochgebet):
Durch die sakramentale Gegenwärtigsetzung des einen Opfers Jesu Christi in der liturgischen Feier und durch sie ist die Eucharistie als Lobopfer zugleich auch Bitt- und Sühneopfer. Sie wird ja begangen "zur Vergebung der Sünden" (Mt 26,28). Sie tilgt die alltäglichen Sünden und hilft, schwere Sünden zu meiden. Sie kann fürbittend für alle Menschen gefeiert werden. Diese eucharistische Gebetspraxis wird bereits in der alten Kirche, nicht zuletzt in den altchristlichen Katakomben bezeugt. Bis heute findet sich in den eucharistischen Hochgebeten das Gedächtnis der Lebenden und der Toten: Jede Eucharistiefeier geschieht ja innerhalb der gesamten "Gemeinschaft der Heiligen": Sie kann deshalb stellvertretend und fürbittend für alle Glieder am Leib Christi gefeiert werden. Aus demselben Grund gedenken wir bei der Feier der Eucharistie auch der Glieder des Leibes Christi, die der himmlischen Seligkeit teilhaftig geworden sind, der Heiligen. Wenn wir die Eucharistie zu ihrer Ehre feiern, dann tun wir es in dem Sinn, daß wir Gott für die Gnade und Verherrlichung danken, die er ihnen geschenkt hat. Zugleich empfehlen wir uns dabei ihrer Fürbitte und ihrem Schutz.
3.4 Die Eucharistie - Sakrament der Einheit und der Liebe
Die Feier der Eucharistie, Vorfeier des himmlischen Hochzeitsmahles, kommt im eucharistischen Mahl zum Abschluß und zur Vollendung. Dieser Aspekt kommt seit der nachkonziliaren Liturgiereform deutlicher zum Ausdruck. Durch die veränderte Stellung des Altars und die dadurch ermöglichte, zum Volk hingewandte Feier der Eucharistie versammelt sich die Gemeinde um den Altar ähnlich wie um einen Tisch. Diese Formen sind Sinnbild für das innere Geschehen bei der Eucharistie: die Vereinigung des einzelnen mit Jesus Christus und die Vereinigung untereinander in Jesus Christus.
Die Frucht des Empfangs der Eucharistie in der Kommunion ist vor allem die innigste Vereinigung mit Jesus Christus. Durch das Verzehren der eucharistischen Gestalten geht Christus ganz in uns und wir gehen ganz in ihn ein.
- "Wer mein Fleisch ißt und mein Blut trinkt, der bleibt in mir, und ich bleibe in ihm." (Joh 6,56)
Was die leibliche Speise für das leibliche Leben bedeutet, das wirkt der Empfang der Eucharistie für das geistliche Leben: Sie erhält, steigert, erneuert und erfreut es (vgl. DS 1322; NR 566). Durch die Christusgemeinschaft in der Kommunion wird das neue Leben der Gnade in uns vermehrt, werden die Krankheiten der Sünde geheilt und werden wir mit Kraft zum Widerstand gegen die Sünde gestärkt. Zugleich empfangen wir in der Kommunion das Unterpfand der himmlischen Seligkeit und der künftigen Unsterblichkeit (vgl. Joh 6,54). Deshalb heißt es in der Magnifikat-Antiphon des Fronleichnamsfestes: "O heiliges Mahl, in dem Christus unsere Speise ist: Gedächtnis seines Leidens, Fülle der Gnade, Unterpfand der künftigen Herrlichkeit" (vgl. SC 47).
Lehre und Praxis der Kirche unterscheiden eine zweifache Weise der Kommunion: die zugleich sakramentale und geistliche Kommunion, bei der der Leib Christi leiblich empfangen und zugleich mit bereitem Herzen aufgenommen wird, und die rein geistliche Kommunion, die Vereinigung mit Jesus Christus durch das gläubige Verlangen nach der Kommunion (vgl. DS 1648). Der unwürdige Empfang der Kommunion durch den Sünder, dessen Herz nicht für die Vereinigung mit Jesus Christus bereitet ist, wirkt nicht das Heil, sondern das Gericht.
Für einen geistlich fruchtbaren Empfang der Kommunion sind deshalb eine Prüfung des Gewissens und eine sorgfältige Vorbereitung notwendig. Der Apostel Paulus mahnt: "Wer also unwürdig von dem Brot ißt und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und Blut des Herrn. Jeder soll sich selbst prüfen; erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer davon ißt und trinkt, ohne zu bedenken, daß es der Leib des Herrn ist, der zieht sich das Gericht zu, indem er ißt und trinkt" (1 Kor 11,27-29). In der (östlichen) Chrysostomos-Liturgie ruft der Priester vor der Spendung der Kommunion den Gläubigen zu: "Das Heilige den Heiligen". So ist der Christ, der im Stand der schweren Sünde ist, gehalten, bevor er zur Kommunion geht, nach Möglichkeit zuerst das Sakrament der Buße zu empfangen (vgl. DS 1646-1647). Aus demselben Grund beginnt jede Feier der Eucharistie mit einem Bußakt zur Vergebung der alltäglichen Sünden. Wichtig ist vor allem die Versöhnung mit den anderen (vgl. Mt 5,23-24). Aber auch die früher strenge, heute sehr gelockerte Nüchternheit vor dem Empfang der Eucharistie dient der würdigen Vorbereitung. Wer zum Empfang vortritt, antwortet auf das Wort des Priesters "Leib Christi" mit "Amen". Er sagt damit: "Ja, ich glaube, ich bin im Glauben bereit, den Leib Christi zu empfangen."
Der Empfang der Eucharistie in der Kommunion ist ein integrierender Teil der eucharistischen Feier. Deshalb sollen die Gläubigen nach der Kommunion des Priesters aus derselben Opferfeier den Herrenleib entgegennehmen (vgl. SC 55). Außerdem wird mit Nachdruck empfohlen, daß die Gläubigen in der Feier der Eucharistie selbst die hl. Kommunion empfangen. Aus einem gerechten Grund kann die Kommunion jedoch auch außerhalb der Eucharistiefeier gespendet werden; das gilt vor allem für die Krankenkommunion. Eigene Kommunionfeiern mit oder ohne Priester außerhalb der Feier der Eucharistie sollten freilich auf seltene Notfälle beschränkt bleiben (vgl. Gem. Synode, Gottesdienst 2.4.3; Gotteslob 370).
Die Häufigkeit der Kommunion hat geschichtlich große Schwankungen durchgemacht. In der frühen Kirche war die sonntägliche Kommunion die Regel. Als es im Mittelalter zu einem starken Rückgang der Kommunionhäufigkeit kam, schrieb das IV. Laterankonzil (1215) als Minimum die jährlich einmalige Kommunion vor. Dieses Kirchengebot gilt bis heute (vgl. CIC can. 920). Das Trienter Konzil wünschte jedoch, die Gläubigen möchten, wenn sie der Eucharistie beiwohnten, auch sakramental kommunizieren. Einen Umbruch brachte aber erst Papst Pius X. mit seinen Dekreten über die tägliche Kommunion (1905) und über die rechtzeitige Kommunion der Kinder (1910). Sie führten zu einem beträchtlichen Anstieg der Kommunionhäufigkeit. Selbstverständlich ist die rein quantitative Vermehrung des Kommunionempfangs kein sinnvolles pastorales und spirituelles Ziel. Maßstab muß der im Glauben verantwortete, geistlich fruchtbare Empfang sein, dessen Häufigkeit normalerweise im Zusammenhang mit der Intensität des sonstigen religiösen Lebens eines Christen steht. Für die große Mehrheit der Gläubigen wird die sonntägliche Kommunion das pastoral mögliche Ziel bleiben.
Bis zum 12. Jahrhundert war die Kommunion unter beiden Gestalten üblich; sie kam erst im 13./14. Jahrhundert allmählich außer Übung. Als die Böhmischen Brüder und die Reformatoren die Kommunion unter beiden Gestalten auf ein direktes göttliches Gebot zurückführten und sie als heilsnotwendig erklärten, wiesen die Konzilien von Konstanz und Trient diese Meinung zurück mit der Begründung, Jesus Christus sei unter jeder der beiden Gestalten ganz gegenwärtig (vgl. DS 1198-1200; 1725-34; NR 561; 588-595). Das Il. Vatikanische Konzil hat jedoch unbeschadet dieser dogmatischen Lehre die Kommunion unter beiden Gestalten grundsätzlich wieder ermöglicht (vgl. SC 55). Sie ist bei besonderen Anlässen gestattet (Erwachsenentaufe und -firmung, Brautmesse, Eucharistiefeier bei einer Weihe, Wegzehrung, Exerzitien u. a.). Bei der Kommunion unter beiden Gestalten kommt das Zeichen des eucharistischen Mahles und seiner Beziehung zum eschatologischen Mahl im Reiche Gottes besser zum Vorschein; zugleich wird klarer ausgedrückt, daß der Neue Bund im Blut Jesu Christi geschlossen wurde.
Die Frage, ob Hand- oder Mundkommunion, sollte kein grundsätzliches Problem sein. Bis zum 9. Jahrhundert war es im allgemeinen üblich, die Kommunion stehend in die Hand zu empfangen. Für die spätere Praxis, sie mit dem Mund zu empfangen, waren u. a. Gründe der Ehrfurcht maßgebend. Aber auch die Handkommunion kann Zeichen der Ehrfurcht sein. Das zeigt der hl. Cyrill von Jerusalem (4. Jh.), der in seinen Katechesen zur Kommunionvorbereitung beschreibt, wie die in Kreuzform übereinandergelegten Hände der Thron für den Empfang des Königs sind. Schließlich sollten wir nicht vergessen, daß wir mit der Zunge ebenso sündigen wie mit der Hand und auch mit dem Herzen. Deshalb sollen wir in dieser Frage die Entscheidung des anderen respektieren.
Die Eucharistie bezeichnet und bewirkt nicht nur die Einheit des einzelnen Gläubigen mit Christus, sondern auch die Einheit aller Gläubigen, die Einheit der Kirche in Jesus Christus. Durch die Teilnahme an dem einen eucharistischen Leib Christi werden wir zu dem einen Leib Christi, der die Kirche ist, zusammengefügt.
- "Ein Brot ist es. Darum sind wir viele ein Leib, denn wir alle haben teil an dem einen Brot." (1 Kor 10,17)
Die Kirchenväter sehen in der Bereitung des Brotes aus vielen Körnern und des Weines aus vielen Beeren ein Sinnbild der durch die Kommunion bewirkten Vereinigung aller Gläubigen zum einen Leib Christi. Im Anschluß an den hl. Augustinus bezeichnet die Lehre der Kirche die Eucharistie als "Zeichen der Einheit" und als "Band der Liebe" (vgl. DS 1635; NR 567; SC 47; LG 26). Der hl. Thomas von Aquin spricht von der Eucharistie als "Sakrament der kirchlichen Einheit". Sie setzt das Stehen in der Einheit der Kirche voraus, bezeichnet und vertieft es zugleich.
Da die Eucharistie das Sakrament der Einheit ist, ist die Feier der Eucharistie Sache der gesamten versammelten Gemeinde. Deshalb sollen die Gläubigen der eucharistischen Feier nicht wie stumme Zuschauer beiwohnen. Sie sollen die Eucharistie tätig mitfeiern, d. h. sie sollen das Geheimnis der Eucharistie zu verstehen suchen, die liturgische Handlung bewußt, fromm und tätig mitfeiern und sich diese innerlich zu eigen machen, indem sie sich selbst Gott als Opfer darbringen (vgl. SC 48). Aus der Lehre, daß die Eucharistie das Sakrament der Einheit ist, folgt freilich auch, daß sie allein durch den gültig geweihten Priester gültig gefeiert werden kann (vgl. DS 802, 1771;NR 920; 713). Das priesterliche Amt ist ja Dienst an der Einheit. Allein der Priester ist durch die Priesterweihe bevollmächtigt, im Namen und in der Person Jesu Christi zu sprechen: "Das ist mein Leib" - "Das ist mein Blut". Neben dem priesterlichen Dienst soll es bei der Eucharistie nach Möglichkeit aber auch eine Vielzahl anderer Dienste geben: den Dienst des Diakons, des Lektors, des Akolythen, des Kantors u. a. Diese Einheit von priesterlichem Dienst und tätiger Mitfeier der Gemeinde kommt im eucharistischen Hochgebet zum Ausdruck: "Darum, gütiger Vater, feiern wir, deine Diener und dein heiliges Volk, das Gedächtnis deines Sohnes..." (Erstes Hochgebet).
Die Eucharistiefeier einer einzelnen Gemeinde geschieht wesensgemäß immer in Gemeinschaft mit der gesamten Kirche. Das konkrete Kriterium der Gemeinschaft in der Kirche ist die Einheit mit dem Ortsbischof, der selbst mit den anderen Bischöfen und mit dem Bischof von Rom, dem Mittelpunkt der katholischen Einheit, verbunden ist. Dieser Zusammenhang kommt im eucharistischen Hochgebet dadurch zum Ausdruck, daß der Name des Ortsbischofs wie der Name des Papstes genannt wird. Wer die Eucharistie außerhalb dieser Gemeinschaft feiert, sich von ihr absondert und trennt, der kehrt - wie die Väter sagen - Altar gegen Altar. Abbruch der Eucharistiegemeinschaft ist Abbruch der Kirchengemeinschaft; umgekehrt gehören Eucharistie- und Kirchengemeinschaft unlöslich zusammen. Deshalb mahnt schon der Märtyrerbischof Ignatius von Antiochien: "Seid deshalb bedacht, eine Eucharistie zu gebrauchen." "Haltet zum Bischof und zum Presbyterium und den Diakonen! ... Tut nichts ohne den Bischof!" "Jene Eucharistiefeier gelte als zuverlässig, die unter dem Bischof oder einem von ihm Beauftragten stattfindet."
Die eucharistische Feier setzt Versöhnung und Gemeinschaft innerhalb der feiernden Gemeinde voraus und fordert sie zugleich. Dies kommt vor allem im liturgischen Friedensgruß zum Ausdruck. Aus demselben Grund fand die eucharistische Tischgemeinschaft in der alten Kirche ihre Fortsetzung in einer gemeindlichen Mahlgemeinschaft (Agape). Dieser Brauch wird heute den gewandelten Umständen entsprechend in vielfältigen Formen zu Recht wieder aufgenommen. Die durch die Eucharistie bezeichnete Einheit der Kirche ist aber ihrerseits Zeichen und Werkzeug der Einheit der Menschheit. Die Eucharistie ist Brot für das Leben der Welt (vgl. Joh 6,33). Deshalb muß sich die Eucharistie über die Gemeinde hinaus in die Welt hinein auswirken. Dies kommt vor allem in den Fürbitten für alle Menschen, besonders für die Notleidenden zum Ausdruck, ebenfalls in den Kollekten für ärmere Gemeinden und für die Armen in der Welt, die innerhalb der Eucharistie von alters her ihren festen Platz haben. Darüber hinaus rüstet und sendet uns die Feier der Eucharistie zum Dienst der Liebe und zur Tat der Versöhnung unter allen Menschen. Wir können das eucharistische Brot nicht teilen, wenn wir nicht bereit sind, auch das tägliche Brot zu teilen und uns für eine gerechte und brüderliche Ordnung in der Welt einsetzen. Damit ist die Eucharistie die Quelle des christlichen Dienstes in der Welt.
Aus dem Gesagten ergibt sich die Antwort auf das schwierige Problem der Eucharistiegemeinschaft zwischen den getrennten Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften. Die Trennung am Tisch des Herrn wird heute von vielen Christen,
besonders von Christen, die in einer bekenntnisverschiedenen Ehe leben oder in ökumenischen Kreisen engagiert sind, schmerzlich erfahren. In der Tat, wenn die Eucharistie das Sakrament der Einheit und der Liebe ist, dann stellt die Trennung am Tisch des Herrn ein Ärgernis dar, zu dessen Überwindung wir alles in unserer Macht Stehende tun müssen. Andererseits steht die Eucharistie nicht zu unserer Verfügung. Sie ist als Vermächtnis des Herrn ein "Geheimnis des Glaubens", das den gemeinsamen Glauben voraussetzt, und sie ist als Sakrament der Einheit an die Einheit der Kirche gebunden. Wo der gemeinsame Glaube oder die Einheit der Kirche fehlen, ist vom Wesen der Sache her eine gemeinsame Teilhabe am Tisch des Herrn nicht möglich.
Da aber die Eucharistie sowohl Zeichen der Einheit wie Quelle der Gnade ist (vgl. UR 8; LG 3; 11), kann die Kirche einzelnen getrennten Brüdern und Schwestern den Zutritt zu diesem Sakrament in Todesgefahr sowie in anderen schweren Notlagen erlauben, wenn dies in ihrer eigenen Kirche nicht möglich ist und wenn sie von sich aus darum bitten, sofern sie in bezug auf das Sakrament der Eucharistie den katholischen Glauben bekunden und in rechter Weise disponiert sind (vgl. CIC can. 844). Bei diesen schwierigen Situationen ist zwischen dem Gesichtspunkt der Eucharistie als Zeichen der vollen Kirchengemeinschaft und als Mittel des Heils für den einzelnen gewissenhaft abzuwägen. Dabei muß man, weil dem Wesen der Eucharistie zutiefst zuwider, jedes Ärgernis zu vermeiden suchen.
Zusätzliche Probleme gibt die Frage der Gegenseitigkeit bei der Zulassung zur Kommunion auf. Im Verhältnis zu den Ostkirchen, die ein gültiges Bischofsund Priesteramt bewahrt haben, ist eine solche Gegenseitigkeit möglich. Deshalb können katholische Christen, denen es physisch oder moralisch unmöglich ist, die Kommunion in der katholischen Kirche zu empfangen, diese in der orthodoxen Kirche empfangen (vgl. OE 26-28; UR 15). Da die aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften vor allem wegen des Fehlens oder der Unvollständigkeit des Weihesakraments die ursprüngliche und vollständige Wirklichkeit des eucharistischen Geheimnisses nicht bewahrt haben (vgl. UR 22), ist bei ihnen eine solche Gegenseitigkeit nicht möglich (vgl. CIC can. 844).
Damit tun sich heute viele Christen schwer. Diese schmerzliche Situation läßt sich nicht durch spektakuläre Aktionen oder durch ein rein pragmatisches Verhalten lösen. Vorschnelle Lösungen könnten den Ansporn nehmen, die volle Kirchengemeinschaft zu suchen. Allein ernstes Bemühen und beharrliches Beten können weiterhelfen. Wir können das Problem nur von der Wurzel der Trennung her überwinden, indem wir uns, soweit dies menschenmöglich ist, um die Einheit im Glauben mühen. Wenn wir die Kraft haben, diese leidvolle Situation im Geist des Gebets und der Buße zu ertragen, und wenn wir zugleich alles uns Mögliche an Schritten der Versöhnung tun, dann dürfen wir hoffen, daß uns die Gnade der Einheit am Tisch des Herrn eines nicht fernen Tages geschenkt wird.
Eine Hilfe auf dem Weg zur Eucharistiegemeinschaft sind ökumenische Wortgottesdienste, in denen wir als Christen die Einheit suchen, unseren gemeinsamen Glauben bekennen und füreinander und für alle Menschen beten. Solche ökumenischen Wortgottesdienste können die sonntägliche Eucharistiefeier nicht ersetzen. Sie sollen aber nach Möglichkeit zur Gottesdienstordnung jeder Gemeinde gehören (vgl. UR 8; Gem. Synode, Gottesdienst 5.2).
3.5 Struktur, Elemente und Teile der Eucharistiefeier
Die Feier der Eucharistie besteht in gewisser Hinsicht aus zwei Teilen, dem Wortgottesdienst und der Eucharistiefeier im engeren Sinn. Beide Teile sind so eng miteinander verbunden, daß sie eine einzige Gottesdienstfeier bilden (vgl. SC 56). Denn in der Eucharistie wird der Tisch des Gotteswortes und des Herrenleibes bereitet (vgl. DV 21). Dazu kommen noch die liturgische Eröffnung und der liturgische Abschluß der Eucharistiefeier. Daraus ergibt sich die folgende Struktur:
A. Die Eröffnung: Einzug, Begrüßung, Allgemeines Schuldbekenntnis, Kyrie, Gloria und Tagesgebet. Dieser Teil dient der Einführung und Vorbereitung der ganzen Feier.
B. Der Wortgottesdienst: Der Kern des Wortgottesdienstes besteht aus den Schriftlesungen mit dem Antwortpsalm (Zwischengesang). Homilie, Glaubensbekenntnis und Fürbitten entfalten diesen Teil und schließen ihn ab. In den Lesungen, die in der Homilie ausgelegt werden, spricht Gott zu seinem Volk und nährt das Leben im Geist. Jesus Christus selbst ist in seinem Wort inmitten der Gläubigen gegenwärtig. Der Antwortpsalm stellt die Antwort der Gemeinde dar; im Halleluja-Vers wird der in der Verkündigung des Evangeliums gegenwärtige Herr begrüßt. Im Glaubensbekenntnis stimmt die Gemeinde dem Wort Gottes, wie sie es in den Lesungen und in der Homilie gehört hat, zu. In den Fürbitten übt die Gemeinde durch ihr Beten für alle Menschen, besonders für die Notleidenden, ihr priesterliches Amt aus.
C. Die Eucharistiefeier im engeren Sinn: Sie besteht wiederum aus drei Teilen: Gabenbereitung, eucharistisches Hochgebet, Kommunion.
Bei der Gabenbereitung werden unter Gesang und Gebet Brot und Wein sowie Wasser zum Altar gebracht.
Im eucharistischen Hochgebet, dem Gebet der Danksagung und der Heiligung, erreicht die ganze Feier ihre Mitte und ihren Höhepunkt. Als wichtigste Elemente gelten: Die Danksagung für das gesamte Werk der Erlösung. Sie findet in der Präfation ihre stärkste Ausprägung. Im Sanctus-Ruf stimmt die gesamte Gemeinde ein und vereinigt sich in ihrem Lobpreis mit den himmlischen Mächten. In der Epiklese bittet die Kirche den Vater, den Heiligen Geist auf die Gaben herabzusenden, damit sie durch ihn zu Leib und Blut Jesu Christi werden. Im Einsetzungsbericht (Konsekration) werden durch Christi Wort und Tun sein Leib und sein Blut unter den Gestalten von Brot und Wein Gegenwart und sein ein für allemal dargebrachtes Opfer am Kreuz sakramental gegenwärtig gesetzt. In der anschließenden Anamnese (Erinnerung) gedenkt die Kirche deshalb des Leidens, der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu Christi; im Darbringungsgebet bringt sie durch Jesus Christus im Geist die Opfergabe dem Vater dar; in der Kommemoration und Interzession bringt sie zum Ausdruck, daß sie die Eucharistie in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche und der gesamten Gemeinschaft der Heiligen begeht. Die Schlußdoxologie bringt die preisende Verherrlichung Gottes nochmals zusammenfassend zum Ausdruck und wird durch die Akklamation der Gemeinde bekräftigt und abgeschlossen.
Die Kommunion wird durch das Gebet des Herrn eröffnet. Der Friedensgruß und das Brechen des Brotes zeigen, daß wir an dem einen Brot teilnehmen und so zu dem einen Leib Christi zusammengeschlossen werden. Deshalb endet auch das begleitende Agnus Dei mit der Bitte "Gib uns deinen Frieden". Die Kommunion selbst wird mit dem Schlußgebet, der Bitte um einen fruchtbaren Empfang, abgeschlossen.
D. Der Abschluß: Gruß und Segen des Priesters sowie Entlassung schließen die Eucharistiefeier ab und lassen die Teilnehmer unter Danksagung in den christlichen Alltag zurückkehren.
4. Das Sakrament der Buße
4.1 Die persönliche Buße
Durch Taufe und Firmung sind wir neue Schöpfung geworden; durch die Eucharistie werden wir auf die innigste Weise mit Jesus Christus und untereinander verbunden. Dennoch erfahren wir auf schmerzliche Weise immer wieder, daß wir hinter dem Anspruch Jesu Christi zurückbleiben, ja uns sogar in Widerspruch stellen zu dem, was wir als Christen sind und nach Gottes Willen tun sollen. Statt uns vom Geist Christi führen zu lassen, folgen wir immer wieder "dem Geist dieser Welt". Doch Gottes Barmherzigkeit ist größer als alle Sünde und Schuld. Deshalb bietet Gott denen, die nach der Taufe in schwere Sünde gefallen sind, eine zweite Möglichkeit der Umkehr und der Gnade an: das Sakrament der Buße. Die Kirchenväter sprechen öfter von einer zweiten mühsamen Taufe und einer zweiten Planke des Heils nach dem Schiffbruch der Sünde.
Die Haltung und das Sakrament der Buße sind heute freilich in eine tiefe Krise geraten. Dabei spielen vielfältige Ursachen eine Rolle, auch manches Mißverständnis und manche unfrei und unfroh machende Erfahrung beim Beichten. Vor allem aber tun sich heute viele Menschen schwer, das eigene Versagen als Schuld vor Gott, d.h. als Sünde zu erkennen. Oft wird sogar nicht mehr von persönlicher Schuld gesprochen. Schuld und Versagen suchen wir, wenn überhaupt, meist nur bei "den anderen", bei den Gegnern, bei der Vergangenheit, der Natur, der Veranlagung, beim Milieu, den Verhältnissen u. a. Wo aber der Mensch die Verantwortung für sich und seine Taten nicht mehr anerkennt, da ist das Humanum selbst in Gefahr (vgl. Gem. Synode, Unsere Hoffnung 1,5; Schwerpunkte heutiger Sakramentenpastoral C 1).
Diese Situation ist um so bedenklicher, als bei Jesus der Ruf zur Umkehr ganz im Zentrum seiner Botschaft vom nahegekommenen Reich Gottes steht. Zur Verkündigung Jesu gehört nach dem Evangelisten Markus der Ruf: "Kehrt um, und glaubt an das Evangelium!" (Mk 1,15). Umkehr und Buße gehören also unabdingbar zu jedem christlichen Leben. "Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen" (Mt 18,3). Dieser Umkehr bedürfen nach der Verkündigung Jesu alle, auch die Gerechten, die meinen, es nicht nötig zu haben, umzukehren. "Wenn wir sagen, daß wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre, und die Wahrheit ist nicht in uns" (1 Joh 1,8).
Wenn Jesus von Umkehr spricht, dann denkt er in der Tradition der alttestamentlichen Propheten nicht in erster Linie an äußere Werke wie Buße in Sack und Asche, unter Fasten, Kasteiungen, Weinen und Klagen; er denkt aber auch nicht nur an innere Einkehr, Besinnung und Sinnesänderung. Das alles können sinnvolle Ausdrucksformen der Umkehr sein. Jesus sagt uns aber, daß wir unser Fasten nicht zur Schau stellen sollen durch ein finsteres Gesicht und ein trübseliges Aussehen (vgl. Mt 6,16). Das Entscheidende bei der Umkehr geschieht im Herzen des Menschen, d. h. in der Mitte und Tiefe seiner Person.
- "Kehrt um zu mir von ganzem Herzen,
- mit Fasten, Weinen und Klagen.
- Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider,
- und kehrt um zum Herrn, eurem Gott!"
- (Joël 2,12-13)
Die Umkehr muß sich aber im Tun des Guten und in der konkreten Erfüllung des Willens Gottes auswirken, besonders der Forderungen der Gerechtigkeit und der Liebe. Es gibt keine Umkehr zu Gott ohne Bekehrung zu den Brüdern und Schwestern. So mahnt der Prophet:
- "Wascht euch, reinigt euch!
- Laßt ab von eurem üblen Treiben!
- Hört auf, vor meinen Augen Böses zu tun!
- Lernt, Gutes zu tun!
- Sorgt für das Recht!
- Helft den Unterdrückten!
- Verschafft den Waisen Recht,
- tretet ein für die Witwen!"
- (Jes 1,16-17)
Das Wesentliche an der Buße besteht also bei Jesus wie schon bei den Propheten im Alten Testament und bei Johannes dem Täufer in einer wirklichen Umkehr, d. h. einer grundsätzlichen Richtungsänderung des Menschen, in der Abkehr vom Bösen und in der Hinwendung zu Gott. In der Umkehr muß der Mensch von den trügerischen Götzen, mit denen er sein Dasein sichern und erfüllen zu können meinte, lassen und in Gott allein Halt und Inhalt seines Lebens suchen. Umkehr und Glaube sind deshalb zwei Seiten ein und derselben Sache.
Doch schon die Propheten machten die Erfahrung, daß das Herz des Menschen schwerfällig und verhärtet ist. Umkehr setzt deshalb voraus, daß Gott dem Menschen ein neues Herz schenkt (vgl. Jer 24,7; 31,33). Die Umkehr ist nicht unser Werk und unsere Leistung, sondern Gottes Geschenk; sie ist die Gnade des neuen Anfangen-Dürfens. Gott muß sich in gnädigem Erbarmen zuerst dem Menschen zuwenden, damit dieser sich zu Gott hinwenden kann. Unsere Bekehrung hat also nicht den Sinn, Gott umzustimmen und zu versöhnen; im Gegenteil, sie ist immer Antwort auf Gottes vorausgehende Versöhnung. Die endgültige Tat der Versöhnung geschah dadurch, daß Jesus sein Blut vergossen hat "für viele ... zur Vergebung der Sünden" (Mt 26,28). So hat Gott in Jesus Christus, in seinem Kreuz und in seiner Auferstehung ein für allemal die Welt mit sich versöhnt (vgl. 2 Kor 5,18-19) und Frieden gestiftet durch Christi Blut (vgl. Kol 1,20).
Solche Umkehr geschieht grundlegend in der Taufe, dem Sakrament der Umkehr und der Vergebung der Sünden (vgl. Apg 2,38). Die Taufe bedeutet eine Absage an das Böse und eine Hinwendung zum Heil, das Gott uns durch Jesus Christus im Heiligen Geist schenkt. So schenkt uns die Taufe ein für allemal das neue Leben in Christus, das sich darin auswirken muß, daß wir der Sünde widerstreben und für Gott leben (vgl. Röm 6,6-14). In diesem Sinn ist die Umkehr oder, wie wir dann auch sagen, die Buße eine beständige Aufgabe, die das ganze Leben des Christen bestimmen muß. Doch schon bald machte die Kirche die Erfahrung, daß auch die Getauften der Versuchung der Sünde erliegen und abfallen können. Sie wußte freilich auch, daß Gott reich ist an Erbarmen (vgl. Eph 2,4) und dem umkehrwilligen Sünder die Möglichkeit zu einer neuen Bekehrung schenkt. So konnte der hl. Ambrosius sagen, in der Kirche gebe es "Wasser und Tränen: das Wasser der Taufe und die Tränen der Buße". Von der Kirche insgesamt gilt: "Sie ist zugleich heilig und stets der Reinigung bedürftig, sie geht immerfort den Weg der Buße und Erneuerung" (LG 8).
Diese alltägliche Buße des Christen kann in vielfältigen Formen geschehen. Die Heilige Schrift und die Väter betonen vor allem drei Bußübungen: Fasten, Gebet und Almosen (vgl. Tob 12,8; Mt 6,1-18). Außer den grundlegenden Auswirkungen der Taufgnade und dem Erleiden des Martyriums nennen sie u. a. die Versöhnung mit dem Nächsten, die Tränen der Buße, die Sorge um das Heil des Nächsten, die Fürbitte der Heiligen und die Liebe. Hinzu kommen in der lebendigen Tradition der Kirche vor allem das Lesen der Heiligen Schrift und das Beten des Vaterunsers. Es müssen aber auch die vom Glauben inspirierten Vollzüge der Umkehr in der täglichen Lebenswelt genannt werden, z. B. Gesinnungswandel, gemeinsame Aussprache über Schuld und Sünde, Gesten der Versöhnung, brüderliches Bekenntnis und brüderliche Zurechtweisung. Auch gewisse Formen geistlicher Lebensführung wie die Lebensbetrachtung (révision de vie), das Schuldkapitel, die seelsorgerliche Aussprache sind Ausdrucksformen der Buße. Nicht zu vergessen sind die ethischen Folgen einer neuen Lebensorientierung: Änderung des Lebensstils, Aszese und Verzicht in vielen Weisen, Taten der Nächstenliebe, Werke der Barmherzigkeit, Sühne und Stellvertretung.
Alle diese Formen der alltäglichen Buße müssen einmünden in die gemeinsame Feier der Eucharistie. Sie ist das "Opfer unserer Versöhnung" (Drittes Hochgebet), denn sie ist die Vergegenwärtigung des ein für allemal dargebrachten Opfers Jesu Christi. Deshalb schenkt die Mitfeier der Eucharistie, vor allem die Kommunion, die Vergebung der alltäglichen Sünden und bewahrt vor schweren Sünden (vgl. DS 1638; NR 570). In der Feier der Eucharistie kommt dies dadurch zum Ausdruck, daß sie mit einem Bußakt beginnt. Daneben gibt es noch andere Formen gottesdienstlicher Sündenvergebung. Nicht bloß die Bußfeiern, sondern auch Besinnung und Gebet, Fürbitte und Stundengebet der Kirche, Lesung und Meditation der Heiligen Schrift gehören hierzu.
Die Bußzeiten und Bußtage der Kirche im Laufe des Kirchenjahres (Adventszeit, österliche Bußzeit, der Freitag als der Todestag des Herrn) sind besondere Schwerpunkte der Bußpraxis der Kirche (vgl. SC 109-110). Diese Zeiten und Tage eignen sich besonders für Exerzitien, Einkehrtage, Bußgottesdienste, Bußwallfahrten, Konsumverzicht, brüderliches Teilen (Aktion Misereor, Adveniat, Missio, Caritas u. a.).
Allen diesen vielfältigen Ausdrucksformen der Buße ist gemeinsam, daß sich in ihnen der Sünder neu vom Geist Jesu Christi bestimmen läßt und ihn in der persönlichen Bußgesinnung wie in den leiblichen Bußwerken zeichenhaft zum Ausdruck bringt. So müssen alle Formen der christlichen Buße wenigstens anfänglich und im Keim von Glaube, Hoffnung und Liebe bewegt sein. So haben alle Formen der Buße eine gemeinsame Grundstruktur: Einsicht in die Schuld - Reue über das Begangene oder Unterlassene - Bekenntnis der Schuld - Bereitschaft zur Änderung des Lebens einschließlich einer eventuell möglichen, grundsätzlich jedoch notwendigen Wiedergutmachung entstandenen Schadens - Bitte um Vergebung - Empfang der Gabe der Versöhnung - Dank für die zugesprochene Vergebung - Leben in einem neuen Gehorsam. So ist die Buße ein Weg, den wir freilich nicht nur als einzelne, sondern in der Gemeinschaft aller Glieder der Kirche gehen. Diese kirchliche Dimension kommt vor allem im Sakrament der Buße zum Ausdruck, in dem die persönliche Buße ihre sakramentale Verdichtung findet.
4.2 Die sakramentale Buße
Die Evangelien berichten uns, daß Jesus einzelnen Menschen ihre Sünden vergeben hat: "Deine Sünden sind dir vergeben!" (Mk 2,5; Lk 7,48). Er hat diese Vollmacht aber auch "den Menschen" gegeben (Mt 9,8). Die Kirche insgesamt soll Zeichen und Werkzeug der Versöhnung sein. In besonderer Weise ist diese Vollmacht jedoch dem apostolischen Amt gegeben. Ihm ist der "Dienst der Versöhnung" aufgetragen (vgl. 2 Kor 5,18); es ist gesandt "an Christi Statt, und Gott ist es, der durch es mahnt ... Laßt euch mit Gott versöhnen!" (2 Kor 5,20). So führt die Kirche die Vollmacht des kirchlichen Amtes zur Vergebung der Sünden auf den auferstandenen Herrn selbst zurück:
- "Empfangt den Heiligen Geist! Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert." (Joh 20,22-23)
Die Sündenvergebung hatte schon bei Jesus immer auch einen Gemeinschaftsaspekt. Jesus versöhnt Sünder mit Gott, indem er sie aufnimmt in die Mahlgemeinschaft mit sich und untereinander. Der Sünder isoliert sich ja von Gott und von den Brüdern. Durch seine Sünde wird die Gemeinschaft des Volkes Gottes gestört und sein Leben in Heiligkeit verwundet. Deshalb ist der Sünder von der vollen Gemeinschaft der Kirche ausgeschlossen (vgl. 1 Kor 5,1-13; 2 Kor 2,5-11; 7,10-13); er kann vor allem nicht mehr voll an der Eucharistie, dem Sakrament der Einheit und der Liebe, teilnehmen. In der Buße muß der Umkehrende deshalb den Weg zurückgehen, auf dem zuerst die Versöhnung zu ihm gekommen ist. Er muß sich mit seinen Brüdern versöhnen, um neue Gemeinschaft mit Gott zu erlangen. Umgekehrt werden wir durch die Vergebung Gottes "zugleich mit der Kirche versöhnt", die durch die Sünde verwundet und die zur Bekehrung durch Liebe, Beispiel und Gebet mitwirkt (LG 11). Diese Gemeinschaftsstruktur und kirchliche Dimension der Buße kommt vor allem in dem Wort Jesu an Petrus zum Ausdruck:
- "Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben; was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein." (Mt 16,19)
Dies gilt auch von der Kirche insgesamt (vgl. Mt 18,18). Mit diesem Wort vom Binden und Lösen ist gemeint: Wen ihr aus eurer Gemeinschaft ausschließt (binden = bannen), der ist auch ausgeschlossen aus der Gemeinschaft Gottes; wen ihr aber wieder neu in eure Gemeinschaft aufnehmt (= den Bann lösen), den nimmt auch Gott in seine Gemeinschaft auf. So ist die Wiederversöhnung mit der Kirche der Weg der Versöhnung mit Gott. Dieser Aspekt kam in der öffentlichen Kirchenbuße der alten Kirche gut zum Ausdruck. Entsprechend heißt es in der seit dem Jahr 1975 verpflichtenden sakramentalen Lossprechungsformel:
"Durch den Dienst der Kirche schenke er dir Verzeihung und Frieden."
Im einzelnen hat das Sakrament der Buße eine lange und komplizierte Geschichte durchgemacht, in der es vielfältige Wandlungen gegeben hat. Als wesentliche Grundstruktur dieses Sakraments hat sich jedoch ein doppelter Vorgang durchgehalten: Das Sakrament der Buße besteht einerseits in von der Gnade ermöglichten menschlichen Akten der Umkehr: der Reue, dem Bekenntnis und der Genugtuung, andererseits im Tun der Kirche, nämlich darin, daß die kirchliche Gemeinschaft unter der Leitung des Bischofs und der Priester im Namen Jesu Christi die Vergebung der Sünden anbietet, die notwendigen Formen der Genugtuung festlegt, für den Sünder betet und stellvertretend mit ihm büßt, um ihm schließlich die volle kirchliche Gemeinschaft und die Vergebung seiner Sünden zuzusprechen. So ist das Sakrament der Buße zugleich ein ganz und gar personaler Akt und eine kirchliche, liturgische Feier der Buße. Deshalb lehrt das Trienter Konzil, das Tun des Büßenden in Reue, Bekenntnis und Genugtuung sei "gleichsam die Materie dieses Sakraments", während priesterliche Lossprechung die Form des Sakraments der Buße darstellt (vgl. DS 1673; NR 647-648). Die Frucht dieses Sakraments besteht in der Versöhnung mit Gott und mit der Kirche. Sie ist oft mit dem Frieden und der Freude des Gewissens und mit großem Trost der Seele verbunden (vgl. DS 1674-1675, NR 649).
Versuchen wir, die einzelnen Elemente des Sakraments der Buße etwas genauer zu beschreiben! Unter den Betätigungen des Büßenden nimmt die Reue den ersten Platz ein. Sie "ist der Schmerz der Seele und der Abscheu über die begangene Sünde mit dem Vorsatz, fortan nicht mehr zu sündigen". Diese Reue wird als vollkommene Reue bezeichnet, wenn sie von der durch Gott geschenkten Liebe bewegt wird (Liebesreue). Eine solche Reue hat die Kraft, die alltäglichen Sünden zu vergeben; sie schenkt auch die Vergebung der schweren Sünden, wenn sie mit dem festen Vorsatz zum sakramentalen Bekenntnis verbunden ist. Als unvollkommen wird die Reue bezeichnet, wenn sie aus der Erwägung über die Häßlichkeit der Sünde oder aus der Furcht vor der ewigen Verdammnis und anderen Strafen hervorgeht (Furchtreue). Eine solche Erschütterung des Gewissens kann ein erster Anfang sein, der durch das Geschenk der Gnade, besonders durch den Zuspruch der Sündenvergebung im Sakrament der Buße vervollkommnet wird. Aus sich selbst hat jedoch die Furchtreue nicht die Kraft, die Sündenvergebung zu schenken (vgl. DS 1676-78, NR 650-651).
Das Bekenntnis der Schuld hat schon rein menschlich betrachtet eine befreiende und versöhnende Wirkung. Durch das Bekenntnis steht der Mensch zu seiner sündigen Vergangenheit, er übernimmt die Verantwortung dafür, und zugleich öffnet er sich neu für Gott und die Gemeinschaft der Kirche, um so neue Zukunft zu gewinnen. Nach der Lehre der Kirche ist ein solches Bekenntnis ein wesentlicher und unverzichtbarer Teil des Sakraments der Buße, um sich dem Gnadengericht Gottes zu unterwerfen (vgl. DS 1679; 1706; NR 652; 665). Deshalb ist es notwendig, die schweren Sünden (Todsünden), derer sich der Büßende nach sorgfältiger Erforschung seines Gewissens erinnert, so zu bekennen, daß die konkrete Situation nach Zahl, Eigenart, Umständen angemessen zum Ausdruck kommt (vgl. DS 1707; NR 666). Nach dem Kirchengebot ist jeder Gläubige "nach Erreichen des Unterscheidungsalters verpflichtet, seine schweren Sünden wenigstens einmal im Jahr aufrichtig zu bekennen" (CIC can. 989). Das Bekenntnis der alltäglichen Sünden (läßliche Sünden), die uns nicht aus der Gemeinschaft mit Gott ausschließen, ist nicht notwendig, es wird aber von der Kirche als nützlich empfohlen. Diese sogenannte Andachtsbeichte ist eine wesentliche Hilfe für die persönliche Gewissensbildung und das Wachstum im geistlichen Leben. Sie ist darum sehr empfohlen und sollte wenigstens in den Bußzeiten des Kirchenjahres ihren festen Platz haben.
Durch die Genugtuung soll der durch die Sünde angerichtete Schaden und das von ihr erregte Ärgernis, soweit möglich, in angemessener Weise wiedergutgemacht werden (z. B. Rückgabe von gestohlenem Gut, Wiederherstellung des guten Rufes anderer). Die Genugtuung dient zugleich der Einübung im neuen Leben; sie ist ein Heilmittel gegen die Schwachheit. Deshalb soll das Bußwerk, soweit dies möglich ist, der Schwere und der Eigenart der Sünden entsprechen. Es kann im Gebet, in Opfer und Verzicht, im Dienst am Nächsten und in Werken der Barmherzigkeit bestehen. Eine solche Genugtuung ist keine eigenmächtige Leistung, durch die wir die Vergebung verdienen; sie ist vielmehr eine Frucht und ein Zeichen der vom Geist Gottes gewirkten und geschenkten Buße.
Die priesterliche Lossprechung beim Sakrament der Buße ist nicht nur eine Verkündigung des Evangeliums von der Vergebung der Sünden oder eine Erklärung, daß Gott die Sünden vergeben hat; sie ist als Wiederaufnahme in die volle kirchliche Gemeinschaft - wie die kirchliche Lehre sagt - ein richterlicher Akt, der allein dem zukommt, der im Namen Jesu Christi für die ganze kirchliche Gemeinschaft handeln kann (vgl. DS 1685; 1709-1710; Nr 654; 668-669). Als Gericht ist das Sakrament der Buße freilich ein Gnadengericht, in dem Gott, der barmherzige Vater, sich aufgrund von Tod und Auferstehung Jesu Christi im Heiligen Geist dem Sünder gnädig zuwendet. Der Beichtvater nimmt deshalb in gleicher Weise die Stelle eines Richters wie die eines Arztes ein. Er soll wie ein Vater und wie ein Bruder handeln. Er repräsentiert Jesus Christus, der am Kreuz sein Blut für den Sünder vergossen hat. Deshalb soll er dem Beichtenden die Botschaft von der Vergebung verkünden und auslegen, ihm durch seinen Rat zu einem neuen Leben helfen, für ihn beten und stellvertretend für ihn Buße tun und ihm schließlich in der Lossprechung im Namen Jesu Christi die Vergebung seiner Sünden schenken.
Seit der Neuordnung der "Feier der Buße" im Jahr 1974 sind drei Formen der sakramentalen Bußfeier vorgesehen:
Form A: Feier der Versöhnung für einzelne. Auch diese Form soll eine gewisse liturgische Gestalt haben: Begrüßung durch den Priester, Lesung eines Schriftwortes, Sündenbekenntnis und Bußauflage, Gebet, Ausbreiten der Hände des Priesters mit Lossprechung, abschließender Lobpreis und liturgische Entlassung mit dem priesterlichen Segen. Falls pastorale Gründe es nahelegen, kann der Priester einige Teile des Ritus auslassen oder abkürzen. Dabei müssen jedoch folgende Teile immer vollständig gewahrt bleiben: das Sündenbekenntnis und die Annahme der Bußauflage, die Aufforderung zur Reue, die Absolutionsformel und die Entlassung. In Todesgefahr genügt es, wenn der Priester die wesentlichen Worte der Absolution spricht: "Ich spreche dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes." In der Praxis hat sich freilich diese erneuerte Gestalt des Sakraments der Buße noch nicht allgemein durchgesetzt.
Form B: Gemeinschaftliche Feier der Versöhnung mit Bekenntnis und Lossprechung von einzelnen. Bei dieser Form ist die Einzelbeichte und Einzellossprechung verbunden mit einer gemeinsamen Bußfeier zur Vorbereitung und zur gemeinsamen Danksagung. Die Einzelbeichte ist also eingebettet in einen Wortgottesdienst mit Schriftlesung und Homilie, gemeinsamer Gewissenserforschung und allgemeinem Sündenbekenntnis, Gebet des Vaterunsers und gemeinsamer Danksagung. Diese gemeinsame Feier bringt den kirchlichen Charakter der Buße klarer zum Ausdruck.
Form C: Die gemeinschaftliche Feier der Versöhnung mit allgemeinem Bekenntnis und Generalabsolution. Diese Form ist nur erlaubt, wenn eine schwerwiegende Notwendigkeit vorliegt. Dies trifft außer in Todesgefahr zu, wenn angesichts der Zahl der Gläubigen nicht genügend Beichtväter zur Verfügung stehen, um innerhalb einer angemessenen Zeit das Bekenntnis der einzelnen in gebührender Weise zu hören, so daß sie ohne ihre Schuld lange die Gnade des Sakraments oder die hl. Kommunion entbehren müßten. Vorausgesetzt ist dabei freilich der Wille, die schweren Sünden, soweit es möglich ist, möglichst bald einzeln zu bekennen. Die Entscheidung, ob eine solche schwerwiegende Notwendigkeit gegeben ist, ist Sache des Diözesanbischofs nach Beratung mit den übrigen Mitgliedern der Bischofskonferenz (vgl. CIC can. 961). Die Deutsche Bischofskonferenz hat die Notwendigkeit dazu (abgesehen von Todesgefahr einer größeren Gruppe) derzeit als nicht gegeben betrachtet.
Von diesen drei Formen der sakramentalen Feier der Buße sind die Bußgottesdienste im engeren Sinn zu unterscheiden. Sie sind Ausdruck und Erneuerung der bei der Taufe geschehenen Umkehr. In ihnen versammelt sich das Volk Gottes, um das Wort Gottes zu hören, das zur Umkehr und zur Erneuerung des Lebens ruft und das die Erlösung von der. Sünde durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi verkündet. Zu einer solchen Bußfeier gehören: Eröffnung (Gesang, Begrüßung und Gebet), Lesungen aus der Heiligen Schrift, zwischen denen ein Lied gesungen oder Stille gehalten wird, die Homilie, die gemeinsame Gewissenserforschung und das Gebet um die Vergebung der Sünden, besonders das Gebet des Vaterunsers, jedoch keine sakramentale Lossprechung. Diese Bußgottesdienste dürfen also nicht mit der Feier des Bußsakraments verwechselt werden. Dennoch sind sie sehr nützlich zur Bekehrung und zur Reinigung des Herzens. Sie können den Geist der christlichen Buße fördern, den Gläubigen bei der Vorbereitung zu ihrem Einzelbekenntnis helfen, den Sinn für den Gemeinschaftscharakter der Buße vertiefen und besonders die Kinder zur Buße hinführen. Bei einem echten Geist der Umkehr und der Liebesreue wird in solchen Bußfeiern die Vergebung der alltäglichen Sünden geschenkt. So kommt ihnen eine wirksame Heilsbedeutung zu. Sie sollten deshalb zum Leben jeder Gemeinde gehören und vor allem während den kirchlichen Bußzeiten einen festen Platz haben (vgl. Gem. Synode, Schwerpunkte heutiger Sakramentenpastoral C 4).
4.3 Der Ablaß
Eng mit dem Sakrament der Buße verbunden ist die kirchliche Lehre und Praxis vom Ablaß. Unter einem Ablaß versteht man die Nachlassung zeitlicher Strafen von Sünden, deren Schuld bereits vergeben wurde. Der Ablaß setzt also die persönliche Umkehr, bei schweren Sünden den Empfang des Sakraments der Buße und beim vollkommenen Ablaß außerdem den Empfang der Kommunion voraus. Denen, die bestimmte auferlegte Werke verrichten (vor allem Gebet, Besuch von Wallfahrtskirchen), wird der Ablaß von der Kirche gewährt aufgrund des Schatzes der Genugtuung Jesu Christi und der Heiligen.
Diese Lehre und Praxis des Ablasses ist heute vielen Christen nur noch schwer verständlich. Will man diese Lehre tiefer verstehen, dann muß man sie aus ihren geschichtlichen Wurzeln und in ihren größeren sachlichen Zusammenhängen begreifen.
In einer allgemeinen Weise hat es den Ablaß im Grunde von Anfang an in der Kirche gegeben. Im einzelnen hat der Ablaß freilich eine lange Geschichte. In der alten Kirche spielte vor allem die Fürbitte der Bekenner, die in den Verfolgungen schwere Leiden erduldet hatten, eine große Rolle. Da die zeitlichen Sündenstrafen in der alten Kirche durch zeitlich begrenzte Kirchenstrafen "abgebüßt" wurden, war lange Zeit von einem Ablaß etwa von 100 oder 500 Tagen die Rede. Der Ablaß in seiner heutigen Form ist im 11. Jahrhundert entstanden. Seit dem frühen Mittelalter wurde der Ablaß nämlich oft mit bestimmten Frömmigkeitswerken verbunden: Teilnahme am Kreuzzug, Wallfahrt zu den heiligen Stätten, bestimmte Gebete oder gute Werke. In diesen Zusammenhang gehören der Portiunkula-Ablaß, der Jubiläumsablaß aus Anlaß eines Heiligen Jahres und der Allerseelenablaß.
Oft war der Ablaß auch mit finanziellen Spenden für kirchliche Zwecke verbunden. Das führte vor allem im späten Mittelalter zu großen Mißständen, die mit ein Anlaß waren für den Beginn der Reformation. Das Konzil von Trient (1545-1563) hat daraufhin die Ablaßpraxis gründlich reformiert und Mißstände abgestellt; es hat jedoch grundsätzlich daran festgehalten, daß der Ablaß für das christliche Volk überaus segensvoll ist; es hat deshalb diejenigen verurteilt, die den Ablaß für unnütz erklären oder der Kirche das Recht absprechen, Ablässe zu verleihen. Doch hat die Trienter Kirchenversammlung gewünscht, daß man bei der Verleihung der Ablässe nach altem, bewährtem Brauch der Kirche Maß halte und daß vor allem jede Gewinnsucht ausgeschlossen ist (vgl. DS 1835; NR 688-689). Eine lehrmäßige Vertiefung der Lehre vom Ablaß und eine praktische Erneuerung für die Gegenwart erfolgte durch Papst Paul VI. in der Apostolischen Konstitution über die Neuordnung des Ablaßwesens von 1967.
Für ein tieferes Verständnis der der Ablaßpraxis zugrundeliegenden Lehre vom Ablaß muß man sich zunächst klarmachen, daß die Sünde eine doppelte Folge hat. Die Sünde führt einmal zur Aufhebung der Gemeinschaft mit Gott und damit zum Verlust des ewigen Lebens (ewige Sündenstrafe); sie verwundet und vergiftet zum andern aber auch die Verbindung des Menschen mit Gott und das Leben der Menschen und der menschlichen Gemeinschaft (zeitliche Sündenstrafe). Beide Sündenstrafen sind von Gott nicht äußerlich "zudiktiert", sondern folgen innerlich aus dem Wesen der Sünde selbst. Mit der Vergebung der Sündenschuld und der Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott ist der Nachlaß der ewigen Sündenstrafen verbunden. Es bleiben aber noch die zeitlichen Sündenfolgen. Der Christ soll sich bemühen, durch geduldiges Ertragen von Leiden, Not und Mühsal, schließlich durch die bewußte Annahme des Todes diese zeitlichen Sündenfolgen aus Gottes Hand entgegenzunehmen und durch Werke der Barmherzigkeit und der Liebe sowie durch Gebet und die verschiedenen Ausdrucksformen der Buße den "alten Menschen" vollends abzulegen und den "neuen Menschen" anzuziehen (vgl. Eph 4,22-24).
Die Kirche bietet dem Christen noch einen anderen Weg an, den er in der Gnadengemeinschaft der Kirche zusätzlich beschreiten kann. Der Christ, der sich auf diese Weise mit Hilfe der Gnade Gottes läutert und heiligt, steht nämlich nichtallein. Er ist Glied am Leib Christi. In Christus sind alle Christen eine große solidarische Gemeinschaft. "Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit" (1 Kor 12,26). In dieser gemeinschaftlichen Teilhabe an den Heilsgütern, die uns Jesus Christus und mit Hilfe der Gnade Christi die Heiligen verdient haben, besteht der sogenannte Kirchen- oder Gnadenschatz. Der Ablaß kommt dadurch zustande, daß die Kirche aufgrund der ihr von Jesus Christus erteilten Vollmacht, zu binden und zu lösen, für den einzelnen Christen eintritt und ihm vollmächtig den Schatz der Genugtuung Christi und der Heiligen zum Nachlaß der zeitlichen Sündenstrafen zuteilt. Dabei will die Kirche dem einzelnen Christen nicht nur helfen, sondern ihn auch zu Werken der Frömmigkeit, Buße und Liebe anspornen. Da auch die verstorbenen Gläubigen, die sich im Läuterungszustand befinden, Glieder der einen Gemeinschaft der Heiligen sind, können wir sie in der Weise der Fürbitte beim Abbüßen der zeitlichen Sündenstrafen unterstützen.
In der genannten Apostolischen Konstitution von Papst Paul VI. wird das Wesen des sogenannten Kirchenschatzes in sehr treffender Weise gedeutet. "Er ist nicht so etwas wie eine Summe von Gütern nach Art von materiellen Reichtümern, die im Laufe der Jahrhunderte angesammelt wurden. Vielmehr besteht er in dem unendlichen und unerschöpflichen Wert, den bei Gott die Sühneleistungen und Verdienste Christi, des Herrn, haben... Der Kirchenschatz ist Christus, der Erlöser, selbst, insofern in ihm die Genugtuung und Verdienste seines Erlösungswerkes Bestand und Geltung haben. Außerdem gehört zu diesem Schatz auch der wahrhaft unermeßliche, unerschöpfliche und stets neue Wert, den vor Gott die Gebete und guten Werke der seligen Jungfrau Maria und aller Heiligen besitzen. Sie sind den Spuren Christi, des Herrn, mit seiner Gnade gefolgt, haben sich geheiligt und das vom Vater aufgetragene Werk vollendet. So haben sie ihr eigenes Heil gewirkt und dadurch auch zum Heil ihrer Brüder in der Einheit des mystischen Leibes beigetragen" (NR 691).
Ein besonderes Problem stellt sich beim sogenannten vollkommenen Ablaß, also der Nachlassung aller zeitlichen Sündenfolgen. Er setzt, soll er in dieser vollkommenen Weise wirksam werden, eine so vollkommene Disposition voraus, wie sie normalerweise wohl sehr selten gegeben sein wird - es sei denn in der Stunde des Todes, wenn ein Christ sein Leben ganz in die Hände Gottes, seines Schöpfers und Erlösers, zurückgibt. Hier haben das Sakrament der Krankensalbung und der Sterbeablaß ihren Ort.
S. Die Krankensalbung
Krankheit und Schmerz haben stets zu den größten Lebensproblemen der Menschen gehört. Die Krankheit ist mehr als eine vorübergehende Störung der Gesundheit. Sie ist ein gesamtmenschliches, leib-seelisches Ereignis, das den Menschen innerlich zutiefst betrifft. In der Krankheit erfährt der Mensch seine Ohnmacht, Begrenztheit und Endlichkeit. Er wird aus dem normalen Leben herausgerissen, ist zur Untätigkeit verurteilt und erfährt, wie wenig wir unser Leben in der Hand haben. Das führt zu Isolierung, Niedergeschlagenheit, Besorgnis, Angst, oft zur Verzweiflung. Auf der anderen Seite bringt die Krankheit im Menschen Kräfte zur Reifung; sie verhilft uns zu tieferen Einsichten darüber, was in unserem Leben vordergründig und vergänglich ist und was Werte von bleibender Bedeutung sind. Dennoch ist die Krankheit als Bedrohung des Lebens ein Übel, gegen das sich der Mensch instinktiv zur Wehr setzt. Letztlich ist die Krankheit ein Vorbote und eine Ankündigung des Todes. Denn das in der Krankheit geminderte und bedrohte irdische Leben wird uns im Tod endgültig entzogen. Erst angesichts der Möglichkeit des Todes, die uns in der Krankheit deutlicher als sonst vor Augen steht, erfahren wir die Hinfälligkeit und Begrenztheit des Menschen in ihrer ganzen Radikalität.
Die Heilige Schrift sieht in der Bedrohung des Menschen durch die Krankheit ein Zeichen dafür, daß wir in einer Welt leben, die durch die Sünde gestört und noch nicht unter die volle Herrschaft Gottes zurückgeführt ist. Dennoch lehnt es das Evangelium ab, in der Krankheit des einzelnen unmittelbar eine Strafe für seine persönliche Schuld zu sehen. Das Evangelium will uns vielmehr sagen: Gott will das Leben. Es zeigt uns Jesus als den großen Gegner und Überwinder der Krankheit (vgl. Mt 4,24; Apg 10,38 u. a.), und es sieht in den Krankenheilungen Jesu ein Zeichen dafür, daß Gottes Herrschaft anbricht und daß ihr Kommen das Heil des ganzen leibseelischen Menschen bedeutet. Die Heilige Schrift sagt uns: Gott liebt nicht nur die Gesunden, sondern gerade auch die Kranken, die in den Augen der Welt nichts mehr leisten können; ihnen ist er sogar besonders nahe. Jesus selbst hat ja in Erfüllung der Schriftworte beim Propheten Jesaja "unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen" (Jes 53,4).
Mit dem Auftrag "Heilt Kranke!" (vgl. Mt 10,8) hat Jesus seine Sorge für die Kranken auch seinen Jüngern übertragen. In der Gerichtsrede zählt Jesus den Besuch der Kranken zu den Werken der Nächstenliebe, die das ewige Schicksal des Menschen entscheiden; ja, Jesus geht so weit, sich selbst mit den Kranken zu identifizieren (vgl. Mt 25,36.43). Diese Verpflichtung zum Krankenbesuch und zur Betreuung der Kranken hat in der Geschichte der Kirche eine große Bedeutung erlangt. Schon in der Antike und im Mittelalter hat die Kirche durch Krankenhäuser, Altenheime, Krankenpflegeorden, karitative Vereinigungen, Krankenseelsorge u. a. versucht, dem Beispiel und dem Auftrag Jesu zu folgen. Dabei hat sie niemals einen Gegensatz gesehen zwischen medizinisch-ärztlicher und seelsorgerlich-geistlicher Betreuung der Kranken; beides gehört vielmehr engstens zusammen. Gott will das Leben des ganzen Menschen nach Leib und Seele. Deshalb erfüllen auch Ärzte und alle, die sich in irgendeiner Weise der Pflege der Kranken widmen, in ihrer Weise einen Auftrag Jesu Christi.
Das vorzüglichste sakramentale Mittel der Sorge für das Heil der Kranken ist das Sakrament der Krankensalbung. Es ist grundgelegt in Jesu gesamtem Verhalten gegenüber den Kranken; es wird angedeutet in dem Bericht über die Aussendung der zwölf Jünger: "Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie" (Mk 6,13). Daraus hat sich in urchristlichen Gemeinden die Praxis der Krankensalbung entwickelt, wie sie uns im Jakobusbrief bezeugt wird:
- "Ist einer von euch krank? Dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich; sie sollen Gebete über ihn sprechen und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das gläubige Gebet wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrichten; wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben." (Jak 5,14-15)
Das Gebet zur Errettung aus Krankheit hat schon im Alten Testament eine lange Tradition (vgl. Ps 6; 22; 28; 38 u. a.). Vor seiner eigenen Passion hat Jesus selbst im Gebet mit seinem Vater gerungen (vgl. Mk 14,36 par.; Hebr 5,7). Auch seine Jünger hat Jesus das kindlich vertrauende Gebet in allen Nöten gelehrt und ihnen die Gewißheit der Erhörung verheißen. Dabei darf das Gebet der Kirche im Namen Jesu Christi durch ihre amtlichen Vertreter in besonderer Weise der Erhörung gewiß sein. Der Symbolgestus der Handauflegung wurde von Jesus selbst gegenüber Kranken geübt (vgl. Mk 6,5; Mt 8,3; Lk 4,40); er hat ihn auch seinen Jüngern aufgetragen (vgl. Mk 16,18), und diese haben ihn geübt (vgl. Apg 9,12.17; 28,8). An sich kann die Handauflegung Verschiedenes bedeuten. In diesem Zusammenhang ist sie als Gestus menschlicher und christlicher Zuwendung, als Zeichen der Anteilnahme, des Trostes und der Ermutigung ein Segensgestus, der das durch das Sakrament geschenkte Heil bezeichnet. Auch die Salbung mit Öl kann an sich verschiedene Bedeutungen haben. Für unseren Zusammenhang ist von Bedeutung, daß das Öl in der Antike ein weitverbreitetes Heil- und Pflegemittel war, was es bis heute geblieben ist. Jesus selbst hat, soweit wir das aus den Evangelien entnehmen können, die Salbung mit Öl nicht geübt, sondern sich teilweise eines anderen Symbols bedient, indem er Kranke mit Speichel berührte (vgl. Mk 7,32-33; 8,23; Joh 9,6). Die Jünger Jesu dagegen haben die Salbung Kranker mit Öl schon zu Lebzeiten Jesu vollzogen (vgl. Mk 6,13). Wenn nun urkirchliche Gemeinden diesen Brauch aufnahmen, so geht es ihnen nicht um ein magisch wirkendes Wundermittel. Die Salbung ist ja mit dem Gebet im Namen des Herrn verbunden und deutet damit symbolisch auf die Rettung und Aufrichtung des Kranken durch Gott.
Die beiden Worte Rettung und Aufrichtung sind in unserem Text in dem umfassenden Sinn einer gesamtmenschlichen, leib-seelischen Heilung gemeint. Die Kirche kann und soll also auch für das leibliche Heil des Kranken beten. Ein Teilaspekt dieses gesamtmenschlichen, leiblich-seelischen Heils ist die Vergebung der Sünden; denn die Sünde bedeutet ja Abwendung von Gott als dem endgültigen Heil des Menschen. Daß es die Ältesten, die Presbyter sind, die zum Krankenbesuch, zum Gebet, zur Handauflegung und zur Salbung der Kranken ermahnt werden, bringt zum Ausdruck, daß der Kranke nicht am Rande der Gemeinde steht, sondern in besonders intensiver Weise mit der Kirche verbunden ist, und daß ihm in besonderer Weise die Zuwendung und die Fürbitte der Gemeinde gehört.
Der Text aus dem Jakobusbrief hat in der Überlieferung der Kirche eine reiche Entfaltung gefunden; die Überlieferung hat darin das Sakrament der Krankensalbung grundgelegt gesehen. Dieses hat freilich im Laufe der Geschichte noch manche tiefgreifende Veränderung erfahren. Neben der Ausgestaltung der Weihe des Krankenöls durch den Bischof bei der Chrisam-Messe am Gründonnerstag bestand die wichtigste Veränderung darin, daß seit der karolingischen Zeit das Sakrament der Krankensalbung als Sterbesakrament verstanden wurde: die "Letzte Ölung", die meist erst bei unmittelbarer Todesgefahr gespendet und von vielen Gläubigen oft wie ein Todesurteil aufgenommen wurde. Man kann dies nicht schlechthin als Fehlentwicklung bezeichnen; denn Krankheit und Tod stehen in einem inneren Zusammenhang. Dennoch bedeutete diese Entwicklung gegenüber dem ursprünglichen Sinngehalt, wie er uns im Jakobusbrief begegnet (vgl. Jak 5,14-15), eine Verkürzung. Das II. Vatikanische Konzil hat den ursprünglichen und umfassenden Sinn dieses Sakraments wieder herausgestellt (vgl. SC 73-75; LG 11). Papst Paul Vl. hat im Jahr 1972 die vom Konzil angestoßene Erneuerung der sakramentalen Gestalt für den Bereich der lateinischen Kirche vollzogen.
Seit der nachkonziliaren liturgischen Erneuerung gehört die Krankensalbung normalerweise nicht mehr zum "Versehgang" bei unmittelbarer Todesgefahr, sondern in den Zusammenhang des Krankenbesuchs im Geist des Evangeliums, der Krankenseelsorge. Empfänger des Sakraments sind Gläubige, die sich wegen schwerer Krankheit oder Altersschwäche in einem bedrohlich angegriffenen Gesundheitszustand befinden. Das Sakrament kann wiederholt werden, wenn der Kranke nach empfangener Krankensalbung wieder zu Kräften gekommen ist oder wenn, bei Fortdauer derselben Krankheit, eine weitere Verschlechterung eintritt. Das Sakrament selbst wird im Zusammenhang einer liturgischen Feier gespendet; zu ihr gehören: Eröffnung, Wortgottesdienst, sakramentaler Gottesdienst. Der sakramentale Gottesdienst entspricht in seiner erneuerten liturgischen Gestalt ganz den Aussagen des Jakobusbriefes. Er beginnt mit einer schweigenden Handauflegung durch den Priester und einem in seiner Grundgestalt bis ins 4. Jahrhundert zurückgehenden Lobpreis des geweihten Öls (im Notfall einer Weihe des Öls). Das sakramentale Zeichen wird in der Apostolischen Konstitution von Papst Paul Vl. folgendermaßen festgelegt:
- "Das Sakrament der Krankensalbung wird jenen gespendet, deren Gesundheitszustand bedrohlich angegriffen ist, indem man sie auf der Stirn und auf den Händen mit ordnungsgemäß geweihtem Olivenöl ... salbt und dabei einmal folgende Worte spricht: ,Durch diese heilige Salbung helfe dir der Herr in seinem reichen Erbarmen, er stehe dir bei mit der Kraft des Heiligen Geistes. Der Herr, der dich von Sünden befreit, rette dich, in seiner Gnade richte er dich auf'."
Die doppelte Salbung auf der Stirn und auf den Händen soll ausdrücken, daß das Sakrament dem kranken Menschen in seiner Gesamtheit als denkende und handelnde Person gilt. Die Gnadengabe des Sakraments wird durch die Salbung mit Öl passend angedeutet, denn die Ölsalbung ist schon nach der Heiligen Schrift ein Symbol der Salbung mit dem Heiligen Geist. Jesus Christus ist der mit dem Geist Gesalbte, der Christus, schlechthin. Die eigentliche Wirkung des Sakraments liegt also im Beistand des Herrn mit der Kraft des Heiligen Geistes (vgl. DS 1695-1696; NR 697-698). Der Heilige Geist ist es ja, der die Gebrechen der alten Schöpfung heilt, sie heiligt und der die neue Schöpfung heraufführt. Dazu gehört die Heilung der Seele und, wenn Gott es fügt, auch des Leibes (vgl. DS 1325; NR 695), ebenso, wenn es notwendig und sofern die erforderliche Reue vorhanden ist, die Tilgung der Sünden und der Sündenfolgen, die Aufrichtung und Stärkung der Seele des Kranken durch Vertrauen auf die göttliche Barmherzigkeit (vgl. DS 1696; NR 698). So empfiehlt die Kirche durch Salbung und Gebet den Kranken dem leidenden und verherrlichten Herrn, daß er ihn aufrichte und rette, ja, sie mahnt ihn, "sich bewußt dem Leiden und dem Tode Christi zu vereinigen und so zum Wohl des Gottesvolkes beizutragen" (LG 11). Damit führt das Sakrament der Krankensalbung zu Ende, was mit der Taufe begonnen hat: die Gleichgestaltung mit dem Tod und der Auferstehung des Herrn. Sie ist die Vollendung der Buße des christlichen Lebens und Angeld des neuen Lebens (vgl. DS 1694, NR 696).
Der eigentliche Spender der Krankensalbung ist nach dem Trienter Konzil allein der Priester (vgl. DS 1697; 1719; NR 699; 703). Aufgabe des zuständigen Priesters ist es, die Kranken und ihre Umgebung unter Mithilfe von Ordensleuten und Laien für das Sakrament bereit zu machen; er soll die Feier der Krankensalbung mit dem Kranken und seiner Umgebung vorbesprechen, sie zu einem tieferen Verständnis und zur tätigen Teilnahme anleiten und dann das Sakrament auch spenden. Wie die übrigen Sakramente hat auch das Sakrament der Krankensalbung Gemeinschaftscharakter, der in der Feier selbst zum Ausdruck kommen soll. Dies kann auch dadurch geschehen, daß das Sakrament, wenn der Zustand des Kranken es erlaubt, innerhalb eines Wortgottesdienstes oder im Rahmen der Feier der Eucharistie nach dem Evangelium und der Homilie gespendet wird. Mit Zustimmung des Bischofs kann die Krankensalbung auch mehreren Kranken gemeinsam gespendet werden (etwa bei Krankenwallfahrten, bei Krankengottesdiensten, gelegentlich in Krankenhäusern u. a.). Es entspricht freilich nicht dem Sinn dieses Sakraments, es unterschiedslos allen älteren Menschen von einem bestimmten Alter an zu spenden; Voraussetzung ist vielmehr ein bedrohlich angegriffener Gesundheitszustand. Der früher übliche Versehgang, bei dem der Sterbende mit den drei Sakramenten der Buße, der Krankensalbung und der Eucharistie "versehen" wurde, soll seit der Erneuerung der Liturgie des Sakraments der Krankensalbung freilich nur noch dann stattfinden, wenn jemand unvorhergesehen in unmittelbare Todesgefahr gerät.
Das eigentliche Sakrament im Angesicht des Todes ist nicht die Krankensalbung, sondern die heilige Kommunion in ihrer Eigenart als Wegzehrung und als Unterpfand fier Auferstehung (vgl. Joh 6,54). Seit dem ersten allgemeinen Konzil von Nikaia (325) hat die Kirche dazu gemahnt, die Eucharistie als Wegzehrung zu empfangen (vgl. DS 129). Wenn möglich soll dies im Rahmen einer Meßfeier am Sterbebett geschehen, bei der die Eucharistie dem Sterbenden und den um das Sterbebett Versammelten unter beiden Gestalten gereicht werden soll. Sterbende, die keine feste Nahrung mehr zu sich nehmen können,
können die Eucharistie auch unter der Gestalt des Weines empfangen. Vor dem Empfang der Kommunion soll der Sterbende angesichts des Todes den Glauben erneuern, den er (bzw. seine Eltern und Paten) einst bei der Taufe gelobte, den er bei der Firmung und jedes Jahr in der Osternacht erneuert hat. Zu dieser Tauferneuerung angesichts des Todes paßt es, daß der Sterbende nach dem Schuldbekenntnis den vollkommenen Ablaß in der Sterbestunde erhalten kann. Was mit der Taufe grundgelegt wurde, kommt so zu seiner Vollendung: Teilnahme an Tod und Auferstehung Jesu Christi. Deshalb sollen die Seelsorger, die Angehörigen und Betreuer, vor allem aber die Schwerkranken selbst darauf achten, daß der Empfang des Sakraments der Wegzehrung nicht unnötig hinausgeschoben wird, damit der Sterbende die Eucharistie noch bei vollem Bewußtsein empfangen und sich im Glauben und in der Hoffnung dem Tod und der Auferstehung des Herrn anschließen kann.
Alle bisher behandelten Sakramente werden allen Christen zu ihrem persönlichen Heil wie zur Auferbauung der Kirche gespendet. Zwei weitere Sakramente, das Sakrament der Weihe und das Sakrament der Ehe, dienen nicht primär dem persönlichen Heil, sondern dem Heil der anderen. Sie schenken eine besondere Beauftragung in der Kirche und dienen der natürlichen wie der gnadenhaften Auferbauung des Volkes Gottes. Heilszeichen für den einzelnen sind sie insofern, als sie dem Empfänger die für die Ausübung seiner besonderen Sendung notwendige Gnade schenken. Man nennt die Sakramente der Weihe und der Ehe auch die beiden Standessakramente.
6. Das Sakrament der Weihe
Jesu Verkündigung richtete sich an das gesamte Volk Israel. Allen hat er die frohe Botschaft verkündet; alle hat er in seine Nachfolge gerufen. Aus der großen Zahl seiner Jünger hat er aber die Zwölf in seine besondere Nachfolge gerufen, damit sie in besonderer Weise mit ihm Gemeinschaft haben und an seiner Sendung teilhaben.
- "Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er erwählt hatte, und sie kamen zu ihm. Und er setzte zwölf ein, die er bei sich haben und die er dann aussenden wollte, damit sie predigten und mit seiner Vollmacht Dämonen austrieben." (Mk 3,13-15; vgl. 6,6b-13)
Die besondere Berufung der Zwölf entsprang nicht deren natürlichen Vorzügen oder ihren persönlichen Leistungen. Die Heilige Schrift berichtet uns sehr offen von der Schwerfälligkeit, der Wankelmütigkeit und der Treulosigkeit der Zwölf. Ihre Berufung entsprang allein der freien Erwählung durch Jesus. "Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt" (Joh 15,16). Jesu erwählender Ruf ist wirkmächtig und schöpferisch, er gibt, was er fordert; er macht die berufenen Jünger zu den Zwölfen und setzt sie dazu ein. Es handelt sich also um eine wirksame Berufung zum Dienst. Das Ziel dieser Berufung ist eine besondere persönliche Gemeinschaft mit Jesus und die Aussendung zur Verkündigung und zur Heilung der Welt von der Macht des Bösen. Dabei ist der Gesandte wie der Sendende: "Wer euch hört, der hört mich" (Lk 10,16; vgl. Mt 10,40; Joh 13,20). Diese Repräsentation kommt vor allem darin zum Ausdruck, daß Jesus seine Jünger am Abend vor seinem Tod beauftragt, als seine Repräsentanten seine erlösende Lebenshingabe bis in den Tod in der Feier der Eucharistie immer wieder neu gegenwärtig zu setzen. "Tut dies zu meinem Gedächtnis!" (Lk 22,19; vgl. 1 Kor 11,25).
Nach seiner Auferstehung hat Jesus diese besondere Berufung und Sendung zur Verkündigung, zur Taufe (vgl. Mt 28,19-20; Mk 16,15-16), zur Sündenvergebung (vgl. Joh 20,22-23) bekräftigt, den Aposteln seinen besonderen Beistand verheißen und ihnen den Heiligen Geist gesandt, damit sie seine Zeugen seien bis an die Grenzen der Erde (vgl. Apg 1,8). Das Neue Testament bezeugt, wie wir bereits gesehen haben, daß diese Sendung zu besonderen apostolischen Diensten in der Kirche weitergeht. Der erhöhte Herr gibt auch weiterhin seine Gnadengaben zum Aufbau der Kirche, indem er Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer einsetzt, "um die Heiligen (Gläubigen) für die Erfüllung ihres Dienstes zu rüsten, für den Aufbau des Leibes Christi" (Eph 4,11-12).
Das Zeichen der Amtsübertragung ist schon in apostolischer Zeit die mit Gebet verbundene Handauflegung (vgl. Apg 6,6, 13,3). Dieser uralte Gestus des Segens, der Geistmitteilung und der Amtsübertragung begegnet uns schon im Alten Testament bei der Amtsübertragung des Mose auf Josua (vgl. Num 27,15-23; Dtn 34,9), er wurde im damaligen Judentum vor allem bei der Amtsübertragung der Gesetzeslehrer geübt. In den Pastoralbriefen des Neuen Testaments wird er bereits als gültige kirchliche Praxis vorausgesetzt.
- "Vernachlässige die Gnade nicht, die in dir ist und die dir verliehen wurde, als dir die Ältesten aufgrund prophetischer Worte gemeinsam die Hände auflegten."(1 Tim 4,14)
- "Entfache die Gnade Gottes wieder, die dir durch die Auflegung meiner Hände zuteil geworden ist."(2 Tim 1,6)
Damit sind alle wesentlichen Elemente des Sakraments der Weihe bereits im Neuen Testament grundgelegt: Handauflegung mit Gebet zur Verleihung einer besonderen Gnadengabe Gottes. In entfalteter Form liegen diese Elemente in unmittelbar nachneutestamentlicher Zeit bei Ignatius von Antiochien († um 110) vor. In der späteren Tradition der Kirche wurde dieses Sakrament jedoch nicht nur entfaltet, sondern es mußte auch mehrfach gegen Infragestellungen verteidigt werden. Dies geschah schon durch das IV. Laterankonzil (1215) (vgl. DS 802; NR 920) und vor allem durch das Konzil von Trient (1563) gegenüber den Reformatoren (vgl. DS 1764-78; NR 706-720). Das Trienter Konzil hielt u. a. fest, daß das Sakrament der Weihe ein von Jesus Christus eingesetztes Sakrament ist, das Vollmacht und Gnade vermittelt und nicht nur als Einführung in das Amt und in den bloßen Dienst der Verkündigung des Evangeliums verstanden werden darf. Neben der Verteidigung der sakramentalen Vollmacht der Absolution und der Konsekration schärfte das Trienter Konzil freilich auch allen in der Seelsorge Tätigen die Verpflichtung zur Verkündigung des Wortes Gottes ein, und es bezeichnete die Verkündigung des Evangeliums sogar als die vorzüglichste Aufgabe der Bischöfe.
Seit unmittelbar nachneutestamentlicher Zeit wird das eine Amt in der Kirche in einer dreifachen Abstufung weitergegeben: als Amt des Bischofs, der Priester und der Diakone. Vor allem weil man später den Zusammenhang von Priestertum und Opfer lange Zeit sehr eng bestimmte, erschien es fraglich, ob die Bischofsweihe, die ja bezüglich der Feier der Eucharistie gegenüber den "einfachen" Priestern keine "höhere" Vollmacht verleiht, ein Sakrament sei. Diese Frage ist durch das II. Vatikanische Konzil endgültig geklärt. Das Konzil lehrt, "daß durch die Bischofsweihe die Fülle des Weihesakramentes übertragen wird" (LG 21; vgl. 26). Sache der Bischöfe ist es infolgedessen, anderen die Weihen zu erteilen (vgl. LG 21; 26). Die Sakramentalität der Priesterweihe war in der Kirche nie umstritten. Dabei sah man immer in der Feier des Meßopfers die zentrale Aufgabe des Priesters und die Vollendung seines Dienstes (vgl. PO 2). Die Sakramentalität der Diakonenweihe wird vom Konzil ebenfalls eindeutig gelehrt. Der Diakon wird "nicht zum Priestertum, sondern zur Dienstleistung" geweiht (LG 29; vgl. 41). Er wird durch die Handauflegung gestärkt und "dem Altare enger verbunden" (AG 16), damit er seinen diakonalen Dienst wirksamer ausüben kann: liturgische Dienste neben dem Bischof oder Priester, Spendung einzelner Sakramente (Taufe, Austeilen der Kommunion, Eheassistenz) und einzelner Sakramentalien (bes. kirchliche Begräbnisfeier), Leitung von Wortgottesdiensten und Andachten, katechetische und homiletische Verkündigung, die Wahrnehmung von bestimmten Seelsorgeaufgaben in abgelegenen Gemeinden im Namen des Pfarrers und des Bischofs, Ausübung sozialer und karitativer Werke (vgl. Motuproprio von Papst Paul Vl. von 1967).
Bis zur nachkonziliaren Liturgiereform gab es noch die sogenannten niederen Weihen (Pförtner, Lektor, Altardiener, Exorzist) und die Subdiakonatsweihe. Sie wurden, besonders seit dem Trienter Konzil (1545-1563), nur als Sakramentalien betrachtet und waren im Grunde nur Vorstufen zum Empfang der Diakonen- und Priesterweihe. Im Jahr 1972 wurden sie durch Papst Paul Vl. durch "Beauftragungen" zu den "Diensten" des Lektors und Akolythen (Altardiener) ersetzt. Diese Dienste können auch Laien übertragen werden; sie sind nicht mehr den Kandidaten für das Sakrament der Weihe vorbehalten. Der Eintritt in den Klerikerstand erfolgt erst mit der Diakonenweihe. Die frühere Tonsur gibt es nicht mehr; es wurde jedoch ein eigener Ritus für die Aufnahme unter die Kandidaten für Diakonat und Presbyterat geschaffen.
Die Gestalt des Sakraments der Weihe hat im einzelnen eine lange Geschichte. Die mit Gebet verbundene Handauflegung wurde immer vollzogen. Sie wurde aber im Lauf der Geschichte durch teilweise aus dem Alten Testament übernommene ausdeutende Riten ergänzt: bei der Diakonenweihe die Übergabe des Evangelienbuches, bei der Priesterweihe die Salbung der Hände und die Übergabe der heiligen Geräte (Kelch und Patene), bei der Bischofsweihe das Auflegen des Evangelienbuches auf das Haupt, die Salbung des Hauptes mit Chrisam und die Übertragung der bischöflichen Insignien (Ring, Mitra, Hirtenstab).
In der mittelalterlichen Theologie war man oft der Auffassung, das wesentliche Zeichen der Priesterweihe sei die Übertragung der heiligen Geräte (vgl. DS 1326; NR 705). Erst durch die Apostolische Konstitution von Papst Pius XII. von 1947 wurde endgültig festgelegt: Das wesentliche Zeichen aller drei Stufen des Sakraments der Weihe ist allein die Handauflegung und ein Gebet innerhalb der Weihepräfation. Die Übergabe der heiligen Geräte und die anderen Riten sind von jetzt an nicht mehr notwendig zur Gültigkeit der Diakonen-, Priester- und Bischofsweihe. Sie sind aber den inneren Sinn der Handauflegung ausdeutende liturgische Symbole (vgl. DS 3859; NR 724). Diese Entscheidung wurde bei der nachkonziliaren Liturgiereform des Sakraments der Weihe durch Papst Paul Vl. im Jahr 1968 bestätigt.
Das Sakrament der Weihe schenkt eine besondere Teilhabe am Amt Jesu Christi, des einen und einzigen Hohenpriesters und des einen Mittlers zwischen Gott und den Menschen (vgl.1 Tim 2,5). Dadurch wird der Geweihte befähigt, im Vollzug seiner Sendung "in der Person Christi", des Hauptes der Kirche, zu handeln. Näherhin hat er besonderen Anteil am Priester-, Propheten- und Hirtenamt Jesu Christi. Er hat also einen dreifachen Dienst: Er ist ausgesandt zur Verkündigung und zur Lehre, zur Spendung der Sakramente und um das ihm anvertraute Volk Gottes zu leiten. Ähnlich wie bei der Taufe undwie bei der Firmung wird diese Teilhabe am Amt Jesu Christi ein für allemal verliehen. Deshalb verleiht auch das Sakrament der Weihe ein unauslöschliches geistiges Prägemal und kann nicht wiederholt werden (vgl. LG 21; 28; 29; PO 2). Ein einmal gültig Geweihter kann zwar bei Vorliegen entsprechender Gründe von den bei der Weihe übernommenen Verpflichtungen entbunden werden, aber er kann nicht mehr im eigentlichen Sinn Laie werden. Die einmal empfangene Berufung und Sendung bestimmt ihn bleibend. Das Wort "Laisierung" ist deshalb mißverständlich. Sie besagt, daß der Betreffende keine priesterliche Tätigkeit mehr ausüben darf.
Zur Ausübung der Sendung schenkt das Sakrament der Weihe die Gnade des Heiligen Geistes. Denn nur aus der besonderen Gemeinschaft und Freundschaft mit Jesus Christus heraus können die Amtsträger in der Kirche ihren Dienst in rechter und fruchtbarer Weise erfüllen und aus innerer Überzeugung Vorbilder ihrer Herde sein (vgl. 1 Petr 5,3). Sie werden ja nicht zu Funktionären, sondern zu Zeugen bestellt, deren Zeugnis, wenn es glaubwürdig und fruchtbar sein soll, nicht von ihrer Person ablösbar ist. Der Geweihte ist deshalb auch um seines Dienstes willen gehalten, sich in besonderer Weise um ein geistliches Leben zu bemühen. Es gelangt freilich auf eine ihm eigene Weise zur Heiligkeit, nämlich durch aufrichtige und unermüdliche Ausübung seiner Ämter im Geist Christi (vgl. PO 13). So soll die Gnade des Heiligen Geistes den Geweihten befähigen, das doppelte Ziel, auf das sein Dienst ausgerichtet ist, zu erreichen: die Verherrlichung Gottes und den Dienst an den Menschen.
Der Geweihte steht nicht allein; er wird eingegliedert in eine Gemeinschaft. Durch ihre Weihe werden die Bischöfe eingegliedert in das eine Bischofsamt, in das Kollegium aller Bischöfe mit und unter dem Papst, die Priester in das Presbyterium unter der Leitung des Bischofs (vgl. LG 28; PO 7-8). Die Priester können ihren Dienst nur in Abhängigkeit und in Gemeinschaft mit dem Bischof ausüben. Das Treueversprechen, das sie dem Bischof bei der Priesterweihe leisten, und der Friedensgruß des Bischofs am Ende der Priesterweiheliturgie bringen zum Ausdruck, daß sie der Bischof als seine Mitarbeiter, Söhne, Brüder und Freunde betrachtet und daß sie ihm umgekehrt Liebe und Gehorsam schulden. Die Eingliederung in das eine Presbyterium kommt bei der Weihe auch dadurch zum Ausdruck, daß nach dem Bischof alle anwesenden Priester den Neugeweihten die Hände auflegen. Die Einheit des Presbyteriums wird außerdem bei gelegentlichen Konzelebrationen bekundet und muß in der Zusammenarbeit und in der Brüderlichkeit zwischen den Priestern ihren Ausdruck finden. Vom Diakon sagt der Bischof bei der Weihe, er stehe "als Helfer dem Bischof und seinem Presbyterium zur Seite".
In der lateinischen Kirche sind die Bischofs- und die Priesterweihe mit der Verpflichtung zum Zölibat verbunden, d. h. mit der Pflicht, ehelos und in vollkommener Keuschheit zu leben. Diese Verpflichtung ist vom Wesen des Priestertums nicht gefordert, wie die Praxis der frühesten Kirche und die Tradition der Ostkirchen zeigen; sie muß außerdem im Zusammenhang mit der Sorge für die Seelen, dem obersten Gesetz in der Kirche, gesehen werden. Sie wird in der lateinischen Kirche vom 4. Jahrhundert an von verschiedenen Synoden immer wieder betont, aber erst im 11. Jahrhundert als allgemeines Gesetz erlassen. Das II. Vatikanische Konzil hat dieses Gesetz erneut gebilligt und bekräftigt (vgl. PO 16). Nach den Aussagen des Konzils ist die Zölibatsverpflichtung dem Priestertum in mehrfacher Hinsicht angemessen. Die freiwillige Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen (vgl. Mt 19,12) ist ein besonderes Zeichen der Nachfolge Jesu, der selbst ehelos lebte, des ungeteilten Dienstes für Jesus Christus und seine "Sache" (vgl. 1 Kor 7,32), Zeichen der vollkommenen Hingabe für Gott und die Menschen, des neuen Lebens und der kommenden Welt, die der Priester in besonderer Weise zu bezeugen hat.
Mit dieser Begründung sind die mannigfachen Schwierigkeiten dieses Gesetzes nicht verkannt. Das Konzil geht in der geistlichen Kraft der Hoffnung davon aus, daß der Herr seiner Kirche auch künftig eine hinreichende Zahl von Priestern für den Dienst in den Gemeinden berufen wird, wenn nur die Priester selbst und die Kirche insgesamt inständig darum bitten. Der Priestermangel in vielen Ländern der Welt muß Anlaß sein, um das Entstehen von mehr Initiativen und Verantwortlichkeit in den Gemeinden selbst zu aktivieren. Daß der gegenwärtige Priestermangel in vielen Ländern der Welt ein Symptom einer tieferliegenden und umfassenderen Krise darstellt und nicht isoliert durch die bloße Änderung eines Gesetzes behoben werden kann, wird nicht zuletzt dadurch deutlich, daß in unserer Zeit nicht nur die Ehelosigkeit, sondern auch Ehe und Familie in eine tiefe Krise geraten sind. Beides hängt, wie im nächsten Abschnitt zu zeigen sein wird, zutiefst zusammen.
7. Das Sakrament der Ehe
7.1 Das Wesen der Ehe als Sakrament des Neuen Bundes
Ehe und Familie zählen zu den kostbarsten Gütern der Menschheit. Sie sind die Grundzelle der menschlichen Gemeinschaft. "Das Wohl der Person sowie der menschlichen und christlichen Gesellschaft ist zuinnerst mit einem Wohlergehen der Ehe- und Familiengemeinschaft verbunden" (GS 47). Ehe und Familie werden in unseren Tagen jedoch - wie andere Institutionen und vielleicht noch mehr als diese - in die umfassenden tiefgreifenden und raschen Wandlungen von Gesellschaft und Kultur hineingezogen. Dabei kann man im Blick auf Ehe und Familie von heute Licht und Schatten feststellen. "Einerseits ist man sich der persönlichen Freiheit mehr bewußt, schenkt der Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen in der Ehe, der Förderung der Würde der Frau, der verantworteten Elternschaft, der Erziehung der Kinder größere Aufmerksamkeit... Andererseits aber gibt es Anzeichen einer besorgniserregenden Verkümmerung fundamentaler Werte: eine irrige ... Auffassung von der gegenseitigen Unabhängigkeit der Eheleute; die schwerwiegenden Mißverständnisse hinsichtlich der Autoritätsbeziehung zwischen Eltern und Kindern; die häufigen konkreten Schwierigkeiten der Familie in der Vermittlung der Werte; die steigende Zahl der Ehescheidungen; das weit verbreitete Übel der Abtreibung ... das Aufkommen einer regelrechten empfängnisfeindlichen Mentalität" (FC 6).
In dieser Situation, durch die das Gewissen der Menschen beunruhigt wird, ist es die Aufgabe der Kirche und aller, die in der kirchlichen Verkündigung tätig sind, die grundlegenden Werte von Ehe und Familie neu herauszustellen, um so insbesondere jüngeren Menschen, die am Anfang ihres Weges zu Ehe und Familie stehen, zu helfen, die Schönheit und Größe ihrer Berufung zur Liebe und zum Dienst am Leben zu entdecken, ihnen so neue Horizonte aufzutun (vgl. FC 1) und durch eine neue Familienkultur die neue, aufsteigende Kultur von innen zu evangelisieren und einen Beitrag zu einem neuen Humanismus zu leisten (vgl. FC 8). Aus allen diesen Gründen hat die Kirche in jüngerer Zeit öfter zu Fragen der Ehe und Familie Stellung genommen. Erinnert sei an die Enzykliken Pius XI. "Casti connubii" (1930) und Paul Vl. "Humanae vitae" (1968), an die Aussagen des II. Vatikanischen Konzils (vgl. GS 47-52) und an das alle bisherigen Aussagen zusammenfassende und weiterführende Apostolische Schreiben von Papst Johannes Paul II. "Familiaris consortio" (1981). Von vornehmlich pastoraler und praktischer Bedeutung ist der Beschluß der Gemeinsamen Synode "Christlich gelebte Ehe und Familie".
Das christliche Verständnis von Ehe und Familie ist bereits in der Schöpfungsordnung grundgelegt. Gott, der den Menschen aus Liebe ins Dasein gerufen hat, hat ihn gleichzeitig zur Liebe berufen. Der Mensch ist ja geschaffen nach dem Bild und Gleichnis Gottes (vgl. Gen 1,27), der selbst Liebe ist (vgl. 1 Joh 4,8.16). "Die Liebe ist demnach die grundlegende und naturgemäße Berufung jedes Menschen." Kein Mensch kann ohne Liebe leben. "Die Liebe schließt auch den menschlichen Leib ein, und der Leib nimmt an der geistigen Liebe teil ... Infolgedessen ist die Sexualität, in welcher sich Mann und Frau durch die den Eheleuten eigenen und vorbehaltenen Akte einander schenken, keineswegs etwas rein Biologisches, sondern betrifft den innersten Kern der menschlichen Person als solcher" (FC 11). Die Liebe zwischen Mann und Frau gehört also mit zur Gottebenbildlichkeit des Menschen; sie ist ein Gleichnis der unbedingten und endgültigen Liebe Gottes zu jedem Menschen. Deshalb gilt gerade auch für sie das Urteil: "Es war sehr gut" (Gen 1,31).
Die Wirklichkeit der Sünde hat sich freilich auch auf das Verhältnis von Mann und Frau und auf die Weitergabe des Lebens zerstörerisch und entfremdend ausgewirkt (vgl. Gen 3,7.16). Doch hat Gott Ehe und Familie in die Erlösungsord-nung einbezogen. Schon im Alten Testament wird der Bund zwischen Mann und Frau zum "Bild und Gleichnis" des Bundes Gottes mit den Menschen (vgl. Hos 1-3; Jes 54; 62;Jer 2-3; 31, Ez 16; 23). Dieser Bund Gottes mit den Menschen findet seine endgültige, nicht mehr überbietbare Verwirklichung in Jesus Christus, der Gott und Mensch in einer Person ist und in dem Gott jeden einzelnen Menschen endgültig angenommen hat. Er ist der Bräutigam des Gottesvolkes des Neuen Bundes (vgl. Mk 2,19), der die Kirche, seine Braut, liebt und sich für sie hingegeben hat (vgl. Eph 5,25).
Jesu Stellung zur Ehe kommt am deutlichsten in seinem Wort über die Ehescheidung zum Ausdruck (vgl. Mk 10,2-9 par.).
Hier wird Jesus mit der Streitfrage zwischen den Juden konfrontiert, ob es dem Mann erlaubt sei, seine Frau zu entlassen. Auf den ersten Blick scheint Jesu Antwort das alttestamentliche Gesetz zu verschärfen und damit den Menschen eine schwere Last aufzubürden. In Wirklichkeit läßt sich Jesus auf den Streit und die Auslegung des alttestamentlichen Gesetzes (vgl. Dtn 24,1-4) nicht ein. Er hebt die Frage auf eine andere Ebene. Er erinnert an den ursprünglichen Plan Gottes in der Schöpfung. Zwar weiß er um die Hartherzigkeit der Menschen, die der Verwirklichung von Gottes Schöpferwillen entgegensteht. Doch jetzt, da mit ihm die neue Schöpfung anbricht, kommt der Plan Gottes mit der ersten Schöpfung wieder zur Geltung; ja, durch ihn wird er auch wieder lebbar. So ist Jesu Verbot der Ehescheidung kein äußerliches, nur schwer realisierbares Gesetz, sondern Ausdruck des Neuen Bundes, eine gnadenhaft geschenkte neue Möglichkeit, den tiefsten Sinn der Schöpfungs- und Erlösungsordnung, das Leben aus der Liebe und Treue zu verwirklichen. So können wir zusammenfassend sagen: Die Ehe gehört nach der Verkündigung Jesu sowohl der Schöpfungs- wie der Heilsordnung an.
Schon der Apostel Paulus mahnt, die Ehe "im Herrn" einzugehen (1 Kor 7,39). Die Ehe ist also hineingenommen in das durch die Taufe begründete neue Sein "in Christus". Deshalb sind Ehe und Familie in den neutestamentlichen Haustafeln der Ort besonderer christlicher Bewährung. Das praktische Verhalten von Mann und Frau soll sich orientieren an der Liebe, Treue, Hingabe und dem Gehorsam Jesu Christi (vgl. Kol 3,18-19; 1 Petr 3,1-7; 1 Tim 2,8-15; Tit 2,1-6). Die für diesen Zusammenhang wichtigste Haustafel findet sich im Epheserbrief. Hier wird der Bund zwischen Mann und Frau in der Ehe als Abbild des Bundes zwischen Christus und der Kirche beschrieben.
- "Einer ordne sich dem andern unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn... Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat... Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis; ich beziehe es auf Christus und die Kirche."(Eph 5,21-22.25.31)
Zweifellos spiegelt dieser Text auch Züge des damaligen Eheverständnisses, wonach die Frauen den Männern untergeordnet waren. Doch der Text sprengt zugleich ein patriarchalisches Verständnis der Ehe; er spricht nämlich auch umgekehrt von der Liebe und Hingabe der Männer und damit von einer gegenseitigen Unterordnung. Die wichtigste Aussage dieses Textes ist, daß die Liebe und Treue zwischen Christus und der Kirche nicht nur ein Vorbild für die Ehe ist; die Liebe zwischen Mann und Frau in der Ehe ist vielmehr vergegenwärtigendes Zeichen der in Jesus Christus endgültig erschienenen und in der Kirche bleibend gegenwärtigen Liebe und Treue Gottes. "Die Ehe der Getauften wird so zum Realsymbol des neuen und ewigen Bundes, der im Blut Christi geschlossen wurde" (FC 13).
In den Aussagen der Heiligen Schrift, besonders in denen des Epheserbriefs, fand die kirchliche Überlieferung die Sakramentalität der Ehe angedeutet (vgl. DS 1799; NR 733). Ausdrücklich findet sich diese Lehre freilich erst im hohen Mittelalter (vgl. DS 1327; 1797-1812; NR 730; 731-746). Diese Lehre will nicht etwa die Ehe mystifizieren oder zu einer ganz von der Kirche abhängigen Wirklichkeit machen. Sie anerkennt vielmehr, daß die Ehe eine eigene Schöpfungswirklichkeit ist und daß sie als solche in die Erlösungsordnung einbezogen ist. Deshalb kommt eine gültige Ehe allein durch das in der kirchlich vorgeschriebenen Form zum Ausdruck gebrachte Vermählungswort (Ja-Wort; Konsens) der Brautleute zustande. Dieser Konsens kann, wie das kirchliche Recht sagt, durch keine Macht der Welt ersetzt werden. Eine eigene kirchliche Form des Eheabschlusses hat die Kirche im übrigen erst im Mittelalter entwickelt; allgemein verpflichtend und für die Gültigkeit der Ehe maßgebend wurde diese sogar erst durch das Trienter Konzil (1545-1563) (vgl. DS 1813-1816). Von dieser kirchlichen Formpflicht kann jedoch aus triftigen Gründen dispensiert werden, wenn nur eine öffentliche Form des Ehekonsenses gewahrt wird.
An dieser Stelle ergibt sich unter den heutigen Umständen freilich eine neue Schwierigkeit. Wir können nicht voraussetzen, daß alle Brautleute, die sich kirchlich trauen lassen wollen, mit ihrem Ja-Wort auch den Glauben der Kirche an die Sakramentalität der Ehe verbinden. Die Frage des Verhältnisses von Glaube und Sakrament stellt sich bei der Ehe in besonders vordringlicher Weise. Da die Brautleute durch ihre Taufe in Christus und in die Kirche eingegliedert sind, muß man voraussetzen, daß sie wenigstens einschlußweise dem zustimmen, was die Kirche meint, wenn sie eine Eheschließung vornimmt. Wenn sie jedoch trotz aller pastoralen Bemühung ausdrücklich und formell zurückweisen, was die Kirche bei der Eheschließung von Getauften meint, muß der Seelsorger sie darauf hinweisen, daß nicht die Kirche, sondern sie selber es sind, die die Feier verhindern, um die sie bitten (vgl. FC 68).
Das sakramentale Zeichen der Ehe ist also der personale freie Akt, "in dem sich die Eheleute gegenseitig schenken und an nehmen" (GS 48). Deshalb spenden sich nach der meist vertretenen theologischen Meinung die Brautleute das Sakrament der Ehe gegenseitig durch die Erklärung ihres Ehewillens (Ja-Wort, Konsens). Dieser findet seine Erfüllung darin, daß beide zu einem Fleisch werden (vgl. Gen 2,24; Mk 10,8), was alle Bereiche des Lebens umfaßt.
Der Priester, welcher der Trauung assistiert, nimmt dieses Ja-Wort im Namen der Kirche entgegen und spricht darüber den Segen der Kirche. Damit bringt er zum Ausdruck, daß die Ehe nicht nur die Privatangelegenheit der Brautleute ist, sondern ein öffentliches Zeichen der Liebe und Treue Gottes. Das geht schon aus Hos 2,21-22 hervor, wo Recht und Gerechtigkeit, Liebe, Erbarmen und Treue zu den Gütern des Ehebundes Gottes mit seinem Volk gehören. Die öffentliche und bei Katholiken im Normalfall die kirchliche Form der Eheschließung ist deshalb keine äußerliche Formalität, kein bloßer Trauschein oder gar eine unangemessene staatliche und kirchliche Einmischung. Die Öffentlichkeit des Eheversprechens nimmt diesem auch nicht den diskreten Ursprung in der unmittelbaren und ganz persönlichen Liebe der Partner; sie bedeutet vielmehr Schutz und Anerkennung, Unterstützung und Zeugenschaft für das ergangene Ja-Wort und für den gemeinsamen Weg. Umgekehrt sind die Eheleute füreinander, für ihre Kinder und für die gesamte Kirche Zeugen des Heils, an dem sie durch das Sakrament in besonderer Weise teilhaben (vgl. AA 11). Die Ehe ist eine Art Hauskirche, eine Kirche im kleinen (vgl. LG 11). Dabei sind Ehe und Familie nicht nur eine Darstellung und eine Ausformung des Wesens der Kirche; sie tragen vielmehr eigenständig und aktiv zur Auferbauung der Kirche bei. Sie sollen lebendige Zellen in der Kirche und in der Gemeinde sein.
Durch das Ja-Wort, in dem sich die Brautleute gegenseitig schenken, werden sie in besonderer Weise in den Bund Gottes mit den Menschen hineingenommen. Gott selbst ist es, der sie verbindet (vgl. Mk 10,9), so daß sie fortan vor Gott, voreinander und vor der menschlichen Gemeinschaft zueinander gehören. Die kirchliche Lehre spricht in diesem Zusammenhang vom Eheband als Abbild des unverletzlichen Bundes Gottes mit den Menschen. Ihr Bund ist damit der eigenen Willkür wie der der Kirche und der menschlichen Gesellschaft entzogen.
Die Gnade des Ehesakraments besteht wie bei jedem Sakrament in einem Dreifachen: Durch ihre Liebe und Treue machen die Eheleute Gottes Liebe und Treue in Jesus Christus erinnernd gegenwärtig. Sie erhalten zum andern daran Anteil; ihre "eheliche Liebe wird in die göttliche Liebe aufgenommen und durch die erlösende Kraft Christi und die Heilsvermittlung der Kirche gelenkt und bereichert" (GS 48). "Sie fördern sich kraft des Sakramentes der Ehe gegenseitig zur Heiligung durch das eheliche Leben sowie in der Annahme und Erziehung der Kinder und haben so in ihrem Lebensstand und in ihrer Ordnung ihre eigene Gabe im Gottesvolk (vgl. 1 Kor 7,7)" (LG 11). Schließlich ist die christliche Ehe zeichenhafte Vorwegnahme der endzeitlichen Hochzeit, der Freude und Erfüllung aller Wirklichkeit in Gottes Liebe (vgl. Mk 2,19-20;Mt 22,1-14, 25,1-13 u. a.). Deshalb ist es nicht nur ein allgemein-menschliches und bürgerliches Bedürfnis, die Hochzeit möglichst feierlich und festlich zu begehen; solcher Glanz hat als hoffnungserweckende Vorfeier der endzeitlichen Hochzeit auch christlich seinen guten Sinn.
Der Hinweis auf die endzeitliche Hochzeit zeigt freilich auch, daß die Ehe der vorläufigen Ordnung dieser Welt angehört (vgl. Mk 12,25; 1 Kor 7,25-38). Sie ist noch nicht die endgültige Erfüllung. Als Hinweis auf das endgültige Ziel gibt es in der Kirche darum neben dem Stand der Ehe auch den Stand der frei willigen Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen (vgl. Mt 19,12). Der um des Himmelreiches willen freiwillig Ehelose ist als solcher kein besserer Christ als der Verheiratete. Er will vielmehr zeichenhaft eine Grunddimension des gemeinsamen Christseins aller Getauften ausdrücken: die Vorläufigkeit aller irdischen Ordnungen und ihre Ausrichtung auf das eine Notwendige, das Reich Gottes. Deshalb will er schon jetzt ganz und ungeteilt frei sein für den Herrn und "seine Sache" (1 Kor 7,32). So steht die Wertschätzung der freiwilligen Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen in keinem Widerspruch zum hohen Wert der Ehe; sie setzt den Wert der Ehe vielmehr voraus und bekräftigt ihn. Würde die menschliche Sexualität nicht als ein hoher, vom Schöpfer geschenkter Wert betrachtet, dann würde auch der Verzicht darauf seine Bedeutung verlieren. Umgekehrt wird die Ehe erst dadurch zu einer wirklich frei gewählten Lebensform, wenn es neben ihr eine andere öffentlich anerkannte Lebensform gibt. So sind Ehe und freiwillige Ehelosigkeit zwei Weisen, um das eine Geheimnis des Bundes zwischen Gott und den Menschen darzustellen und zu leben. Sie brauchen sich gegenseitig, ja, sie stehen und fallen miteinander. Berufungen zur Ehelosigkeit sind Zeichen gesunder christlicher Ehen; die Abwertung der freiwilligen Ehelosigkeit dagegen muß notwendig zur Verkennung der christlichen Werte der Ehe führen (vgl. FC 16). Die heutige Krise der christlichen Ehe wie die der freiwilligen Ehelosigkeit bedingen sich darum gegenseitig und können in pastoral verantwortlicher Weise nur zusammen gemeistert werden.
7.2 Die Wesenseigenschaften der Ehe: Einheit, Fruchtbarkeit, unauflösliche Treue
Bei der kirchlichen Trauung wird das Ja-Wort der Brautleute in dreifacher Form erfragt und gegeben. Damit kommt zum Ausdruck, daß dieses Ja konkret drei Dimensionen hat, die alle drei für die Gültigkeit von maßgeblicher Bedeutung sind: das Ja zur Einheit, zur Fruchtbarkeit und zur unauflöslichen Treue in der Ehe.
Die Liebe der Eheleute tendiert von ihrem ganzen Wesen her auf die Einheit in einer personalen Gemeinschaft, die alle Bereiche des Lebens umfaßt. "Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins" (Mt 19,6; vgl. Gen 2,24) und berufen, in ihrer Einheit ständig zu wachsen durch die Treue, mit der sie täglich zu ihrem Eheversprechen stehen. "Die Ehegemeinschaft wurzelt in der natürlichen Ergänzung von Mann und Frau und lebt aus dem persönlichen Willen der Gatten, ihr ganzes Leben zu teilen, das, was sie haben, und das, was sie sind." Diese menschliche Gemeinschaft wird durch die durch das Sakrament der Ehe geschenkte Gemeinschaft in Jesus Christus bestätigt, geläutert und vollendet. Sie wird immer wieder vertieft durch gemeinsames Gebet und durch den gemeinsamen Empfang der Eucharistie. "Einer solchen Gemeinschaft widerspricht die Polygamie: Sie leugnet in direkter Weise den Plan Gottes ... sie widerspricht der gleichen personalen Würde von Mann und Frau, die sich in der Ehe mit einer Liebe schenken, die total und eben dadurch einzig und ausschließlich ist" (FC 19).
Auch die Fruchtbarkeit gehört wesentlich zur Ehe. Denn es liegt im Wesen der ehelichen Liebe selbst, daß sie fruchtbar werden will. Das Kind als Frucht der gemeinsamen Liebe kommt deshalb nicht äußerlich oder beliebig zur gegenseitigen Liebe der Eheleute hinzu; es ist vielmehr deren Verwirklichung und Erfüllung. Dieser Dienst am Leben ist den Eheleuten von Gott selbst bei der Schöpfung aufgetragen, ja eingeschrieben worden: "Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar, und vermehrt euch" (Gen 1,28). Durch die Fruchtbarkeit nehmen die Eheleute teil an Gottes schöpferischer Liebe; sie sind gleichsam Mitarbeiter des liebenden Schöpfergottes und Interpreten seiner Liebe. Die Fruchtbarkeit der ehelichen Liebe beschränkt sich jedoch nicht auf die Zeugung; sie wird weiter und reicher durch Früchte des sittlichen, geistigen und übernatürlichen Lebens, welche die Eltern ihren Kindern durch die Erziehung weitergeben. Die Eltern sind ja die ersten und die bevorzugten Erzieher ihrer Kinder (vgl. GE 3). In diesem umfassenden Sinn ist es die grundlegende Aufgabe von Ehe und Familie, dem Leben zu dienen (vgl. GS 50; FC 28). Aus diesem Grund können auch ältere Christen, die bei Eheabschluß keine Kinder mehr erwarten können, und Eheleute, denen Kindersegen versagt ist, eine menschlich und christlich sinnvolle Ehe führen.
Diese Sendung trifft heute aus vielfältigen Gründen auf eine gesellschaftliche und kulturelle Situation, in der es vielen Eheleuten schwerfällt, sich die Lehre der Kirche innerlich zu eigen zu machen und sie in ihrem Tun zu verwirklichen. Die Kirche weiß um die oft belastende und manchmal quälende Situation vieler Eheleute und um die vielfältigen Schwierigkeiten persönlicher und sozialer Art. Sie muß sich aber gerade angesichts der oft lebensfeindlichen Mentalität der Gegenwart auf die Seite des Lebens stellen. Die sittliche Ordnung wurde ja nicht von der Kirche geschaffen und hängt nicht von deren Gutdünken ab; sie ist von Gott selbst dem Menschen gegeben, ja eingeschrieben. Deshalb müssen die Eheleute in verantwortlicher Elternschaft die Entscheidung über die Zahl ihrer Kinder im Angesicht Gottes letztlich selbst treffen. Sie dürfen dabei freilich nicht nach eigener Willkür vorgehen, sondern müssen sich von einem Gewissen leiten lassen, das sich ausrichtet am göttlichen Gebot und dessen Auslegung durch das Lehramt der Kirche, wonach die eheliche Liebe offen sein muß für das neue Leben. In dieses Urteil müssen sie ihr eigenes Wohl wie das ihrer Kinder - der schon geborenen wie der noch zu erwartenden -, die materiellen und geistigen Verhältnisse, das Wohl der Gesamtfamilie, der weltlichen Gesellschaft und der Kirche einbeziehen (vgl. GS 50; FC 29-33). Besonders angesichts der genannten Schwierigkeiten gilt für die verantwortliche Elternschaft das Gesetz des stufenweisen Weges, der ständigen Bemühung, die entgegenstehenden Schwierigkeiten durch die Haltung von Zucht und Maß, durch Gebet und regelmäßigen Empfang der Sakramente zu überwinden (vgl. FC 34).
Schließlich gehört zum Wesen ehelicher Liebe ihre unaufösliehe Treue. Sie ergibt sich aus der Ganzheitlichkeit, mit der sich die Eheleute gegenseitig schenken und annehmen; Liebe, die diesen Namen verdient, ist immer endgültig und kann nie nur bis auf weiteres und zur Probe geschenkt werden. Dazu kommt, daß auch das Wohl der Kinder die unbedingte und unauflösliche Treue der Ehegatten erforderlich macht. Sie ist von Gott bei der Schöpfung selbst gewollt: "Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen" (Mk 10,9). Die tiefste Begründung liegt in der Treue Gottes zu seinem Bund, besonders in der unauflöslichen Treue, die Christus seiner Kirche entgegenbringt und von der das Sakrament der Ehe Zeichen und Frucht darstellt. So erhält die Unauflöslichkeit der Ehe durch das Sakrament der Ehe eine besondere Festigkeit. Gerade heute ist es eine der wichtigsten und dringlichsten Pflichten der Kirche, den Wert der Unauflöslichkeit und der ehelichen Treue herauszustellen und denen, die es für schwierig, ja für geradezu unmöglich halten, sich für das ganze Leben an einen Menschen zu binden, die Frohbotschaft von der Endgültigkeit der Liebe und Treue Gottes zu uns, an der die Ehe teilhat und von der sie gehalten und getragen wird, zu bezeugen; die Kirche will damit auch denen Anerkennung, Hilfe und Ermutigung geben, die sich oft unter erheblichen Schwierigkeiten um die Treue in der Ehe bemühen. Aber auch der Wert des Zeugnisses jener Eheleute muß Anerkennung finden, die, obwohl sie von ihrem Partner verlassen wurden, in der Kraft des Glaubens und der christlichen Hoffnung keine neue Verbindung eingegangen sind (vgl. FC 20).
Die Kirche hat freilich von allem Anfang an die schmerzliche Erfahrung gemacht, daß auch Ehen unter Christen scheitern können. Es gibt Situationen, in denen, nachdem sich jeder andere vernünftige Versuch, die Ehe zu retten, als vergeblich erwiesen hat, als äußerstes Mittel die Trennung der Ehegatten angesehen werden muß. Sie ist kirchlich möglich, und die kirchliche Gemeinschaft muß solchen Menschen helfen, damit sie mit ihrer schwierigen Situation zurechtkommen und die Treue wahren können (vgl. FC 83).
Viele von denen, die sich scheiden lassen, gehen freilich ohne kirchliche Trauung eine neue Verbindung ein. Man muß die Situation solcher bürgerlich wiederverheiratet Geschiedener gerecht beurteilen. Es ist nämlich ein Unterschied, ob jemand trotz aufrichtigen Bemühens um die frühere Ehe zu Unrecht verlassen wurde oder ob jemand eine gültige Ehe durch eigene schwere Schuld zerstört hat. Es ist wichtig zu wissen, daß diese Christen in ihrer schwierigen Situation nicht aus der Kirche ausgeschlossen sind. Die Priester und die ganze Gemeinde sollen ihnen vielmehr in fürsorgender Liebe beistehen, damit sie sich nicht als von der Kirche getrennt betrachten, an deren Leben sie als Getaufte teilnehmen können und sollen. So können und sollen sie vor allem das Wort Gottes hören, an der Feier der Eucharistie teilnehmen, regelmäßig beten, an den Werken der Nächstenliebe und Initiativen zur Förderung der Gerechtigkeit mitwirken. "Die Kirche soll für sie beten, ihnen Mut machen, sich ihnen als barmherzige Mutter erweisen und sie so im Glauben und in der Hoffnung stärken" (FC 84).
Die katholische Kirche hält jedoch in Treue zum Wort Jesu Christi daran fest, daß sie eine solche Verbindung, wenn die erste Ehe gültig war und solange der erste Ehepartner lebt, nicht als sakramentale Ehe anerkennen kann. Da solche bürgerlich wiederverheiratet Geschiedenen objektiv im Widerspruch zu Gottes Ordnung leben, können sie, solange sie an der vollen ehelichen Gemeinschaft festhalten, nach der Praxis der Kirche nicht zum eucharistischen Mahl zugelassen werden (vgl. FC 84). Daraus ergeben sich ohne Zweifel nicht nur für die betroffenen Christen, sondern auch für viele Seelsorger oft schwierige Probleme, bei denen es nicht leicht ist, die Treue zur Wahrheit, zu der die Kirche um der Liebe willen verpflichtet ist, mit der von der christlichen Liebe und Barmherzigkeit in einer schwierigen konkreten Situation geforderten Duldung und Nachsicht zu vereinbaren (vgl. Gem. Synode, Christlich gelebte Ehe und Familie 3.4). Das kirchliche Recht kann nur eine allgemein gültige Ordnung aufstellen, es kann jedoch nicht alle oft sehr komplexen einzelnen Fälle regeln. Immer muß es freilich das erste pastorale Anliegen sein, daß bei den Gläubigen keinerlei Irrtum und Verwirrung hinsichtlich der Lehre und der Praxis der Kirche über die Unauflöslichkeit der Ehe entsteht. Gerade in unserer Zeit muß die Kirche in dieser Frage ein eindeutiges Zeichen sein.
7.3 Die bekenntnisverschiedene Ehe
Eine große Zahl verheirateter Katholiken in Deutschland lebt heute in einer bekenntnisverschiedenen Ehe. Durch die stete Umschichtung weiter Bevölkerungsteile ist die konfessionsverschiedene Ehe heute längst keine Ausnahme mehr; auch die Einstellung vieler Katholiken dazu hat sich in den letzten Jahrzehnten erheblich verändert. Die Situation der bekenntnisverschiedenen Ehe hat vielfache Aspekte, die in diesem Zusammenhang nicht alle behandelt werden können. Wir beschränken uns im folgenden auf die Ehe zwischen einem katholischen und einem evangelischen Christen. Über die teilweise anderen Bestimmungen für Ehen mit orthodoxen Christen sollte man sich beim zuständigen Pfarramt informieren.
Auf der einen Seite kann die Konfessionsverschiedenheit der Ehepartner eine befruchtende Wirkung für den Glauben der Gatten und damit auch für ihre Ehe haben, wenn beide Partner ihr eigenes kirchliches Erbe in Ehe und Familie einbringen, voneinander lernen und so ihr gemeinsames Leben vertiefen und bereichern. Andererseits dürfen aber auch die Schwierigkeiten konfessionsverschiedener Ehen nicht unterschätzt werden. Sie ergeben sich aus der noch nicht überwundenen und noch immer schmerzlich spürbaren Trennung der Kirchen. Nicht nur wichtige, bisher nicht überwundene Unterschiede im Glauben, auch konfessionelle Vorurteile, unterschiedliche konfessionelle Mentalitäten u. a. können zur Belastung der Ehe werden und unter Umständen zu einer Entfremdung der Ehepartner führen. Die Schwierigkeiten zeigen sich meistens in der Frage der Kindererziehung und des Gottesdienstbesuches. Nicht selten weichen konfessionsverschiedene Ehen wegen solcher Schwierigkeiten in eine vermeintliche Neutralität aus; sie klammern religiöse Fragestellungen aus, was dann zur Entfremdung beider Partner sowie ihrer Kinder von ihrer Kirche führt.
Die Unterschiede zwischen den getrennten Kirchen betreffen nicht zuletzt auch das Verständnis der Ehe. Gemeinsam sind sie der Auffassung, daß die Ehe Gottes Ordnung darstellt und unter seinem Segen steht. Doch während die katholische Kirche die Ehe zu den Sakramenten der Kirche zählt, hat Luther die Ehe als "ein äußerlich-weltlich Ding" bezeichnet. Er wollte damit nicht sagen, die Ehe sei eine rein profane Größe, vielmehr gehöre die Ehe nicht der Heilsordnung, sondern allein der Schöpfungsordnung an. Von dieser Voraussetzung her mußte Luther der Kirche die Kompetenz für eine rechtliche Ordnung der Ehe absprechen und den Eheabschluß in die Hand der weltlichen Autorität legen. Deshalb ist für einen Protestanten die vor dem Standesamt geschlossene Ehe auch vor Gott und vor der Kirche gültig; sie wird kirchlich nur eingesegnet. Für den Katholiken dagegen kommt eine vor Gott und der Kirche gültige Ehe nur durch einen kirchlichen Eheabschluß zustande, es sei denn, es werde von dieser "Formpflicht" ausdrücklich dispensiert. Die standesamtliche Trauung regelt nach katholischem Verständnis normalerweise nur die bürgerlichen Rechtsfolgen. In diesen konkreten Unterschieden zeigt sich nochmals die unterschiedliche Verhältnisbestimmung von Schöpfungs- und Erlösungsordnung, von Kirche und Welt wie überhaupt das unterschiedliche Kirchenverständnis.
Um den veränderten Verhältnissen und der inzwischen geschehenen ökumenischen Annäherung gerecht zu werden, wurden die kirchenrechtlichen Bestimmungen für bekenntnisverschiedene Ehen im Jahr 1970 erneuert und dann durch das neue kirchliche Gesetzbuch von 1983 teilweise nochmals neu gefaßt (vgl. can. 1124-1129). Nach dem neuen kirchlichen Recht stellt die Bekenntnisverschiedenheit nicht mehr wie bisher ein Ehehindernis dar; zum Abschluß einer bekenntnisverschiedenen Ehe ist jedoch eine ausdrückliche Erlaubnis der zuständigen kirchlichen Autorität notwendig. Die Erlaubnis setzt voraus, daß der katholische Partner sich bereiterklärt, in seiner Ehe als katholischer Christ zu leben und den Glauben zu bezeugen und sich nach Kräften für die Taufe und die Erziehung der Kinder im katholischen Glauben einzusetzen. Da aber die Erziehung der Kinder Sache beider Eltern ist und keiner der Ehepartner zu einem Handeln gegen sein Gewissen veranlaßt werden darf, besteht diese Verpflichtung darin, das in der konkreten Situation nach bestem Wissen und Gewissen Mögliche zu tun.
Der Eheabschluß soll in katholischer Form geschehen. Stellen sich dem schwerwiegende Gründe entgegen, dann kann der Bischof von dieser Verpflichtung dispensieren; freilich muß zur Gültigkeit der Trauung irgendeine öffentliche Form des Abschlusses, sei es standesamtlich, sei es in einer anderen Kirche oder kirchlichen Gemeinschaft, stattfinden. Dabei ist eine religiöse Form des Eheabschlusses normalerweise einer rein standesamtlichen vorzuziehen. Wenn die Brautleute es wünschen, daß Pfarrer beider Kirchen bei der Trauung mitwirken, soll nach Möglichkeit diesem Wunsch entsprochen werden. Eine solche "Gemeinsame kirchliche Trauung" stellt freilich keine Doppeltrauung dar; die Trauung findet vielmehr entweder in katholischer oder in nichtkatholischer Form statt, wobei jeweils der Pfarrer der anderen Kirche durch Gebet und Segen mitwirkt.
Die gewandelte ökumenische Situation hat dazu geführt, daß die Kirchen im letzten Jahrzehnt eine gemeinsame ehebegleitende Seelsorge für konfessionsverschiedene Ehen und Familien begründet haben. Ihre Aufgabe ist es, zu helfen, daß die Ehepartner zu einer guten Ehe finden und es lernen, ihre Ehe aus christlichem Glauben zu leben. Sie soll zudem helfen, die Spannungen zwischen der Bindung der Ehepartner aneinander und an ihre Kirchen tragbar zu machen. Sie soll dazu ermutigen, daß das im Glauben der Ehepartner Gemeinsame zum Tragen kommt und das Trennende vom anderen Partner bewußt respektiert wird. Eine solche gemeinsame ehebegleitende Seelsorge setzt ein Klima vertrauensvoller Zusammenarbeit zwischen den Kirchen, besonders den Pfarrern beider Kirchen auch auf anderen Gebieten, voraus.
Bezüglich des Gottesdienstbesuchs sollte der Grundsatz gelten: Jeder der beiden Partner soll gemäß seinem Gewissen in seinem Glauben verwurzelt und in seiner Kirche beheimatet bleiben. Dazu gehören der regelmäßige Gottesdienstbesuch in der eigenen Kirche und das liebevolle Verständnis dafür, daß der Ehepartner am sonntäglichen Gottesdienst seiner Kirche teilnehmen möchte. Bei passender Gelegenheit sollten bekenntnisverschiedene Paare die Gottesdienste ihrer Kirchen aber auch gemeinsam besuchen (vgl. Gem. Synode, Pastorale Zusammenarbeit der Kirchen im Dienst an der christlichen Einheit 7).
In keinem anderen Sakrament wird die Schöpfungswirklichkeit so unmittelbar zu einem sakramentalen Zeichen des Heils wie in der Ehe. In keinem anderen Sakrament kommt es aber auch zu einer solchen Überlagerung und Spannung zwischen der alten, von der Sünde verwirrten Welt und der neuen, in Jesus Christus erschienenen Welt. Die schwierigen pastoralen Situationen, von denen die Rede war, sind Zeichen von diesem im Einzelfall oft kaum entwirrbaren Ineinander. So weist gerade das Sakrament der Ehe über die gegenwärtige Zeit zwischen dem Kommen Jesu Christi in Niedrigkeit und seiner Ankunft in Herrlichkeit hinaus auf das himmlische Hochzeitsmahl und das Leben der kommenden Welt.
V. Das Leben der kommenden Welt
1. Was dürfen wir hoffen?
Der letzte Satz des Glaubensbekenntnisses: "Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt" ist die christliche Antwort auf die Urhoffnung des Menschen. Diese Antwort liegt uns heutigen Menschen irgendwie nahe und ist vielen doch zugleich zutiefst fremd. Sie liegt uns nahe als Ausblick der Hoffnung. Denn Hoffen ist urmenschlich. Kein Mensch kann ohne Hoffnung leben. Die Hoffnung ist vom bloßen Optimismus verschieden, der meint, daß sich die Dinge schon irgendwie einrichten werden. Die Hoffnung reicht tiefer und weiter. Sie ist die auf die Zukunft gerichtete Erwartung, daß das öde Einerlei und die Last des Alltags, die Ungleichheit und Ungerechtigkeit in der Welt, die Wirklichkeit des Bösen und des Leidens nicht das letzte Wort haben und nicht die letzte Wirklichkeit sind. Die Hoffnung setzt darauf, daß die Wirklichkeit offen ist. Diese Erwartung des Neuen bleibt freilich zwiespältig. Gerade heute greift bei vielen Menschen Angst vor den Bedrohungen der Zukunft um sich. Der stärkste Einwand gegen alle rein innerweltliche Hoffnung ist der Tod. Doch mit dem Schicksal des Todes konnte sich die Menschheit im Grunde nie abfinden. So sprechen alle Religionen in irgendeiner Art und Weise von der Hoffnung über den Tod hinaus. Die Frage: Was dürfen wir hoffen? ist jedoch nicht nur eine religiöse Frage, sie ist auch eine Urfrage des menschlichen Denkens. Sie ist untrennbar von der Frage: Was bleibt, was trägt, was ist der Sinn des Lebens, der Welt, der Geschichte? Wozu sind wir auf Erden?
Der letzte Satz des Glaubensbekenntnisses ist vielen heutigen Menschen freilich zutiefst fremd. Er gibt uns eine Fülle von Fragen auf, wenn wir seine Antwort bedenken. Sie wird entfaltet in der Lehre von den "Letzten Dingen": Tod, Gericht, Himmel, Hölle, Fegfeuer, Auferstehung der Toten, Wiederkunft Christi, Weltgericht, Weltuntergang und Neuschaffung der Welt. Man braucht diese Themen nur zu nennen, um gleich zu spüren, daß das christliche Bekenntnis dem modernen Menschen mit jeder dieser Antworten eine Fülle von Problemen aufgibt. Wie sollen wir diese Aussagen mit unseren heutigen Vorstellungen von einem evolutiven Kosmos vereinbaren? So verwandelt sich für uns heute die Frage: Was dürfen wir hoffen? sehr schnell in die Frage: Was können wir wissen? Können wir überhaupt etwas Zuverlässiges wissen von einem Leben jenseits des Todes? Bleibt es nicht eher bei einem großen Vielleicht? Oder sind alle diese Aussagen gar nur Projektionen unserer Wünsche und Sehnsüchte, vielleicht sogar bloße Vertröstungen, die uns von der Verantwortung und von der Freude im Diesseits abhalten? Viele Zeitgenossen sind der Meinung, wichtiger als solchen, wie sie meinen, illusionären Hoffnungen nachzusinnen, sei die Frage: Was können wir tun? Was können wir tun, um das Glück, den Frieden, die Gerechtigkeit und die Freiheit in dieser Welt zu sichern und zu vermehren? Statt auf ein neues Leben im Jenseits hoffen sie auf ein besseres Leben im Diesseits.
Angesichts solcher Fragen ist der christliche Glaube heute in besonderer Weise herausgefordert, allen Menschen Rechenschaft zu geben von der Hoffnung, die uns erfüllt (vgl. 1 Petr 3,15). Um dies leisten zu können, müssen wir uns zunächst des Fundaments der christlichen Hoffnung versichern. Ausgangspunkt und Grund der christlichen Hoffnung sind nicht irgendwelche Wunschträume, Projektionen und Spekulationen, kein billiger Optimismus auf einen glücklichen Ausgang, kein "Prinzip Hoffnung" und kein Glaube an den Fortschritt, an die Evolution oder Revolution. Im Glauben können wir über unsere Zukunft nur deshalb etwas aussagen, weil diese Zukunft in Jesus Christus schon begonnen hat. Es ist die Grundüberzeugung, ja die Mitte des christlichen Glaubens, daß Jesus Christus der erste der von den Toten Auferweckten ist (vgl. Röm 8,29; 1 Kor 15,20; Kol 1,18). Grund und bleibender Maßstab unserer Hoffnung ist also die Auferstehung Jesu Christi. Alles, was wir als Christen über unsere Auferstehung zum ewigen Leben sagen können, ist nur die Entfaltung und die Verlängerung der Grundaussage unseres Glaubens über Jesus Christus, seine Auferstehung und seine Erhöhung. Weil wir nämlich durch Glaube und Taufe mit Jesus Christus und seinem Tod verbunden sind, dürfen wir hoffen, künftig auch mit seiner Auferstehung verbunden zu sein (vgl. Röm 6,5). Der hl. Augustinus hat diesen Zusammenhang trefflich formuliert: "Christus verwirklichte, was für uns noch Hoffnung ist. Was wir erhoffen, sehen wir nicht. Aber wir sind der Leib jenes Hauptes, in dem Wirklichkeit wurde, was wir erwarten."
Nach der Heiligen Schrift ist es das Werk des Heiligen Geistes, die ganze Schöpfung in die mit Jesus Christus begonnene neue Schöpfung hineinzunehmen und der künftigen Verklärung entgegenzuführen. Das ist der Grund, weshalb die Glaubensaussagen über das Leben der kommenden Welt den Abschluß des dritten Teils des Glaubensbekenntnisses bilden, der insgesamt dem Wirken des Heiligen Geistes gewidmet ist.
Der Glaube an Jesus Christus und an das Wirken des Heiligen Geistes erlaubt uns freilich keine vorwegnehmende Reportage der Wirklichkeit nach dem Tod und keinen Fahrplan der Ereignisse am Ende der Zeit. Was uns die Heilige Schrift darüber sagt, sind Bilder und Gleichnisse, die auf einer anderen Ebene liegen als naturwissenschaftliche Hypothesen, sei es über den Kältetod des Kosmos oder über ein pulsierendes Universum. Man muß außerdem zwischen dem verbindlichen Glaubensinhalt des biblischen Zeugnisses und den literarischen Ausdrucksformen unterscheiden. Die Aussagen des Glaubens wollen uns keine Beschreibung des ewigen Lebens und der künftigen Welt nach Art innerweltlicher Gegenstände geben; ihr Sinn ist vielmehr, uns angesichts der kommenden Welt Trost, Mut und Hoffnung zuzusprechen, sie wollen uns aber auch zur Umkehr mahnen, weil dem Nichtumkehrenden das kommende Gericht droht. So können wir aufgrund der Aussagen der Heiligen Schrift kein Zukunftsgemälde vom Jüngsten Tag entwerfen und uns weder den Himmel noch die Hölle ausmalen und ausdenken. Die bekannten künstlerischen Darstellungen von Himmel und Hölle, Weltgericht und Vollendung verlieren damit selbstverständlich nicht ihre Bedeutung. Sie sollen und können uns zur Besinnung führen, aber sie können uns keine gegenständliche Vorstellung von dem vermitteln, "was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist: das Große, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben" (1 Kor 2,9). Wenn wir als Christen inhaltlich von dieser Hoffnung reden, dann müssen wir uns also der Begrenztheit unserer Vorstellungen und Begriffe und der Sprachnot aller unserer Aussagen bewußt sein. Das tut der Gewißheit der christlichen Hoffnung keinen Abbruch. Sie ist in der Treue Gottes fest begründet.
2. Tod und Auferstehung
2.1 Der Tod in christlicher Sicht
"Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfangen" (Gotteslob 654), so beginnt ein schon aus dem 11. Jahrhundert stammendes Kirchenlied. Dieses Lied sagt uns, daß der Tod, von dem hier die Rede ist, nicht nur der medizinische und biologische Tod ist, nämlich das endgültige Aufhören unserer Herz-und Hirnfunktionen. Der Tod ist auch nicht nur das letzte Stündlein, von dem keiner weiß, wann es ihm schlägt. Der Tod ragt schon in dieses unser Leben herein, er bestimmt und bedroht das Leben jeden Tag aufs neue in hundertfacher Weise. Krankheit, Mißerfolg, Leiden sind Vorboten des Todes; sie sind Zeichen dafür, daß wir unser Leben letztlich nicht in der Hand haben, daß es uns vielmehr immer wieder entgleitet und daß es uns im Tod endgültig entzogen wird. So bestimmt der Tod unser ganzes Leben. Er bestimmt es als endlich und begrenzt; es nimmt nur eine bestimmte Spanne Zeit zwischen Geburt und Tod ein. "Unser Leben währt siebzig Jahre, und wenn es hoch kommt, sind es achtzig" (Ps 90,10). Im Kirchenlied heißt es darum: "Ach wie flüchtig, ach wie nichtig ist der Menschen Leben!" (Gotteslob 657).
Doch dies ist nur die eine Seite. Denn das Bewußtsein des Todes macht das Leben nicht nur nichtig, sondern auch bedeutsam und spannungsvoll. Weil unser Leben begrenzt ist, ist die Zeit des Lebens kostbar. Deshalb gilt es, die Zeit "auszukaufen" (vgl. Eph 5,16, Kol 4,5). Jede Stunde könnte auch die letzte sein. Kein Augenblick kehrt wieder; jeder muß genutzt werden. So ist der Tod auch in einem positiven Sinn im Leben präsent, angesichts des Todes wird unser Leben drängend, unaufschiebbar, endgültig. Ohne den Tod dagegen wäre das Leben eine große Langeweile; angesichts des Todes wird es zur Herausforderung, zur Entscheidung hier und heute. Gerade das Ernstnehmen des Todes gibt dem Leben also seine Bedeutung. Die christliche Tradition nennt den Tod deshalb das Ende des Pilgerstands des Menschen. Sie will damit sagen: Der Tod ist das definitive Ende der Möglichkeit, sein irdisches Leben zu gestalten und mit Gottes Gnade das Heil zu wirken. Deshalb gilt es zu wirken, solange es Zeit ist.
Leben und Tod durchdringen sich also gegenseitig. Wo deshalb der Tod verdrängt wird, wo er verschwiegen, vertuscht und tabuisiert wird - wie es in unserer modernen Gesellschaft oft geschieht -, da erlöscht auch das wahrhaft menschliche Leben. Wahrhaft menschlich leben kann nur, wer dem Tod ins Auge schaut und ihn annimmt. Aber können wir dies? Welches ist der Sinn des Lebens angesichts des Todes? Welches ist der Sinn des Todes für das Leben?
Die Frage nach dem Sinn des Lebens wie des Todes beschäftigt schon die ersten Seiten der Heiligen Schrift. Die erste Antwort, welche die Heilige Schrift gibt, lautet: Gott will den Tod nicht. Der Tod ist eine Folge der Sünde. In der Sünde will der Mensch selbst nach dem Baum des Lebens greifen und das Leben eigenmächtig an sich reißen. Damit vergreift er sich und übernimmt er sich. Statt des Lebens wählt er den Tod (vgl. Gen 2,17; 3,19). So kann Paulus sagen: "Durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod" (Röm 5,12). Das will selbstverständlich nicht sagen, daß der paradiesische Mensch sein irdisches Leben einfach ins Endlose weitergelebt hätte, wenn er nicht gesündigt hätte. In unserer endlichen Welt ist Leben ohne Tod biologisch gar nicht denkbar. Aber der Bibel geht es nicht um den biologischen bzw. medizinischen Tod, sondern um die konkrete personale Todeserfahrung des Menschen: den Tod als dunklen und sinnwidrigen Abbruch und Einschnitt, den qualvollen und angsterfüllten Tod, gegen den sich der Lebenswille des Menschen wehrt, ja aufbäumt. Diesen Tod hat Gott nicht gewollt; dieser Tod ist Erscheinung der Sünde, Zeichen der Entfremdung von Gott, der Quelle und der Fülle des Lebens. Weil die Heilige Schrift den Tod als Folge der Sünde sieht, gerät sie nicht in die Versuchung, den Tod zu heroisieren oder seine Finsternisse schwärmerisch zu verklären. Sie sieht den ganzen Schrecken des Todes. Er ist der letzte Feind (vgl. 1 Kor 15,26; Offb 20,14).
Maßgebend für das christliche Todesverständnis ist freilich nicht allein das Todesschicksal, das durch den Ungehorsam des ersten Adam auf alle überging. Noch wichtiger für die Heilige Schrift ist der Heilstod Jesu Christi, des neuen Adam, durch den auch und gerade der Tod besiegt wurde. In einem alten Christushymnus heißt es: "Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz" (Phil 2,8).
Durch diesen freien Gehorsam hat Jesus die Macht des Todes besiegt (vgl. 2 Tim 1,10; Hebr 2,14). So ist der Tod in der Nachfolge Jesu nicht mehr einfachhin das Schicksal, das uns wider Willen trifft. In der Nachfolge Jesu kann der Tod vielmehr als Ausdruck des Willens des Vaters verstanden und angenommen werden. Damit hat der Tod seinen Stachel verloren (vgl. 1 Kor 15,55). Deshalb ist, wer glaubt, schon jetzt vom Tod zum Leben hinübergeschritten (vgl. Job 5,24). Am deutlichsten bringt die Präfation von den Verstorbenen diese Verwandlung des Todes zum Ausdruck: "Bedrückt uns auch das Los des sicheren Todes, so tröstet uns doch die Verheißung der künftigen Unsterblichkeit. Denn deinen Gläubigen, o Herr, wird das Leben gewandelt, nicht genommen. Und wenn die Herberge der irdischen Pilgerschaft zerfällt, ist uns im Himmel eine ewige Wohnung bereitet." Wo der Tod so im Glauben angenommen und als Durchgang zum ewigen Leben verstanden wird, da kann man mit Franz von Assisi gar vom "Bruder Tod" sprechen und sich mit ihm versöhnen. Man kann sogar des Glaubens und der Brüder wegen im Martyrium bewußt das Opfer des Lebens auf sich nehmen.
So gehören für christliches Todesverständnis Tod und Leben in einem ganz tiefen Sinn zusammen. Christliche Frömmigkeit hat daraus die Mahnung abgeleitet: "Memento mori!" "Bedenke den Tod!" Das ist keine Aufforderung zur Weltflucht, sondern eine Mahnung, das Leben in der rechten Weise zu ordnen und zu bestehen. Nicht Angst vor dem Tod, sondern Sorge um einen guten Tod spricht aus diesem Wort. Aus diesem Grund enthält die Allerheiligenlitanei die Bitte: "Von einem plötzlichen Tode - befreie uns, o Herr" (Gotteslob 762,6). Dahinter steht die Einsicht, daß der Mensch sich auf den Tod bereiten und ihm bewußt entgegengehen soll. Entsprechend gab es früher einen ausgesprochenen Stil christlichen Sterbens: meist im Kreis der Familie, versehen mit den Sakramenten der Kirche. Im späten Mittelalter gab es eigene Sterbebüchlein mit dem Titel "Kunst zu sterben". Demgegenüber ist der Tod in unserer modernen Lebenswelt weithin stillos geworden. Die meisten Menschen sterben inmitten einer zwar perfekten medizinischen Versorgungswelt, aber auch in der Anonymität eines modernen Krankenhauses - ohne menschliche Nähe und ohne geistliche Bereitung und Begleitung. Dadurch, daß der Tod in der Öffentlichkeit weithin tabuisiert wird, wird der Sterbende noch mehr isoliert. Damit wird freilich zugleich das Leben banalisiert.
Es wäre deshalb höchste Zeit, daß Christen sich wieder um ein menschenwürdiges und ein christenwürdiges Sterben bemühten. Christliche Sterbehilfe besagt vor allem: Niemand sollte vereinsamt sterben! Gerade den Sterbenden schulden wir das tätige und solidarische und nicht zuletzt das betende Zeugnis unserer christlichen Hoffnung (vgl. Gem. Synode, Unsere Hoffnung IV,4).
2.2 Leben nach dem Tod?
Die medizinische Forschung hat in den letzten Jahrzehnten erhebliche Anstrengungen unternommen, um dem Phänomen des Todes näherzukommen. Viel Aufsehen haben Berichte von Menschen erregt, die schon im Koma lagen und dann wiederbelebt werden konnten. Ihre Erfahrungsberichte haben deutlich gemacht, daß das Sterben gewöhnlich nicht qualvoll und angstvoll, sondern freude- und lichterfüllt erfahren wird. Das mag für viele hilfreich sein, um ihnen die Angst vor dem Sterben zu nehmen. Trotzdem trägt dies alles nichts zu der Frage bei, was im Tod selbst oder gar nach dem Tod geschieht. Denn keiner von denen, die wieder ins Leben zurückgeholt wurden, war wirklich tot. Sie alle standen an der Grenze des Todes, aber die Schwelle des Todes selbst haben sie nicht überschritten.
Einen Schritt weiter führen uns die Überlegungen vieler Philosophen. Im Anschluß an Platon hat man oft versucht, die Unsterblichkeit der menschlichen Seele vernünftig zu beweisen. Weil die Geistseele, so sagt man, dem Reich des unzerstörbaren Geistigen (der Ideen) angehört und an ihm teilhat, ist sie kraft ihres Wesens unzerstörbar. Solche Argumente werden heute in anderer Form oft wieder aufgegriffen. Es läßt sich zeigen, daß es im Menschen eine im irdischen Leben letztlich unstillbare Sehnsucht nach Leben und Glück gibt und eine Dynamik, die über den Tod hinausweist. Auch die in diesem Leben nie voll einzulösende Sehnsucht, ja Forderung nach vollkommener Gerechtigkeit legt die Frage eines Lebens nach dem Tod nahe. Vor allem die Liebe, die einen anderen Menschen endgültig annimmt, sagt: Du gehörst für immer zu mir. Gerade die Liebe kann sich mit der Trennung durch den Tod nicht abfinden; sie hofft auf eine bleibende, erfüllte Gemeinschaft. In diesem Hunger und Durst nach dem ganzen, heilen, erfüllten und vollkommenen Leben wurzelt der Begriff des Ewigen. Ewigkeit meint nicht unendlich fortdauerndes und damit nie erfülltes Leben, sondern "gleichzeitiger", ganzer und vollkommener Besitz nie beendbaren Lebens.
Das alles sind Hinweise, welche die Hoffnung auf ein endgültig erfülltes Leben nach dem Tod als sinnvoll erweisen. Eine letzte Gewißheit ergibt sich aus solchen menschlichen Überlegungen freilich nicht. Da es beim Tod um den Sinn des ganzen Lebens geht, ist eine letzte Antwort nur aus dem übergreifenden Sinnzusammenhang des Lebens wie des Sterbens möglich. Das heißt für den Christen: Die Antwort auf die Frage, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, kann nur von Gott, dem Herrn des Lebens und der Fülle des Lebens, her gegeben werden. Die endgültige Antwort ist also nur im Glauben möglich. Fragen wir also, was uns die Zeugnisse des christlichen Glaubens zur Frage des Lebens nach dem Tod zu sagen haben.
Die ursprüngliche Vorstellung des Alten Testaments vom Leben nach dem Tod war die Vorstellung von einem Schatten dasein im Totenreich (scheol). Dort ist der Verstorbene abgeschnitten vom Leben, ausgeschlossen von der Gemeinschaftder Familie, der Freunde, des Volkes, dort lebt er in Verlassenheit, Vereinsamung und Beziehungslosigkeit; ausgeschlossen ist er vor allem aus dem gemeinsamen Gotteslob. Doch mit dieser Auskunft konnte sich der Glaube an den Gott, der ein Gott der Lebenden und nicht der Toten ist, auf die Dauer nicht zufriedengeben. Langsam, aber immer deutlicher brach sich die Überzeugung Bahn: Gott ist treu. Auch wenn im Tod alle Beziehungen abbrechen, die Beziehung zu Gott bleibt bestehen. Verschiedene Psalmen bringen dieses Vertrauen in unübertrefflicher Weise zum Ausdruck:
- "Ich aber bleibe immer bei dir,
- du hältst mich an meiner Rechten.
- Du leitest mich nach deinem Ratschluß
- und nimmst mich am Ende auf in Herrlichkeit.
- Was habe ich im Himmel außer dir?
- Neben dir erfreut mich nichts auf der Erde.
- Auch wenn mein Leib und mein Herz verschmachten,
- Gott ist der Fels meines Herzens
- und mein Anteil auf ewig."
- (Ps 73,23-26; vgl. 49,16)
- "Doch ich, ich weiß: mein Erlöser lebt,
- als letzter erhebt er sich über dem Staub.
- Ohne meine Haut, die so zerfetzte,
- und ohne mein Fleisch werde ich Gott schauen.
- Ihn selber werde ich dann für mich schauen,
- meine Augen werden ihn sehen, nicht mehr fremd.
- Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust."
- (Ijob 19,25-27)
In diesen Texten geht dem Beter auf, daß die Gemeinschaft mit Gott stärker ist als der Zerfall des Leibes und der irdischen Gemeinschaft. Die Gottesgemeinschaft ist die einzige Wirklichkeit, die selbst im Tod hält und trägt. So kommt es schon im Alten Testament, wenigstens bei einzelnen Gläubigen und dies fernab aller mythologischen und weltbildbedingten Vorstellungen, aus der Mitte biblischen Glaubens heraus zur Überzeugung von einem Leben nach dem Tod. Es verdichtet sich die Glaubensüberzeugung, daß Jahwe nicht nur Garant für das Gottesvolk am Ende der Geschichte ist, sondern auch dem einzelnen Anteil gibt an dieser Zukunft, von welcher auch der Tod nichts abschneiden kann. Es wird keinerlei Beschreibung gegeben. Es genügt zu wissen: Das ewige Leben ist Gott selbst und das ewige Angenommen- und Geliebtsein von ihm.
In den Bedrängnissen der Spätzeit des Alten Testaments verdichtet sich diese Hoffnung nochmals. Im Buch der Weisheit setzt der verfolgte Gerechte neue Hoffnung auf Gott und gewinnt im Gedanken an das Leben bei Gott Mut zum Aushalten in den irdischen Verhältnissen. "Die Seelen der Gerechten sind in Gottes Hand, und keine Qual kann sie berühren... In den Augen der Menschen wurden sie gestraft; doch ihre Hoffnung ist voll Unsterblichkeit" (Weish 3,1.4; vgl. 3,15-16; 15,3-4). In einem anderen Zweig des Judentums erwachte und festigte sich der Gedanke an die Auferstehung der Toten (vgl. Dan 12,2, 2 Makk 7,9.14; 12,43).
Das Neue Testament weiß ebenfalls, daß Gott "nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden" ist (Mk 12,27). Deshalb nimmt es die Vorstellungen des Judentums auf und spricht vom Eingehen in den Schoß Abrahams (vgl. Lk 16,22) oder ins Paradies (vgl. Lk 23,43). Das Neue Testament geht jedoch weit über das Alte Testament hinaus. Es bezeugt, daß das Leben Gottes in Jesus Christus endgültig erschienen ist. Jesus selbst ist die Auferstehung und das Leben (vgl. Joh 11,25; 14,6). Wer deshalb Jesu Wort hört und es im Glauben annimmt, der ist 411-412 schon jetzt "aus dem Tod ins Leben hinübergegangen" (Joh 5,24). "Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben" (Joh 11,25-26). Im Johannesevangelium verheißt uns Jesus, daß wir dort sein werden, wo er ist (vgl. Joh 14,3). Auch bei Paulus wird das endgültige Bei-Gott-Sein, auf welches das Alte Testament angesichts des Todes hoffte, zur Hoffnung auf das endgültige Bei-Christus- (vgl. Phil 1,23) und Beim-Herrn-Sein (vgl. 2 Kor 5,8). Paulus spricht einfach von den Verstorbenen "in Christus" (1 Thess 4,16). Sagte das Alte Testament: Himmel, ewiges Leben - das ist Gott selbst und die ewige Gemeinschaft mit ihm, so konkretisiert das Neue Testament: Himmel, ewiges Leben - das ist endgültiges und vollendetes Sein in und mit Christus und durch Christus beim Vater.
So ist für das Alte und für das Neue Testament die Hoffnung angesichts des Todes und über den Tod hinaus kein Zusatz zum Gottesglauben, sondern dessen letzte Konsequenz. Das Alte wie das Neue Testament hoffen angesichts des Abbruchs aller Beziehungen im Tod auf die Treue Gottes, die für das Neue Testament in Jesus Christus endgültig erschienen ist. Zwar ist der Mensch aufgrund seines Wesens ein Schrei nach Unsterblichkeit und ewigem Leben; aber dieser Schrei ist vom Menschen her unerfüllbar, er verlangt mehr, als der Mensch selbst geben kann. Die Antwort kann nur von der Quelle und Fülle des Lebens kommen. So ist das neue Leben, die Unsterblichkeit des Menschen dialogisch bestimmt: Existenz ganz von Gott her und ganz auf ihn hin. Dieses ewige Leben in Jesus Christus beginnt in Glaube, Hoffnung und Liebe schon inmitten dieses Lebens als Kraft des Einsatzes für das Leben. Seine Vollendung aber findet es in der Schau Gottes von Angesicht zu Angesicht (vgl. 1 Kor 13,12).
Die Begegnung mit Gott, die im Tod stattfindet, bedeutet fürden Menschen zugleich das Gericht über sein Leben. "Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden,damit jeder seinen Lohn empfängt für das Gute oder Böse, das er im irdischen Leben getan hat" (2 Kor 5,10; vgl. Röm 14,10). Große Theologen wie Augustinus und Thomas von Aquin haben dargelegt, daß dieses Gericht nicht als ein äußerer Gerichtsvorgang vorgestellt werden darf, sondern als geistiger Vorgang verstanden werden muß. Angesichts der absoluten Wahrheit Gottes, wie sie in Jesus Christus erschienen ist, geht dem Menschen die Wahrheit über sein Leben auf. Dann werden die Masken fallen und die Verstellungen und Selbsttäuschungen ein Ende haben. Es wird dem Menschen endgültig offenkundig, ob er sein Leben gewonnen oder verfehlt hat. Je nachdem wird er eingehen ins Leben bei Gott oder in die Finsternis der Gottesferne.
Die kirchliche Glaubensüberlieferung hat lange gebraucht, bis sie die Wahrheit vom neuen und ewigen Leben in Gott, das sich dem einzelnen Menschen im Tod eröffnet, klar formulieren konnte. Dabei zeigte sich die ganze Sprachnot unseres Redens über ein Leben jenseits der Grenze des Todes. Einen klaren Ausgangspunkt und eine eindeutige Grundlage für die erst allmählich sich einstellende begriffliche Klarheit gab es freilich von Anfang an: die Gebetspraxis der Kirche. Die Kirche hat ihre Überzeugung vom Leben der Toten schon sehr früh vor allem dadurch zum Ausdruck gebracht, daß sie für die Toten betete und ihrer bei der Feier der Liturgie gedachte. Diese Praxis wird uns etwa bereits in den frühchristlichen Katakomben bezeugt. Sie ist in der Eucharistiefeier für die Verstorbenen und in den Beerdigungsgebeten und -riten bis heute ein fester Bestandteil des kirchlichen Lebens. Diese Praxis würde jeden Sinn verlieren ohne die Überzeugung vom Leben nach dem Tod.
Auf der Grundlage dieser praktischen Glaubensüberlieferung setzte sich in der Kirche immer mehr die Überzeugung durch: Der Tod bedeutet die Trennung von Seele und Leib. Während der Leib im Tod verfällt, wird bei Menschen, die im Stand der Gnade sterben, die Seele in die ewige Gemeinschaft mit Gott aufgenommen. Man kann diese Lehre freilich nur dann richtig verstehen, wenn man Ernst damit macht, daß die Seele nicht ein Teil des Menschen neben dem Leib ist, sondern das Lebensprinzip des einen und ganzen Menschen, modern formuliert: sein Ich, sein Selbst, die Mitte seiner Person. In diesem Sinn hat Papst Benedikt XII. in einem Lehrentscheid von 1336 feierlich erklärt, daß die Seelen der Heiligen sofort nach dem Tod, die Seelen derer, die noch der Reinigung bedürfen, nach deren Reinigung in den Himmel eingehen und Gott von Angesicht zu Angesicht schauen (vgl. DS 1000; NR 901-902; DS 857; 1305; NR 926; LG 49). Diese Lehre wurde von der römischen Kongregation für die Glaubenslehre 1979 in einem eigenen Schreiben verteidigt und zugleich näher erläutert: "Die Kirche hält an der Fortdauer und Subsistenz eines geistigen Elementes nach dem Tode fest, das mit Bewußtsein und Willen ausgestattet ist, so daß das Ich des Menschen` weiterbesteht, wobei es freilich in der Zwischenzeit seiner vollen Körperlichkeit entbehrt. Um dieses Element zu bezeichnen, verwendet die Kirche den Ausdruck ,Seele', der durch den Gebrauch in der Heiligen Schrift und in der Tradition sich fest eingebürgert hat."
Die Einwände gegen diese Lehre sind zahlreich. Denn nicht erst für unser heutiges Menschenbild, sondern schon für das der Heiligen Schrift sind Seele und Leib nicht zwei Teile des Menschen, vielmehr ist der Mensch in Leib und Seele einer. Der Tod betrifft deshalb nicht nur den Leib, sondern den ganzen Menschen; umgekehrt wäre das ewige Leben nicht menschlich, würde es nicht wiederum dem ganzen Menschen gelten. Daraus wurde in der evangelischen Christenheit oft die Lehre vom Ganztod des Menschen abgeleitet. Sie besagt, daß im Tod der ganze Mensch stirbt und daß er erst am Ende der Zeit von Gott wieder neu geschaffen wird. Die Frage ist, wie dann die Identität des Menschen in diesem und im künftigen Leben gewahrt werden kann. Oft spricht man auch vom Seelenschlafbis zur Auferstehung der Toten. Wenn damit eine Empfindungslosigkeit der Seele gemeint ist, widerspricht auch diese Lehre dem Zeugnis der Heiligen Schrift wie der kirchlichen Überlieferung, die ihre Überzeugung vom Leben der Toten schon sehr früh vor allem durch ihre Gebetspraxis zum Ausdruck gebracht hat.
Vollends widerspricht der Heiligen Schrift und der Glaubensüberlieferung der Kirche die Annahme einer Wiederverleiblichung bzw. Reinkarnation der Seele nach dem Tod für ein neues Leben in dieser Welt. Diese Lehre findet sich in vielen nichtchristlichen Religionen; in der Neuzeit ist diese Idee in gewandelter Form auch in unseren Kulturkreis eingedrungen. Im Hintergrund stehen verschiedene Motive, u. a. der Gedanke der Reinigung von den Fehlern des bisherigen Lebens, des gerechten Ausgleichs für unverschuldetes Leiden und Entsagungen in diesem Leben, aber auch der Möglichkeit, das zu verwirklichen, was in der kurzen Spanne eines einzigen Lebens nicht erfüllt werden konnte. Doch nach christlichem Glauben könnten auch noch so viele irdische Leben nicht genügen für Reinigung und Erfüllung des Menschen; denn Gott allein und das Leben bei ihm ist Heiligung, Gerechtigkeit und Erfüllung des Menschen. Außerdem kann man nach christlicher Auffassung Leib und Seelenicht in der extremen Weise trennen, daß die Seele verschiedene Leiber annehmen könnte, ohne dadurch ihre eigene Identität zu verlieren. Schließlichwird dieses Leben nur dann voll ernstgenommen, wenn es als einmalige Möglichkeit zur Entscheidung für oder gegen Gott verstanden wird und im Todsein endgültiges Ende findet. Dieses Ein-für-allemal unseres irdischen Lebens entspricht dem Ein-für-allemal der Heilstat Gottes durch Jesus Christus, an der wir im Tod unverlierbar-endgültig Anteil erhalten (vgl. Hebr 9,27-28).
Mit aller gebotenen Vorsicht und Zurückhaltung können wir versuchen, die Wirklichkeit des Lebens der Verstorbenen bei Gott noch etwas tiefer zu verstehen, wenn wir noch etwas genauer über das Verhältnis von Leib und Seele nachdenken. Da die Seele kein Teil des Menschen neben dem Leib ist, sondern die Mitte der Person, geht die Person des Menschen ein in das Leben bei Gott. Aber auch der Leib ist kein bloßer Teil des Menschen, sondern die Person in ihrem konkreten Bezug zu ihrer Umwelt und Mitwelt, ein Bezug, der so innig zu denken ist, daß ein "Stück" Welt, eben unser Leib, zu unserer personalen Wirklichkeit gehört. Auf diesem Hintergrund wird deutlich, was Trennung von Seele und Leib meint, nämlich das Aufhören, der Abbruch des bisherigen Bezugs zur Umwelt und Mitwelt. Diese Beziehungslosigkeit kommt auch in der alttestamentlichen Vorstellung von der scheol zum Ausdruck. Insofern ist die traditionelle Vorstellung von der Trennung von Leib und Seele der Sache nach durchaus biblisch begründet. Eine absolute und totale Trennung von Leib und Seele und damit eine völlige Beziehungslosigkeit kann es freilich für den Glauben nicht geben. Ein gewisser, wenngleich unvollständiger und für unsere Erfahrung dunkel bleibender Leib- und Weltbezug muß festgehalten werden. Der Glaube bekennt ja, daß die Toten, die bei Gott leben, in Jesus Christus und im Heiligen Geist in der einen Gemeinschaft der Heiligen mit uns verbunden bleiben. Im Gebet für die Verstorbenen kommt diese bleibende Verbundenheit in besonderer Weise zum Ausdruck.
An dieser Stelle wird freilich auch deutlich, daß die Hoffnung des Christen über die persönliche Gemeinschaft des einzelnen mit Gott hinausgeht auf eine neue gemeinsame Zukunft aller, auf eine verwandelte Leiblichkeit in einer verwandelten Welt, auf die Auferstehung der Toten. Die kirchliche Überlieferung unterscheidet daher zwischen der Vollendung des einzelnen Menschen im Tod und der Vollendung der Menschheit und aller Wirklichkeit bei der Auferstehung der Toten am Ende der Zeit.
2.3 Die Auferstehung der Toten
Gott will, ruft und liebt den ganzen Menschen, der in Leib und Seele einer ist. Zum ganzen Menschen gehört auch sein Bezug zur Welt und zu den Mitmenschen, der sich im Leib vollzieht. Die Hoffnung auf die leibhafte Auferweckung der Toten ist daher kein später und fremder Zusatz zum Gottesglauben, sondern dessen innere Konsequenz.
In den biblischen Zeugnissen wird die Tatsache der künftigen Auferstehung mit festem Glauben bekannt, aber die Art und Weise, wie sie geschieht, nicht beschrieben. Die Gewißheit dieses Glaubens erwächst aus dem Gottesgedanken in bedrückenden menschlichen Erfahrungen, besonders in der Zeit der makkabäischen Märtyrer. "Der König der Welt wird uns zu einem neuen, ewigen Leben auferwecken" (2 Makk 7,9); "unsere Brüder sind nach kurzem Leiden mit der göttlichen Zusicherung ewigen Lebens gestorben" (2 Makk 7,36; vgl. Dan 12,2-3). Erst in der sogenannten apokryphen Literatur (die nicht zur Bibel gehört) finden sich dann phantasievoll ausgemalte Schilderungen, wie sich die Auferstehung der Toten sowie die Belohnung der Guten und die Bestrafung der Bösen vollziehen werden. Diese aus damaligen Vorstellungen entwickelten, oft krausen Bilder sind für uns heute nicht mehr nachvollziehbar, aber mit dem Auferstehungsglauben auch nicht notwendig verbunden, ja durch die Antwort Jesu an die Sadduzäer ausgeschlossen (vgl. Mk 12,24-27). Als diese Leugner der Totenauferstehung Jesus den Fall vorlegten, daß eine Frau nacheinander sieben Ehemänner hatte, und ihn fragten, wem sie bei der Auferstehung angehören werde, antwortete er ihnen: "Ihr irrt euch, ihr kennt weder die Schrift noch die Macht Gottes" (Mk 12,24). Bei der Auferstehung der Toten gibt es kein Heiraten und Verheiratetwerden mehr; aus der vollendenden Schöpfermacht Gottes wird es eine andere Welt sein. Letztlich beruht der Glaube an die Auferstehung der Toten auf dem Glauben, daß Gott "nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden" ist (Mk 12,27).
Für die Urkirche wird dann die Auferstehung Jesu zum sicheren Fundament ihres Glaubens an die Auferstehung der Toten (vgl. Apg 4,1-2; 17,18.32 u. a.). Paulus sagt: "Wenn der Geistdessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus Jesus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leib lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt" (Röm 8,11, vgl. 1 Kor 15,12-22).
Im Johannesevangelium wird eine innere Verbindung zwischen der Eucharistie und der künftigen Auferstehung sichtbar, hier sagt Jesus: "Wer mein Fleisch ißt und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am Letzten Tag" (6,54). An anderer Stelle heißt es: "Die Stunde kommt, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und herauskommen werden" (5,28-29). Darum ist Jesus selbst "die Auferstehung und das Leben"; wer an ihn glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist (vgl. 11,25).
Wenn freilich davon die Rede ist, daß alle, die in den Gräbern sind, "herauskommen" werden, die das Gute getan haben, um zum Leben aufzuerstehen, die das Böse getan haben, zum Gericht (vgl. Joh 5,29), erheben sich für den heutigen naturwissenschaftlich denkenden Menschen Verständnisschwierigkeiten. Aber wie sollte die Bibel das Geheimnis der künftigen Welt und der mit ihr verbundenen Totenauferstehung anders als in der Sprache und Vorstellung ihrer Zeit ausdrücken? Es ist auch nicht so, daß erst wir heute Schwierigkeiten mit der Botschaft von der leiblichen Auferstehung haben. Die Schwierigkeiten in der damaligen außerjüdischen, vor allem hellenistischen Welt waren noch wesentlich größer. Auf die leibliche Auferstehung zu hoffen galt geradezu als töricht und skandalös. Als Paulus darüber vor den Weisen des Areopag in Athen sprach, "spotteten die einen, andere aber sagten: Darüber wollen wir dich ein andermal hören" (Apg 17,32). Die Frage ist damals wie heute: Wie sollen wir uns das denken? Wie soll das geschehen? Schon Paulus weiß um diese Frage: "Nun könnte einer fragen: Wie werden die Toten auferweckt, was für einen Leib werden sie haben?" (1 Kor 15,35). Es ist offenkundig, daß diese Fragen innerhalb unseres modernen, von den Naturwissenschaften geprägten Weltbilds nochmals eine ganz neue Dringlichkeit erhalten.
Die Theologen haben auf die Beantwortung dieser Fragen viel Scharfsinn verwendet und dabei teilweise auch manche uns heute fremd erscheinenden Theorien entwickelt. Zwei Extreme waren zu vermeiden: auf der einen Seite ein primitiver Materialismus, der meint, wir würden bei der Auferstehung der Toten wieder dieselbe Materie, dasselbe Fleisch und dieselben Knochen annehmen wie in diesem Leben. Nun wissen wir aber, daß wir schon in diesem Leben unsere Materie im Lauf von etwa sieben Jahren immer wieder austauschen. Die Identität der Person zwischen diesem und dem künftigen Leben kann also nicht an der Identität der Materie hängen. Paulus sagt uns auch, daß Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, weil das Vergängliche nicht das Unvergängliche erbt. Wir werden zwar dieselben sein, und doch werden wir alle verwandelt werden (vgl. 1 Kor 15,50-51). "Denn dieses Vergängliche muß sich mit Unvergänglichkeit bekleiden und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit" (1 Kor 15,53). Auf der anderen Seite darf man diese Verwandlung nicht im Sinn eines weltlosen Spiritualismus rein geistig verstehen. Es geht um eine neue, durch den Geist Gottes verwandelte und verklärte Leiblichkeit und um eine wesenhafte (nicht stoffliche) Identität auch des Leibes. In diesem Sinn lehrt das IV. Laterankonzil (1215), daß "alle mit dem eigenen Leib, den sie hier tragen, auferstehen" (DS 801; NR 896). Man kann diese Mitte zwischen Materialismus und Spiritualismus als geistlichen Realismus bezeichnen. Er besagt, daß am Ende alles vom Geist Gottes verwandelt und verklärt werden wird. Wir können uns davon keine konkrete Vorstellung machen. Wir wissen nur: Wir, unsere Welt und unsere Geschichte werden dieselben sein und werden doch ganz anders dieselben sein:
- "Was gesät wird, ist verweslich,
- was auferweckt wird, unverweslich.
- Was gesät wird, ist armselig,
- was auferweckt wird, herrlich.
- Was gesät wird, ist schwach,
- was auferweckt wird, ist stark.
- Gesät wird ein irdischer Leib,
- auferweckt ein überirdischer Leib."
- (1 Kor 15,42-44)
Versteht man unter dem Leib im Sinn der Heiligen Schrift den für die menschliche Person wesentlichen und ihr eigenen Bezug zur Mitwelt und Umwelt, dann meint die leibliche Auferstehung, daß der Bezug zu den andern und zur Welt in einer neuen und vollen Weise wiederhergestellt wird. Es geht bei der Auferstehung der Toten also nicht bloß um die Vollendung des einzelnen, sondern um die Vollendung aller Wirklichkeit. Alle Welt und Geschichte wird am Ende der Zeit vom Geist Gottes erfüllt sein. Jesus Christus wird dann seine Herrschaft dem Vater übergeben, und Gott wird alles und in allem sein (vgl. 1 Kor 15,28). Dann wird auch das Sehnen der gesamten Schöpfung, die "bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt" (Röm 8,22), erfüllt sein. Eine neue brüderlichschwesterliche Gemeinschaft und Solidarität wird in diesem Reich der Freiheit entstehen (vgl. Röm 8,21; GS 32). Dabei wird alles, was Menschen in der Geschichte getan haben, eingebracht werden in der großen Ernte der Zeit. Alles, was aus Liebe getan wurde, wird bleibend eingestiftet sein in den Bestand der Wirklichkeit. "Die Liebe wird bleiben wie das, was sie einst getan hat" (GS 39). So wird offenbar werden, was jetzt nur verborgen und im Glauben erfaßbar ist, daß Gott der Herr aller Wirklichkeit ist; seine Herrlichkeit wird dann alles erfüllen.
Das ist kein billiger Trost, sondern zugleich Ermahnung zum Einsatzfür das Leben und zum Kampf gegen die Mächte des Todes, gegen leibliche wie seelische Verkümmerung und Verkrüppelung, gegen Beziehungslosigkeit zwischen den Menschen wie gegen alles, was Leben verletzt, schändet und zerstört. Die Verheißung des künftigen Lebens bedeutet auch Verpflichtung im gegenwärtigen und für das gegenwärtige Leben, dem diese Verheißung gilt. Die Hoffnung auf die Auferstehung des Leibes bedeutet, daß der Christ auch eine Verantwortung für die materielle Schöpfung hat; auch sie ist zur Verklärung bestimmt. Doch bei dieser Aussage halten wir unwillkürlich inne. Wird wirklich alles eingehen in das ewige Reich Gottes, auch das Böse? Wie stünde es dann mit der Hoffnung auf endgültige Gerechtigkeit?
2.4 Das Kommen des Herrn und das Weltgericht
Die Welt und die Geschichte, wie wir sie konkret erfahren, sind zwiespältig und doppeldeutig. Gutes und Böses, Lüge und Wahrheit sind meist miteinander vermischt. Das Evangelium beschreibt diese Situation mit dem Gleichnis vom Unkraut und dem Weizen (vgl. Mt 13,24-30). Der hl. Augustinus sieht die gesamte Geschichte vom Anfang der Schöpfung bis zum Ende der Zeit als Auseinandersetzung zwischen dem Reich Gottes und dem Reich der Welt bzw. des Teufels; beide Reiche sind verschieden, aber sie überschneiden einander und sind miteinander vermischt. Das Evangelium ist weit davon entfernt, die Geschichte als Fortschrittsgeschichte, in der sich das Gute, die Wahrheit und der Glaube immer mehr durchsetzen, zu verstehen. Ein solcher naiver Fortschrittsoptimismus widerspräche auch aller geschichtlichen Erfahrung. Das Neue Testament erwartet für die Endzeit sogar einen zunehmenden Angriff der Gewalten des Bösen auf die Kirche (vgl. Mk 13,3-23 par.; 2 Thess 2,1-3; Offb 12,13-18 u. a.).
Die Zweideutigkeit der Geschichte und die Macht des Bösen in der Welt werden jedoch - das ist die Überzeugung des Alten wie des Neuen Testaments - nicht das letzte Wort sein. Schon das Alte Testament erwartet den Tag des Herrn. Gemeint ist nicht irgendein Kalendertag, sondern der von Gott erfüllte Tag, der Tag und die Zeit, da Gottes Heiligkeit und Herrlichkeit offenbar werden. Entgegen harmloser optimistischer Sorglosigkeit erwarten die Propheten diese Offenbarung als Gericht.
Der Prophet Amos sagt dies mit letzter Deutlichkeit: "Weh denen, die den Tag des Herrn herbeisehnen. Was nützt euch denn der Tag des Herrn? Finsternis ist er, nicht Licht" (Am 5,18). Doch das Gericht bedeutet schon nach dem Alten Testament zugleich Läuterung (vorab bei Hosea) und schließlich Rettung und die Wiederherstellung des Volkes.
Im Neuen Testament wird der "Tag des Herrn" zum Tag Jesu Christi, weil Gott Christus das Gericht übertragen und die Vollendung des Heilsgeschehens anvertraut hat. Dieser Tag heißt darum "der Tag Christi Jesu" (vgl. Phil 1,6.10, 2,16), "der Tag des Herrn" (1 Thess 5,2; vgl. 1 Kor 1,8 u. a.), auch der Tag "des Menschensohnes" (vgl. Lk 17,24). Auf das endzeitliche Kommen Jesu Christi richtet sich die Erwartung seiner gläubigen Gemeinde. Diese Ankunft und Erscheinung Jesu, im Neuen Testament mit "Parusie" bezeichnet, wird mit "Wiederkunft" nicht glücklich übersetzt, weil damit nahegelegt wird, es handle sich um ein Ereignis, das schon einmal stattgefunden hat. In Wirklichkeit geht es um die Vollendung dessen, was bei der Menschwerdung, in Kreuz und Auferstehung Jesu Christi begonnen hat, um die Vollendung des Werkes Jesu Christi und um das endgültige Offenbarwerden seiner Herrlichkeit. Gemeint ist also: Am Ende wird offenbar werden, daß Jesus Christus von Anfang an der Grund und die Sinnmitte aller Wirklichkeit und Geschichte war und ist, das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende (vgl. Offb 1,8; 22,13).
Weil Jesus Christus der ursprüngliche und der endgültige Maßstab ist, wird am Ende alles von ihm und an ihm gemessen werden. Deshalb verkündet ihn das Neue Testament als den von Gott eingesetzten Richter der Lebenden und der Toten (vgl. Apg 10,42 u. a.). Diese Botschaft vom Gericht der einzelnen wie der Völker wird im Neuen Testament in großartigen Bildern verkündet (vgl. Mt 25,31-46; Joh 5,28-29; Offb 20,11-15). Wir müssen uns freilich bewußt sein, daß es sich dabei um Bilder und nicht um Beschreibungen handelt. Sie wollen uns sagen, daß am Ende jeder von Jesus Christus her seinen endgültigen Platz und seine endgültige Bedeutung erhalten wird. Alle anderen Mächte und Gewalten werden dann gerichtet, abgetan und gestürzt werden. Weil Jesus Christus der endgültige Maßstab sein wird, wird dieses Gericht aber für die, die auf ihn vertrauen, ein Gericht der Gnade sein.
Wenn in der Heiligen Schrift außerdem gesagt wird, daß nicht nur Gott durch Jesus Christus Gericht halten wird, sondern auch die Zwölf (vgl. Mt 19,28), die Engel (vgl. Offb 3,21) und die Heiligen (vgl. 1 Kor 6,2), dann heißt das, daß diejenigen, die in Christus sind und aus ihm leben, endgültig als Maßstab bestätigt und ins Recht gesetzt werden.
Das Gericht am Jüngsten Tag meint also, daß am Ende die endgültige Wahrheit über Gott und den Menschen, die Wahrheit, die Jesus Christus in Person ist, offenkundig werden wird. Dann wird auch die Gerechtigkeit endgültig siegen. Denn dann wird jedem Recht widerfahren (vgl. Jes 9,11), auch den Kleinen und Unterdrückten, den Gedemütigten und Vergessenen, den anonymen Opfern von Naturkatastrophen wie von menschlicher Rücksichtslosigkeit und Gewalt. Insofern ist auch die Botschaft vom Gericht frohe Botschaft und ein wesentlicher Ausdruck der christlichen Hoffnung. Das künftige Gericht wirkt schon in die Gegenwart hinein: denn "wer nicht glaubt, ist schon gerichtet" (Joh 3,18). Schon jetzt vollzieht sich eine Scheidung zwischen den Menschen aufgrund ihrer guten oder bösen Taten (vgl. Joh 3,18-21), eine Scheidung, die einst offenbar werden wird. Das künftige Gericht mahnt schon jetzt zur Entscheidung und zum Einsatz hier und heute.
Für die an Jesus Christus Glaubenden ist der Ausblick auf das Kommen des Herrn Hoffnung auf volle Erlösung, auf Befreiung von allen Ängsten und Zwängen der Gegenwart. Das Erscheinen des Herrn bedeutet auch das Ende von Tod und Vergänglichkeit. Die gläubige Gemeinde wird nach den Bedrängnissen der Endzeit aufatmen: "Dann ... erhebt eure Häupter; denn eure Erlösung ist nahe" (Lk 21,28). Paulus ist überzeugt: Gott "wird euch auch festigen bis ans Ende, so daß ihr schuldlos dasteht am Tag Jesu, unseres Herrn" (1 Kor 1,8). Alle, die zur Kirche, der Heilsgemeinde, gehören, werden aus aller Welt gesammelt werden (vgl. Mk 13,27). Die Kirche selbst wird nach Ausscheidung ihrer unwürdigen Glieder (vgl. Mt 13,41-42) ihre Vollendungsgestalt erlangen und als die "geschmückte Braut" (vgl. Offb 21,2) Hochzeit feiern und in die Gottesstadt, das endzeitliche Reich Gottes, einziehen (vgl. Offb 21,9-10). Darauf richtet sich die Sehnsucht der bedrängten, von Verfolgung bedrohten Gemeinden: "Der Geist und die Braut aber sagen: Komm! Wer hört, der rufe: Komm!" (Offb 22,17).
So wird die reiche Bildersprache der Bibel aufgeboten, um das menschlich nicht vorstellbare Geschehen der Zukunft den Gläubigen in der Gegenwart nahezubringen. Es läßt sich nicht übersehen, daß in manche Schilderungen der Parusie zeitbedingte Anschauungen und Ausdrucksweisen eingeflossen sind, die uns heute befremden. In der großen Endzeitrede (vgl. Mk 13 par.) wird das Kommen des Menschensohnes nach der Prophetie von Dan 7,13 so beschrieben: "Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken kommen sehen" (Mk 13,26). Aber nicht das alte Weltbild, das dahintersteht, sondern das weltweit erfahrbare von Gott gewirkte endzeitliche Geschehen ist der Kern der Aussage. In andere Schilderungen sind "apokalyptische", aus einer damaligen Literaturgattung übernommene Beschreibungen eingedrungen, so namentlich in 1 Thess 4,16-17 (vgl. auch 1 Kor 15,52). Wenn dort vom Ruf des Engels und der Posaune Gottes, ja von einer Entrückung der irdischen Gemeinde in die Luft die Rede ist, so sind das zeitbedingte Ausdrucksweisen, die in der auch heute gültigen Aussage gipfeln: "Dann werden wir immer beim Herrn sein" (1 Thess 4,17). Aus der Vielfalt der Bilder und aus den voneinander abweichenden Beschreibungen hebt sich die bleibende Glaubenswahrheit heraus: Christus wird mit göttlicher Macht kommen, um die Welt zu richten und die Seinen für immer zu sich zu nehmen.
Im Neuen Testament finden sich vielfältige Spuren sogenannter Naherwartung. Sie besagt, daß Jesus selbst die Ankunft des vollendeten Gottesreiches in die Nähe rückte (vgl. Mk 1,15; 9,1; Mt 10,23). In seiner Person, in seinem Tod und in seiner Auferstehung ist das Reich Gottes in der Tat angebrochen. Die Urgemeinde wie auch Paulus haben das Kommen des Herrn als nahe bevorstehend erwartet (vgl. 1 Thess 4,15-17; 1 Kor 7,29; 15,51-52; Phil 4,5 u. a.). Die Urgemeinde hoffte sogar sehnlichst auf sein baldiges Kommen und betete darum (vgl. 1 Kor 16,22; Offb 22,20; Did 10,6). Auf der anderen Seite zeigt das Neue Testament aber auch bereits die Erfahrung, daß die Ankunft des Herrn sich verzögert (vgl. Mt 24,48; 25,5). Ja, es treten bereits Spötter auf, die höhnisch fragen: "Wo bleibt denn seine verheißene Ankunft?" (2 Petr 3,4). Trotz dieser Spannung findet sich im Neuen Testament keinerlei Hinweis darauf, daß es darüber zu einer Krise gekommen wäre. Das zeigt, daß urchristliche Hoffnung im Entscheidenden keine Terminfrage war. Die Botschaft Jesu und der Urgemeinde wollte die Menschen in prophetischer Weise aktuell ansprechen und unmittelbar in die Entscheidung stellen. Dabei verkündete die Urkirche den wiederkommenden Herrn stets und je nach den Umständen immer wieder neu als kommend, anfordernd, richtend und aufrichtend. In dieser Gewißheit der Hoffnung konnte sie die Akzente unterschiedlich setzen. Immer aber ging es um dieselbe unaufhebbare Spannung, die mit der Entscheidung im Hier und Heute angesichts der herandrängenden, aber unverfügbaren Zukunft, die weder berechnet noch herbeigezwungen werden kann, von der Sache her notwendig besteht. Diese Spannung muß auch die spätere Verkündigung immer wieder neu aushalten.
Diese Erkenntnis ist auch wichtig für das richtige Verständnis der schon im Neuen Testament genannten Vorzeichen der Ankunft Jesu Christi: schwere Bedrängnisse wie Kriege, Hungersnöte, Erdbeben und Verfolgungen, Verkündigung des Evangeliums auf der ganzen Welt, Glaubensabfall, Auftreten des Antichrist (vgl. Mk 13 par.; 2 Thess 2,1-3). Das sind Vorstellungen der damaligen Zeit, die den Zweck haben, die Gläubigen zur Wachsamkeit zu mahnen und zum Aushalten zu ermutigen. Daß man daraus keinesfalls den Termin der Ankunft des Herrn berechnen kann, geht auch daraus hervor, daß das Neue Testament im gleichen Zusammenhang klar sagt: "Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand..., sondern nur der Vater" (Mk 13,32; vgl. Apg 1,7). Er kommt wie ein Dieb in der Nacht, plötzlich, wenn niemand damit rechnet (vgl. 1 Thess 5,2-3, 2 Petr 3,10). Ein Blick in die Geschichte zeigt ja deutlich genug, daß diese Zeichen in veränderter Gestalt stets zur Gestalt dieser zu Ende gehenden Welt gehören. Drangsale, Kriege und Naturkatastrophen hat es zu allen Zeiten gegeben; zu allen Zeiten der Kirchengeschichte haben Missionare versucht, bis an die Grenzen der jeweils bekannten Welt vorzudringen und sind dabei auf antichristlichen Widerstand gestoßen. Die in der Schrift genannten Vorzeichen des Endes haben also die Funktion, uns zu beständiger Wachsamkeit zu mahnen (vgl. Mk 13,33-37). Deshalb sagt das II. Vatikanische Konzil zutreffend: "Den Zeitpunkt der Vollendung der Erde und der Menschheit kennen wir nicht, und auch die Weise wissen wir nicht, wie das Universum umgestaltet werden soll" (GS 39).
Von besonderer Bedeutung für die endzeitliche Deutung der Geschichte war schon oft die Gestalt des Antichrist. Was ist damit gemeint? Nach dem Neuen Testament tritt der Antichrist am heiligen Ort auf. Er erhebt sich "über alles, was Gott oder Heiligtum heißt"; so sehr, "daß er sich sogar in den Tempel Gottes setzt und sich als Gott ausgibt" (2 Thess 2,4; vgl. 9-10). Vor allem im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung des Johannes, wird das großmaulige, anmaßende und gewalttätige gotteslästerliche Wesen des Tiers aus der Tiefe eindrucksvoll beschrieben (vgl. Offb 13). Diese Aussagen haben in der Geschichte immer wieder eine oft verhängnisvolle Rolle gespielt. Es gehört jedoch mit zur Zwiespältigkeit der Geschichte, daß es uns verwehrt ist, schon jetzt die Scheidung zwischen Christlichem und Antichristlichem mit letzter Eindeutigkeit vorzunehmen und das Wesen des Antichristlichen zu personalisieren und damit andere zu dämonisieren. Die Versuchung des Antichristlichen tritt immer wieder neu auf. Sein Wesen ist der Hochmut und der Stolz, der Macht- und Durchsetzungswille, der sich in Gewalttätigkeit und brutaler Unterdrückung zeigt, der Egoismus, der Neid und der Haß, aber auch die Lüge und die Verdrehung der Wahrheit. Im 1. Johannesbrief werden auch gefährliche Irrlehrer als "Antichriste" bezeichnet, das heißt als Verkörperung antichristlichen Geistes (1 Joh 2,18.22; vgl. 2 Joh 7). In diesen Irrlehren ist der Antichrist "schon jetzt in der Welt" (vgl. 1 Joh 4,3).
Oft wird auch die im Alten Testament verheißene Sammlung Israels als Vorzeichen des Endes bezeichnet. Sie wird im Alten Testament jedoch nie rein politisch, sondern in erster Linie als endzeitliche Sammlung im Glaubensgehorsam verstanden. Deshalb ist es wichtig, daß Paulus von der endzeitlichen Bekehrung Israels spricht (vgl. Röm 11,25-32). Er spricht dabei aber nicht von einem endzeitlichen Vorzeichen, sondern von dem endzeitlichen Ereignis selbst. Dieses läßt sich nicht innergeschichtlich datieren und politisch ins Werk setzen. Die in unserem Jahrhundert geschehene Sammlung Israels zu einem eigenen Staat wird deshalb in christlicher Sicht als ein, wenngleich religiös motiviertes, politisches und nicht als ein endzeitliches Phänomen beurteilt werden müssen. Die Juden und Christen gemeinsame endzeitliche Hoffnung ist, daß bei der Sammlung der Völker zu einem universalen Frieden (schalom) alle, auch Israel, den einen gemeinsamen Messias anerkennen werden, der nach christlicher Überzeugung in Jesus Christus schon erschienen ist.
Nimmt man alles Gesagte zusammen, dann läßt sich aus den biblischen Aussagen über Wiederkunft und Gericht keine direkte endzeitliche Deutung einzelner geschichtlicher Phänomene ableiten.
Die neutestamentlichen Aussagen über die Ankunft Jesu Christi am Ende der Zeit zum Gericht wie zum Heil der Welt haben auch eine praktische Bedeutung. Sie wollen uns mahnen zur Umkehr und zur Nachfolge hier und heute; sie wollen uns zur Wachsamkeit anhalten und uns nicht zuletzt Trost und Hoffnung spenden. Sie sagen uns: Das Ganze der Geschichte kommt einmal ans Ende. Dieses Ende wird nicht Leere, sondern Fülle und Vollendung sein. Denn am Ende werden die Wahrheit, das Recht, die Freiheit und das Leben siegen über die Lüge, die Gewalt, die Zerstörung und den Haß. So verstanden ist die christliche Hoffnung keine Vertröstung auf das Jenseits, die sich vor der Verantwortung im Diesseits drückt, sondern Ermutigung auch zum Einsatz für das Recht, die Wahrheit und die Liebe schon in dieser Welt. Dennoch ist diese Vollendung der Geschichte nicht "von unten" möglich. Kein einzelner, keine Gruppe, keine Klasse und keine Rasse kann sich zum Hauptagenten der Weltgeschichte aufspielen und schon jetzt das Weltgericht vorwegnehmen. Jeder innerweltliche Messianismus ist christlich ausgeschlossen. Herr der Geschichte ist allein Gott durch Jesus Christus im Heiligen Geist. Er wird das letzte Wort haben, und dies wird ein Wort der Gerechtigkeit wie des Erbarmens sein für alle wie für jeden einzelnen.
Entsprechend war das Kommen Christi für die Urkirche ein Gegenstand freudiger Erwartung, dem sie voll Sehnsucht entgegenharrte. Bei ihren gottesdienstlichen Feiern rief sie: "Komm, Herr Jesus, komm bald!" (vgl. 1 Kor 16,22; Offb22,20; Did 10,6). In späteren Jahrhunderten wurde der Jüngste Tag mehr im Zeichen der Furcht und des Schreckens gesehen, als Tag des Zornes, der Tränen und des Wehklagens. Die Spannung zwischen Hoffnung und Zuversicht auf ewiges Leben einerseits und heilsamer Furcht und heilsamem Erschrecken vor der realen Möglichkeit ewiger Verdammung andererseits ist offensichtlich unaufhebbar. So müssen wir bei aller gebotenen Zurückhaltung und Vorsicht nochmals fragen: Ewiges Leben - was ist das? Leben der künftigen Welt - was ist damit gemeint?
3. Das ewige Leben
3.1 Der Himmel
In der Heiligen Schrift und in der kirchlichen Glaubensüberlieferung wird das ewige Leben in der Gemeinschaft mit Gott unter vielen Bildern beschrieben: als himmlisches Hochzeitsmahl, als Leben, Licht, Frieden. Wenn dabei vom Himmel die Rede ist, dann schwingt dabei zwar das antike Weltbild mit, nach welchem der Himmel über der Erde und über dem Firmament ist. Doch das räumliche "Oben" ist in erster Linie als ein Bild für die Erfüllung des Menschen und für den Zustand vollendeter Glückseligkeit gemeint. Noch in unserer heutigen säkularisierten Sprache gebrauchen wir dieses Bild, wenn wir etwa sagen, man fühle sich wie im siebten Himmel, man genieße eine himmlische Ruhe u. a. Dieser Zustand endgültiger und vollendeter Glückseligkeit kann nach christlichem Glauben für den Menschen nur Gott sein und die Gemeinschaft mit ihm. Denn Gott allein genügt (Teresa von Avila). Der Himmel ist also die ewige Gemeinschaft des Menschen mit Gott.
Das Buch der Offenbarung des Johannes beschreibt die Seligkeit des Himmels im Anschluß an Aussagen aus dem Alten Testament in unübertrefflichen Bildern:
- "Deshalb stehen sie (die Heiligen) vor dem Thron Gottes und dienen ihm bei Tag und Nacht in seinem Tempel; und der, der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt über ihnen aufschlagen. Sie werden keinen Hunger und keinen Durst mehr leiden, und weder Sonnenglut noch irgendeine sengende Hitze wird auf ihnen lasten. Denn das Lamm in der Mitte vor dem Thron wird sie weiden und zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt, und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen." (Offb 7,15-17)
Nach anderen Aussagen der Heiligen Schrift besteht die Seligkeit des Himmels in der Anschauung Gottes "von Angesicht zu Angesicht" (1 Kor 13,12). "Das ist das ewige Leben: dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast." (Joh 17,3)
- "Wir wissen, daß wir ihm ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird; denn wir werden ihn sehen, wie er ist." (1 Joh 3,2)
Auch die Lehre der Kirche spricht von der Anschauung Gottes (vgl. DS 857; 1000, 1305, NR 926; 901-902, LG 49). Sie bedeutet, daß uns Gott in gnadenhafter Weise die ganze Fülle seines Lebens und seiner Liebe offenbart, daß uns die ganze Tiefe seiner Wahrheit und das unergründliche Geheimnis seiner Wirklichkeit aufgeht als Grund, Ziel und Inhalt unseres eigenen Seins und damit als unsere endgültige Sinnerfüllung, unser vollendetes Glück und unsere ewige Seligkeit. Die Anschauung Gottes darf also nicht rein intellektuell verstanden werden, sie schließt Liebe, Friede und Freude ein. Sie ist Teilnahme an Gottes eigener Seligkeit und die Vollendung unseres jetzigen gnadenhaften Seins in Jesus Christus und im Heiligen Geist. Sie ist vollendete Teilnahme am dreifaltigen Leben Gottes. Doch so wie Gott dem Menschen ein unergründliches Geheimnis ist, so auch die Gemeinschaft mit ihm. Wir könnenuns weder eine bildliche Vorstellung machen noch begrifflich exakt fassen, "was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist: das Große, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben" (1 Kor 2,9).
Die endgültige Gemeinschaft mit Gott bedeutet keine Isolierung, sondern begründet auch die vollendete" Gemeinschaft der Heiligen". So gehört zur Seligkeit des Himmels auch die Gemeinschaft mit Jesus Christus, mit den Engeln und Heiligen,die Gemeinschaft mit Angehörigen und Freunden aus der Zeit des Erdenlebens, die Freude über die Schönheit der Werke Gottes in der Schöpfung und in der Geschichte, über den Sieg der Wahrheit und der Liebe im eigenen Leben wie im Leben der andern.
Weil der Himmel die Erfüllung und Krönung des Lebens ist, geht auch die getane und erlittene Frucht unseres irdischen Lebens in die Verklärung des ewigen Lebens ein. Die Freude des Himmels ist deshalb auch Freude über den empfangenen Lohn (vgl. Mt 5,12). Dabei krönt Gott in der Krönung unserer Verdienste das Werk seiner eigenen Gnade. Jeder wird den ihm gemäßen Lohn empfangen (vgl. Mt 16,27; 1 Kor 3,8). Aus diesem Grund kann von unterschiedlichen Graden der himmlischen Seligkeit die Rede sein. Doch so wie kleine Gefäße auf ihre Weise genau so voll sind wie größere Gefäße, obwohl diese mehr enthalten, wird im Himmel jeder auf seine Weise ganz erfüllt und ganz im Frieden sein. Die eine Liebe Gottes wird durch den einen Heiligen Geist alle im einen Leib Jesu Christi verbinden in der gemeinsamen Verherrlichung Gottes und seiner Werke.
3.2 Die Hölle
Die Glaubensüberzeugung von der Hölle gilt vielen als problematisch. Sie meinen, dieses Leben sei oft Hölle genug. Sie sagen: Hölle - das sind die andern (J. P. Sartre), das sind freilich oft genug auch wir uns selbst. Man spricht von der Hölle des Krieges, von Auschwitz und Vietnam, vom Inferno von Hiroshima und Nagasaki, vom ersten Kreis der Hölle (A. Solschenizyn) u. a. Aber, so wird gefragt, kann man sich einen gütigen Gott denken, der in gnadenloser Weise ewige Höllenqualen will? Wie kann man Höllenpredigten, die Angst machen und Druck ausüben, mit der frohen und befreienden Botschaft des Evangeliums vereinbaren? Bedeutet die Überzeugung von ewigen Höllenstrafen nicht das Aufgeben der christlichen Solidarität mit allen Menschen?
Als Antwort kann man zunächst darauf verweisen, daß alles Deuteln nicht darüber hinwegtäuschen kann, daß nicht nur das Alte Testament, sondern auch Jesus und das Neue Testament den Bösen, den Gottlosen und den schweren Sündern die Möglichkeit der Verwerfung vor Augen gestellt haben (vgl. Mt 5,29-30; 10,28; 23,15.33 u. a.). Es ist die Rede vom ewigen Feuer (vgl. Mt 3,12; 25,41 u. a.), von der ewigen Pein (vgl. Mt 25,46), von Finsternis (vgl. Mt 8,12 u. a.), von Heulen und Zähneknirschen (vgl. Mt 13,42.50).
Die Lehre der Kirche, welche die Ewigkeit der Höllenstrafen ausdrücklich verteidigt hat, steht also auf einem guten und gesicherten biblischen Fundament. Vor allem hat die Kirche die dem Origenes (3. Jh.) zugeschriebene und später immer wieder vertretene Lehre verurteilt, am Ende der Zeit finde die Wiederherstellung (Apokatastasis) der ganzen Schöpfung statt, einschließlich der Sünder, Verdammten und Dämonen, zu einem Zustand vollkommener Glückseligkeit (vgl. DS 76; 411; 801; 1002, NR 916; 891; 896, 905; LG 48). Doch wäre, wenn Gott am Ende alle Menschen in sein Reich heimholen würde - auch diejenigen, die sich definitiv gegen ihn entschieden haben -, die Freiheit und damit die Würde des Menschen noch gewahrt? Gerade wenn wir "nicht von vornherein mit einer Versöhnung und Entsühnung für alle und für alles rechnen können, was wir tun oder unterlassen", greift diese Botschaft immer wieder verändernd in unser Leben ein und bringt Ernst und Dramatik in unsere geschichtliche Verantwortung (vgl. Gem. Synode, Unsere Hoffnung I,4).
Man muß die Aussagen der Heiligen Schrift über die Ewigkeit der Hölle freilich richtig verstehen. Nicht umsonst handelt es sich dabei um Mahnreden; sie haben eine ermahnende und zur Entscheidung herausfordernde Funktion. Es sollen dem Sünder die Konsequenzen seines Tuns vor Augen gehalten werden, nicht damit er bestraft werde, sondern damit er umkehre und so zum ewigen Leben finde. Deshalb wird weder in der Heiligen Schrift noch in der kirchlichen Glaubensüberlieferung von irgendeinem Menschen mit Bestimmtheit gesagt, er sei tatsächlich in der Hölle. Vielmehr wird die Hölle immer als reale Möglichkeit vor Augen gehalten, verbunden mit dem Angebot der Umkehr und des Lebens. So verstanden soll die Hölle den Ernst und die Würde der menschlichen Freiheit vor Augen führen, die zu wählen hat zwischen Leben und Tod. Gott achtet die Freiheit des Menschen, er zwingt seine beseligende Gemeinschaft keinem Menschen gegen dessen Willen auf. Die Heilige Schrift läßt auch keinerlei Zweifel daran, daß es Sünden gibt, die vom Reiche Gottes ausschließen (vgl. 1 Kor 6,9-10; Gal 5,20-21; Eph 5,5; Offb 21,8). Es geht also in unserem Leben um eine Entscheidung auf Leben und Tod. Die Heilige Schrift sagt uns freilich nicht, ob jemals ein Mensch sich tatsächlich in letzter Endgültigkeit gegen Gott entschieden und damit den Sinn seines Daseins endgültig verfehlt hat.
Das Wesen der Hölle wird uns in der Heiligen Schrift in Bildern ausgedeutet. Wenn dort vor allem vom Feuer der Hölle die Rede ist, dann ist dies nicht in einem grob-realistischen Sinn zu verstehen; schon gar nicht darf man an sadistische Quälereien denken. Aber auch ein rein geistiges Verständnis wird der Aussage der Schrift nicht gerecht. Im Bild wird vielmehr eine Realität viel tieferer Art ausgesagt. Es handelt sich um das verzehrende Feuer, das Gott in seiner Heiligkeit für das Böse, die Lüge, den Haß und die Gewalttat ist (vgl. Jes 10,17). Wie der Himmel Gott selbst als für immer gewonnener ist, so ist die Hölle Gott selbst als ewig verlorener. Das Wesen der Hölle ist also selbstverschuldeter endgültiger Ausschluß aus der Gemeinschaft mit Gott. Weil aber Gott allein die endgültige Sinnerfüllung des Menschen ist, bedeutet die Hölle die Erfahrung und den Schmerz letzter Sinnlosigkeit und die Verzweiflung über das endgültige Verlorensein des Menschen.
3.3 Das Fegfeuer
Die Lehre vom Fegfeuer wurde bereits im Judentum vorbereitet. Sie findet sich im Neuen Testament jedoch nur andeutungsweise. Die kirchliche Tradition stützt sich vor allem auf ein Wort Jesu, das die Möglichkeit der Vergebung in der künftigen Welt andeutet (vgl. Mt 12,32; 5,26), und auf ein Wort des Apostels Paulus, der von der Möglichkeit spricht, gerettet zu werden "wie durch Feuer hindurch" (1 Kor 3,15). Die eigentliche Grundlage dieser Lehre ist jedoch die Gebets- und Bußpraxis der Kirche. Schon am Ende des Alten Testaments wird das Gebet für die Verstorbenen als ein heiliger und frommer Gedanke bezeichnet (vgl. 2 Makk 12,45). Wir finden diese Praxis - wie nicht zuletzt viele Inschriften in den Katakomben zeigen - von Anfang an in der Kirche (vgl. LG 50). Diese Gebetspraxis setzt nicht nur ein Leben nach dem Tod voraus, sondern auch, daß es nach dem Tod für den Menschen noch eine Läuterungsmöglichkeit gibt. Zwar kann der Mensch nach Abschluß seines irdischen Pilgerdaseins nicht mehr aktiv an seiner Heiligung mitwirken; aber er kann durch Leiden geläutert und gereinigt werden. Die ganze Gemeinschaft der Heiligen kann ihm stellvertretend durch Gebet, Almosen, gute Werke und eigene Buße und nicht zuletzt durch die Feier der Eucharistie zur Seite stehen. Diese Überzeugung drückte sich zunächst vor allem in der Praxis des Gebets und Opfers für die Verstorbenen aus; erst allmählich wurde sie in der Lehre vom Zwischenzustand geklärt. Unser deutsches Wort "Fegfeuer" ist dabei eine recht unglückliche Übersetzung des amtlichen Wortes "purgatorium", "Läuterungsort" bzw. "Läuterungszustand".
Wenn vom Feuer die Rede ist, so ist dies ein Bild, freilich ein Bild, das auf eine tiefere Realität verweist. Das Feuer läßt sich verstehen als die läuternde, reinigende und heiligende Kraft der Heiligkeit und Barmherzigkeit Gottes. Die im Tod sich ereignende Begegnung mit dem Feuer der Liebe Gottes hat für den Menschen, der sich zwar grundsätzlich für Gott entschieden, aber diese Entscheidung nicht konsequent verwirklicht hat und hinter dem Ideal zurückgeblieben ist - und bei wem wäre dies nicht der Fall! -, eine läuternde und umwandelnde Kraft, die alles beim Tod noch Unvollkommene richtet, reinigt, heilt und vollendet. Das Fegfeuer ist also Gott selbst in seiner reinigenden und heiligenden Macht für den Menschen. Auf diesem Hintergrund sind die Lehraussagen der Kirche über das Fegfeuer verstehbar (vgl. DS 856; 1304; NR 926). Sie lauten in ihrer knappsten Form:
- "Es gibt einen Reinigungsort, und die dort festgehaltenen Seelen finden eine Hilfe in den Fürbitten der Gläubigen, vor allem aber in dem Gott wohlgefälligen Opfer des Altares." (DS 1820, NR 907)
Die Kirchen des Ostens teilen mit der katholischen Kirche die Praxis des Gebets und Opfers für die Toten. Aber sie haben den lehrhaften Klärungsprozeß nicht mitvollzogen. Die Reformatoren haben die Fegfeuerlehre ganz verworfen, weil sie in der darin begründeten Praxis des Gebets und Opfers für die Toten einen Angriff auf die Alleingenügsamkeit des Kreuzesopfers Jesu Christi sahen (vgl. CA 24). Aber auch die katholische Lehre mahnt zur Zurückhaltung: "Keinen Platz aber haben in den volkstümlichen Predigten vor dem ungebildeten Volk schwierige und spitzfindige Fragen, die die Erbauung nicht fördern und meist die Frömmigkeit nicht mehren." Die Bischöfe sollen deshalb verbieten, was "nur einer Art Neugierde dient oder dem Aberglauben oder nach schmählichem Gewinn aussieht" (DS 1820; NR 908). So ist bei aller Festigkeit in der Lehre eine deutliche Mahnung zur Nüchternheit festzustellen, die naive oder phantasievolle Spekulationen zurückweist.
Die volkstümliche Rede von den "armen Seelen" ist insofern berechtigt, als deren Armut darin besteht, daß sie sich nicht aktiv, sondern nur passiv läutern und heiligen können. Im Grunde handelt es sich jedoch nicht um "arme Seelen", sondern um Seelen, die den ganzen Reichtum der Barmherzigkeit Gottes erfahren und die uns in der Verwirklichung der Hoffnung und in der Nähe zu Gott einen wesentlichen Schritt voraus sind. Ihr Schmerz besteht im Angesicht Gottes eben darin, daß sie noch nicht lauter genug sind, um sich von Gottes Liebe ganz erfüllen und beseligen lassen zu können. Es handelt sich also um den reinigenden Schmerz der Liebe. In dieser Liebe sind alle Glieder des einen Leibes Jesu Christi solidarisch verbunden. Deshalb können sie betend und büßend füreinander einstehen und so für den Leib Jesu Christi, die Kirche, das ergänzen, "was an den Leiden Christi noch fehlt" (Kol 1,24). Nicht als ob Jesus Christus durch sein Leiden und Sterben nicht genug getan hätte zu unserer Erlösung. Im Gegenteil, er hat mehr als genug getan und läßt uns an der Auswirkung seines Heilswerkes teilnehmen, so daß wir stellvertretend etwas für das Heil der anderen tun können.
3.4 Der neue Himmel und die neue Erde
Als Christen hoffen wir auf das Reich Gottes, wie es uns Jesus Christus verkündet hat. Es hat durch Jesus Christus im Heiligen Geist bereits endgültig begonnen; in der Kirche und in ihren Sakramenten reicht es schon jetzt in unsere Gegenwart herein. Aber es hat seine Vollendung noch nicht gefunden. "Wir sind gerettet, doch in der Hoffnung" (Röm 8,24; vgl. 1 Petr 1,3). So leben wir als Christen zwischen den Zeiten. Noch erwarten wir das vollendete Reich Gottes, in dem Gott "alles und in allem" sein wird (1 Kor 15,28), in dem alle Gerechtigkeit erfüllt und die Freiheit der Kinder Gottes endgültig offenbar sein wird (vgl. Röm 8,19.21), in dem auch die Kirche "ohne Flecken, Falten oder andere Fehler" heilig und makellos dastehen wird (Eph 5,27). Wir hoffen noch auf den neuen Himmel und die neue Erde (vgl. Jes 65,17; 66,22; 2 Petr 3,13; Offb 21,1). "Denn wir wissen, daß die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt" (Röm 8,22).
"Das Leben der kommenden Welt" beinhaltet also nicht nur die Erfüllung der Hoffnung des einzelnen Gläubigen, sondern auch der Kirche und der Menschheit, ja der Schöpfung insgesamt. Die Vollendung des leibhaftigen Menschen wäre gar nicht möglich ohne Vollendung der Welt, umgekehrt ist die Welt auf den Menschen hin geschaffen, nur als Raum der menschlichen Geschichte und Vollendung hat sie einen Sinn. Deshalb gehören die menschliche, die menschheitliche und die kosmische Vollendung in einem großen Gesamtgeschehen unlösbar zusammen. Nur so kann festgehalten werden, daß Gott Herr, Licht und Leben aller Wirklichkeit ist.
Wir können von diesem vollendeten Reich Gottes nur in Bildern und Gleichnissen sprechen, so wie sie im Alten und Neuen Testament, vor allem von Jesus selbst erzählt und bezeugt sind. Die Propheten des Alten Testaments sprechen vor allem vom großen Frieden (schalom) der Menschen und der Natur im Angesicht Gottes.
- "Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen. Man zieht nicht mehr das Schwert, Volk gegen Volk, und übt nicht mehr für den Krieg."(Jes 2,4)
- "Dann wohnt der Wolf beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein...Der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter... Man tut nichts Böses mehrund begeht kein Verbrechenauf meinem ganzen heiligen Berg." (Jes 11,6.8-9, vgl. Mi 4,3)
Jesus spricht vom Reich Gottes oft im Bild des Hochzeitsmahles (vgl. Mt 22,1-14 u. a.) und meint damit eine enge, frohe und festliche Gemeinschaft des Lebens und der Liebe. Die Offenbarung des Johannes schließlich gebraucht das grandiose Bild vom neuen Jerusalem:
- "Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen; sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen! Er wird in ihrer Mitte wohnen, und sie werden sein Volk sein; und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen: Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu." (Offb 21,2-5)
Neben den Bildern, die von Frieden, Versöhnung, Heil sprechen, finden sich in der Heiligen Schrift Bilder vom Weltuntergang, die zu allen Zeiten immer wieder einen so tiefen Eindruck hinterlassen haben: Sonne und Mond werden sich verfinstern, die Sterne werden vom Himmel fallen, das Weltgebäude wird zusammenbrechen, und die Elemente werden sich auflösen (vgl. Mk 13,24-25 par.; 2 Petr 3,10). In diesen Bildern kommt im zeitbedingten Weltbild von damals etwas bleibend Gültiges zur Sprache: Der Bestand dieser Welt gibt dem Menschen keine letzte Sicherheit; diese Welt ist vielmehr vergänglich. Noch mehr: Diese Welt seufzt unter der Sklaverei und Verlorenheit aufgrund der Sünde, und sie möchte davon befreit werden (vgl. Röm 8,21): Die von der Sünde entstellte, den Menschen oft blendende und verführende Gestalt dieser Welt also vergeht (vgl. 1 Kor 7,31). Der hl. Augustinus erklärt unter Bezugnahme auf dieses Wort: "Die Gestalt vergeht, nicht die Natur". Deshalb haben in der Heiligen Schrift nicht die Angst vor dem Untergang, sondern die Hoffnung auf die Neuschaffung der Welt (vgl. Mt 19,28, Apg 3,21), auf den neuen Himmel und die neue Erde das letzte Wort. Die neue Schöpfung ist im Unterschied zur ersten Schöpfung keine Schöpfung aus Nichts. Sie geschieht an der ersten Schöpfung und bedeutet darum nicht Abbruch und Ende, sondern Vollendung der Welt. Denn Gott ist treu auch gegenüber seiner Schöpfung. Aber die Erlösung der Schöpfung ist auch nicht nur die Verlängerung, die Verbesserung, der Fortschritt oder die Evolution der bestehenden Wirklichkeit. Die Verklärung aller Wirklichkeit durch die universal offenbar werdende Herrlichkeit Gottes ist zugleich eine krisenhafte Erschütterung der Gestalt dieser Welt.
Alle diese Aussagen sagen uns nichts über das konkrete Wie der kommenden neuen Welt. Wir können diese Bilder nicht einfach ",übersetzen', wir können sie eigentlich nur schützen, ihnen treu bleiben und ihrer Auflösung in die geheimnisleere Sprache unserer Begriffe und Argumentationen widerstehen, die wohl zu unseren Bedürfnissen und von unseren Plänen, nicht aber zu unserer Sehnsucht und von unserer Hoffnung spricht" (Gem. Synode, Unsere Hoffnung 1,6). So dürfen wir diese Bilder weder mit unseren heutigen kosmologischen Theorien von der Zukunft des Universums auf eine Ebene stellen, noch dürfen sie verwechselt werden mit innerweltlichen Zukunftsutopien. Das Neue Testament drückt das Entscheidende, um das es dabei geht, aus mit dem Wort: Gott "alles und in allem" (1 Kor 15,28). Wenn Gottes Herrlichkeit universal offenbar sein wird, dann wird auch die tiefste Sehnsucht der Kreatur erfüllt und das Reich der Freiheit der Söhne und Töchter Gottes Wirklichkeit werden (vgl. Röm 8,22-23). Die Gerechtigkeit, das Leben, die Freiheit und der Friede Gottes, das Licht seiner Wahrheit und die Herrlichkeit seiner Liebe werden dann alles erfüllen und verklären. Gottes Herrschaft und Herrlichkeit werden die letzte, alles umfassende und beseligende Wirklichkeit sein.
Die christliche Hoffnung erwartet die Vollendung der Menschheit und der Welt "aus der verwandelnden Macht Gottes, als endzeitliches Ereignis, dessen Zukunft für uns in Jesus Christus bereits unwiderruflich begonnen hat" (Gem. Synode, Unsere Hoffnung 1,6). Wir können die neue Welt weder evolutionär noch revolutionär, weder konservativ noch progressiv aufbauen. Wir können sie nicht einmal vorbereiten, indem wir unter falscher Berufung auf Offb 20,4-6 ein "tausendjähriges Reich" errichten. Das Reich Gottes ist als Gottes Tat keine innerweltliche Zukunftsutopie. Hier ist der alten und stets neuen Versuchung und Illusion des Schwärmertums, das einen Gottesstaat hier auf Erden errichten will, zu widerstehen.
Dennoch ist die Hoffnung auf das Reich Gottes geschichtlich nicht folgenlos. Im Gegenteil, sie erschließt uns erst die volle Bedeutung der Zeit und der Geschichte. Sie richtet sich gegen die "Verheißungslosigkeit, die in einer rein technokratisch geplanten und gesteuerten Zukunft der Menschheit steckt" und eine "innere Leere, Angst und Furcht erzeugt". Die Verheißungen des Reiches Gottes sind auch "nicht gleichgültig gegen das Grauen und den Terror irdischer Ungerechtigkeit und Unfreiheit, die das Antlitz des Menschen zerstören" (Gem. Synode, Unsere Hoffnung 1,6). Aus der Kraft der christlichen Hoffnung und Liebe können und müssen die Christen schon in dieser Welt je nach ihren Möglichkeiten in fragmentarischer und umrißhafter Weise die Wirklichkeit des Reiches Gottes vorwegnehmen als Friedensstifter und Barmherzige, als Menschen, die keine Gewalt anwenden, sondern in Armut und Lauterkeit des Herzens hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit und sich dafür auch verfolgen lassen (vgl. Mt 5,3-12). Ihr Werk des Friedens und der Gerechtigkeit soll Wirkung und Vorausbild der vollendeten Gerechtigkeit und des endgültigen Friedens im Reiche Gottes sein (vgl. GS 78). Schließlich gehört zur christlichen Hoffnung auch die Verantwortung für die Welt als Schöpfung und als menschenwürdige Umwelt des Menschen. So muß man endgeschichtliche und innergeschichtliche Hoffnung zwar unterscheiden; aber man kann sie nicht grundsätzlich trennen. Das II. Vatikanische Konzil lehrt:
- "Zwar werden wir gemahnt, daß es dem Menschen nichts nützt, wenn er die ganze Welt gewinnt, sich selbst jedoch ins Verderben bringt; dennoch darf die Erwartung der neuen Erde die Sorge für die Gestaltung dieser Erde nicht abschwächen, auf der uns der wachsende Leib der neuen Menschenfamilie eine umrißhafte Vorstellung von der künftigen Welt geben kann, sondern muß sie im Gegenteil ermutigen. Obschon der irdische Fortschritt eindeutig vom Wachstum des Reiches Christi zu unterscheiden ist, so hat er doch große Bedeutung für das Reich Gottes, insofern er zu einer besseren Ordnung der menschlichen Gesellschaft beitragen kann." (GS 39)
Keine noch so große menschliche Anstrengung kann freilich jemals die ganze Dynamik und Größe der christlichen Hoffnung erfüllen. Weil die christliche Hoffnung alle menschlichen Grenzen überschreitet, liegt es in ihrem Wesen, rein menschlich enttäuscht zu werden. Sie wird in dieser Welt immer mit Anfechtungen, Leiden, Bedrängnissen und Verfolgungen verbunden sein. Dennoch braucht der Christ, der an den Gott der Hoffnung (vgl. Röm 15,13) glaubt, in den Enttäuschungen des Lebens und den Rückschlägen und Katastrophen der Geschichte nicht zu resignieren. Seine Hoffnung ist in dem Gott, der durch Jesus Christus im Heiligen Geist seine Liebe endgültig geoffenbart und uns mitgeteilt hat, fest begründet. Deshalb kann er mit dem Schlußvers des "je Deum" ("Großer Gott, wir loben dich") (4. Jh.) sprechen:
- "Auf dich, o Herr,
- habe ich meine Hoffnung gesetzt.
- In Ewigkeit werde ich nicht zuschanden."
- (Gotteslob 706,4; vgl. 257)
Dieses Vertrauen und diese Hoffnung bringt auch das "Amen" zum Ausdruck, mit dem wir das Glaubensbekenntnis der Kirche bei seinem liturgischen Gebrauch schließen. Im hebräischen Urtext geht das Wort "Amen" auf dieselbe Wurzel zurück wie das Wort "glauben". Das "Amen" am Schluß nimmt also das "Ich glaube" am Anfang des Credo wieder auf und bekräftigt es nochmals: "Ja, so ist es", "dazu stehe ich", "in diesem Glauben ist meine Hoffnung fest gegründet". Nach dem Neuen Testament heißt Jesus Christus selbst "der Amen" (Offb 3,14). Er ist Grund, Inhalt und Ziel unserer Hoffnung.
"Er ist das Ja zu allem, was Gott verheißen hat. Darum rufen wir durch ihn zu Gottes Lobpreis auch das Amen" (2 Kor 1,20).
Zweiter Band: Leben aus dem Glauben
Vorwort
Zehn Jahre sind vergangen, seit die Deutsche Bischofskonferenz den ersten Band des Katholischen Erwachsenen-Katechismus "Das Glaubensbekenntnis der Kirche" herausgegeben hat. Die deutschen Bischöfe sind dankbar für die gute Aufnahme, die er im In- und Ausland erfahren hat.
Der nun vorliegende zweite Band über das christliche Ethos ist mit dem ersten eng verbunden. Der Glaube als Geschenk und Anruf Gottes steht unter der Forderung, sich auch im täglichen Leben zu bewähren. Die biblischen Weisungen und Gebote und die auf ihnen gegründete Sittenlehre der Kirche wollen den Christen zu einem gelungenen, sinnerfüllten und vom Glauben bestimmten Leben verhelfen: "Wenn du das Leben erlangen willst, halte die Gebote!" (Mt 19,17). Die Zehn Gebote, die nach alter Überlieferung im Katechismus entfaltet und auf die heutige Lebenswirklichkeit der Christen übertragen werden, sind zunächst Gottes Gabe, bevor sie für uns zur Aufgabe werden.
Der zweite Band war zugleich mit dem ersten geplant worden. Seine Ausarbeitung verlangte viele Kräfte und wurde immer wieder durch Verzögerungen unterbrochen. Der Band erscheint nun nach der Veröffentlichung des Katechismus der Katholischen Kirche (1992, deutsche Ausgabe 1993) und der Enzyklika Papst Johannes Pauls II. "Veritatis Splendor" vom 6. August 1993 über einige grundlegende Fragen der kirchlichen Sittenlehre. Im Erwachsenen-Katechismus finden sich immer wieder Hinweise darauf. Dadurch soll zum Ausdruck gebracht werden, daß die drei Texte bei allen Verschiedenheiten eine innere Einheit bilden. Diese Gemeinsamkeit mit der ganzen Kirche durchzieht wie ein roter Faden den ganzen Erwachsenen-Katechismus.
Katechismen auf der Ebene einer Teilkirche haben dennoch ihren guten Sinn und Nutzen. Gerade das Ethos bedarf der konkreten Einwurzelung in einer bestimmten Geschichte und Gesellschaft. In der Apostolischen Konstitution "Fidei Depositum" vom 11. Oktober 1992 zur Veröffentlichung des Katechismus der Katholischen Kirche schreibt Papst Johannes Paul II.:
"Dieser Katechismus ist nicht dazu bestimmt, die von den kirchlichen Autoritäten, den Diözesanbischöfen und den Bischofskonferenzen vorschriftsgemäß approbierten örtlichen Katechismen zu ersetzen, besonders wenn sie die Approbation des Apostolischen Stuhles erhalten haben. Er ist dazu bestimmt, zur Abfassung neuer örtlicher Katechismen zu ermuntern und die zu unterstützen, die den verschiedenen Situationen und Kulturen Rechnung tragen, aber zugleich sorgfältig die Einheit des Glaubens und die Treue zur katholischen Kirche wahren." Der Katholische Erwachsenen-Katechismus will diese "notwendigen Anpassungen" (vgl. Prolog, Nr. 24) vornehmen und so eine ethische Orientierungshilfe in der Situation und Kultur unseres Landes und unserer Sprache bilden.
Die Deutsche Bischofskonferenz hat auf ihrer Herbst-Vollversammlung vom 21. bis 24. September 1992 in Fulda beschlossen, den öfter von ihr beratenen Text über das christliche Ethos, der das Leben aus dem Glauben darstellt, als zweiten Band des Katholischen Erwachsenen-Katechismus herauszugeben (vgl. can. 775,2 CIC). Die notwendige Approbation der Kleruskongregation in Rom wurde am 28. Juni 1994 erteilt. Danach erfolgte eine weitere Überarbeitung, wobei vor allem die Hinweise auf den Katechismus der Katholischen Kirche und auf die Enzyklika "Veritatis Splendor" eingefügt wurden. Die Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz vom 20. bis 23. September 1994 gab schließlich nach letzten Modifizierungen einmütig ihre Zustimmung zum endgültigen Text. Sie ist damit die Herausgeberin auch des zweiten Bandes des Katholischen Erwachsenen-Katechismus.
Ich danke der Katechismuskommission, die den vorliegenden Text erarbeitet hat. Ihre Mitglieder und Berater haben viel Zeit und Kraft für die Erstellung beider Bände geopfert. Unser Dank gebührt vor allem Friedrich Kardinal Wetter, Erzbischof von München und Freising, der seit September 1982 die Vorbereitungsarbeiten geleitet hat. Der besondere Dank der Deutschen Bischofskonferenz gilt Msgr. Professor Dr. Wilhelm Ernst (Erfurt), der bei der Erstellung des Textes die Hauptlast getragen hat. Schon vor der Verwirklichung der deutschen Einheit hatten wir aus stetiger Verbundenheit mit der Kirche in der ehemaligen DDR diese enge Zusammenarbeit mit ihm gesucht.
Der vorliegende zweite Band des Katholischen Erwachsenen-Katechismus weiß um seine Grenzen. Er ist nicht selbst schon die notwendige Erneuerung der Katechese über das Leben aus dem Glauben. Er ist nur ein Instrument, das im Dienst der katechetischen Erneuerung und überhaupt der Neu-Evangelisierung unseres Landes und Europas steht. Er möchte den Christen helfen, sich selbst und der Welt Rechenschaft zu geben: "Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt" (1 Petr 3,15). Ich wünsche dem Katholischen Erwachsenen-Katechismus, daß er für ein so verantwortetes Leben aus dem Glauben vielen Menschen zu einer ermutigenden Orientierungshilfe wird.
Bischof Karl Lehmann
Erster Teil: Ruf Gottes - Antwort des Menschen
I. Der Mensch vor dem Ruf Gottes
1. Anruf zum Menschsein
Viele Menschen unserer Zeit haben ein tiefes Gespür für Menschenwürde und Menschenrechte. Das spiegelt sich wider im Verlangen nach Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung, in der Sehnsucht nach Freiheit und Identität, in der Forderung nach Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung.
Diese Einsichten und Einstellungen erhalten in der heutigen Lebenswelt ein besonderes Gewicht. Durch unterschiedliche Philosophien, Weltanschauungen, Religionen und Konfessionen, durch Wissenschaft und Technik, durch Wandlungen in Gesellschaft und Wirtschaft und durch politische Umbrüche scheint sich ein neues Zeitalter anzukündigen. "Heute steht die Menschheit in einer neuen Epoche ihrer Geschichte, in der tiefgreifende und rasche Veränderungen Schritt um Schritt auf die ganze Welt übergreifen" (GS 4).
In dieser Situation stellt der Mensch in besonderer Weise die Frage nach sich selbst. Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Hierauf gibt es unterschiedliche Antworten. Christen bezeugen im Glauben, daß ihnen auf die Frage nach Wesen, Ursprung und Ziel des Menschen die letzte Antwort von Gott her gegeben ist; denn er hat den Menschen erschaffen, er erlöst und befreit ihn durch Jesus Christus und verheißt die endgültige Vollendung in der Herrlichkeit des neuen Himmels und der neuen Erde (vgl. KEK 1, 113f).
Zu diesem glaubenden Vertrauen sind alle Menschen eingeladen. Gott will alle Menschen erlösen und befreien. Er selbst will in Jesus Christus und in seiner Kirche die Antwort geben auf die Ursehnsucht nach Sinn und Ziel des Lebens, nach Erfüllung des eigenen Ich in seinen Strebungen und Gefühlen, in seiner Liebe und in seinem Verlangen nach Gerechtigkeit in der Welt und nach Barmherzigkeit für die Lebenden und die Toten.
Im Suchen nach sich selbst stellt der Mensch nicht nur die Frage: Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich?, sondern auch: Was soll ich tun? Wer soll ich sein? Das ist die ethische Grundfrage. Es geht darum, was zu tun ist, damit das Menschsein gelingt, das heißt ein in sittlichem Sinne gutes Menschsein wird. Wer sollen wir sein und was sollen wir tun, damit wir in Mitmenschlichkeit, Gerechtigkeit und Liebe unserer Menschenwürde entsprechen und zur Humanisierung des Lebens in der Welt beitragen können?
Wir erfahren die Antwort auf die ethische Grundfrage im Grundgesetz der Sittlichkeit, das sich uns im Gewissen als sittlicher Anspruch kundtut.
"Im Innern seines Gewissens entdeckt der Mensch ein Gesetz, das er sich nicht selbst gibt, sondern dem er gehorchen muß und dessen Stimme ihn immer zur Liebe und zum Tun des Guten und zur Unterlassung des Bösen aufruft und, wo nötig, in den Ohren des Herzens tönt: Tu dieses, meide jenes" (GS 16). Das Gewissen ist somit zum einen der urtümliche Ort, an dem wir erfahren, daß wir in unserer Freiheit beansprucht sind. Zum anderen wird uns im Gewissen kund, wozu wir in unserer Freiheit aufgefordert sind: zum Tun des Guten und zum Meiden des Bösen. Diese Forderung stellt sich als unabdingbare Sollensforderung an jeden Menschen. Sie wird sittliches Naturgesetz oder natürliches Sittengesetz genannt, "weil die Vernunft, die es verkündet, zur menschlichen Natur gehört" (KKK 1955). "Das Gesetz der Natur ist nichts anderes als das von Gott in uns hineingelegte Licht der Vernunft. Durch es erkennen wir, was zu tun und was zu meiden ist. Dieses Licht und dieses Gesetz hat Gott dem Menschen in der Schöpfung gegeben" (Thomas von Aquin, dec. praec. prol.; KKK 1955). Es "ist in seinen Vorschriften allgemeingültig, und seine Autorität erstreckt sich auf alle Menschen. Es bringt die Würde der Person zum Ausdruck und bestimmt die Grundlage ihrer Grundrechte und -pflichten" (KKK 1956; vgl. VS 35-53).
Im Zusammenhang mit diesem Anspruch an unsere Freiheit sowie mit der Forderung nach dem guten und richtigen Handeln und Verhalten begegnen wir in der Alltagssprache, aber auch im philosophischen und theologischen Sprachgebrauch immer wieder solchen Begriffen wie Ethos, Ethik, Moral, Moraltheologie und Sittlichkeit.
Das Wort Ethos leitet sich vom Griechischen ab und bedeutet ursprünglich Gewohnheit, Gewöhnung (ethos), aber auch den gewohnten Lebensraum (‚thos). Im heutigen Sprachgebrauch kann das Ethos die ethische (sittliche) Einstellung und Lebenshaltung eines einzelnen oder einer Gemeinschaft ausdrücken, es kann aber auch einen bestimmten Typ von Ethos bezeichnen. So sprechen wir im Unterschied zu anderen Typen des Ethos vom biblischen oder christlichen Ethos.
Der Begriff Ethik leitet sich vom gleichen griechischen Wortstamm ab wie Ethos. Seit der Antike wird unter Ethik die Lehre von der Begründung und Rechtfertigung des Ethos verstanden. Nach Aristoteles ist Ethik die Lehre von der Tugend; sie ist theoretisches Erfassen und Begründen dessen, was gutes und richtiges Handeln ausmacht, was den Menschen und sein Handeln gut sein läßt und was ihn zu seinem Ziel und Glück führt. Heute unterscheidet man in der Ethik als ethische Theorie zwischen Meta-Ethik (Begründung der Ethik), Tugend-Ethik (Haltungsethik) und Norm-Ethik (Normative Theorie).
Der Ausdruck Moral geht auf das lateinische Wort mos (Sitte) und mores (Sitten) zurück und wird in der römischen im gleichen Sinne wie in der griechischen Ethik als Moralphilosophie (philosophia moralis) verstanden. Im heutigen Sprachgebrauch bezeichnet Moral manchmal die Lehre von der Moral (Sittlichkeit), manchmal die moralische Einstellung und Haltung eines einzelnen, eines Typs der gesellschaftlichen Moral (bürgerliche Moral) oder der gesamtgesellschaftlichen (der bäuerlich-handwerklichen und der modernen menschenrechtlich begründeten) Moral.
Der Begriff Moraltheologie hat sich erst am Beginn der Neuzeit herausgebildet, als in der Theologie der Dogmatik die Moraltheologie als eigenes Lehrfach über das sittliche Handeln des Christen im Licht des Glaubens entstand. Heute wird der Begriff Moraltheologie auch dazu verwendet, den Unterschied zur philosophischen Ethik herauszustellen. Im protestantischen Raum ist anstelle von Moraltheologie der Begriff Theologische Ethik üblich. Öfter begegnet für den Begriff Moraltheologie auch heute noch das veraltete (weil verengende) Wort Sittenlehre. Dabei ist zu beachten, daß Moraltheologie nicht nur Lehre von den Sitten ist, sondern insbesondere von der Sittlichkeit.
Sittlichkeit (sittlich) ist die freie Selbstbestimmung, in welcher der Mensch auf den Anspruch des absoluten Gutes antwortet, den er im Gewissen vernimmt.
Sofern er sich entscheidet, den Anspruch zu befolgen, das Gute zu tun und das Böse zu meiden, handelt er sittlich gut; sofern er sich gegen diesen Anspruch entscheidet, handelt er sittlich schlecht.
2. Freiheit und Sittlichkeit
Können wir den Anspruch des Sittlichen als Aufruf zum Tun des Guten und zur Unterlassung des Bösen erfüllen? Können wir diesem unbedingten Anspruch, der alle Menschen angeht, gerecht werden? Es geht im sittlichen Handeln nicht um naturhaft verlaufende oder um technische Vollzüge, sondern um ein Tun, das aus der Freiheit hervorgeht und in welchem wir uns neben selbst zu dem bestimmen, der wir sein wollen. Ohne Entscheidungsfreiheit ist die Erfüllung der sittlichen Forderung nicht möglich. Nur in Freiheit ist der Mensch ein moralisches Wesen; nur im Besitz der Freiheit kann er seine Antwort auf den unbedingten Anruf zum Guten und zum Gutsein geben.
In der Geschichte der Menschheit gibt es bis heute Meinungen, welche die Fähigkeiten des Menschen zu verantwortlicher Freiheitsentscheidung leugnen. Manchmal wird dem Menschen zwar ein gewisses Maß an Freiheit zuerkannt, aber die Fähigkeit zur Selbstbestimmung gilt als so eingeschränkt oder herabgemindert, daß sie nicht zu einer verantwortlichen, anrechenbaren Entscheidung ausreicht. Nach diesen Meinungen ist es dem Menschen nicht möglich, sich in einer personalen Grundausrichtung auf das Ziel eines umfassend gelingenden Lebens hin zu entwerfen und aus dieser Grundentschiedenheit heraus sein Tun und Lassen verantwortlich zu bestimmen. Dem gegenüber betont die kirchliche Lehre: "Die Freiheit ist die in Verstand und Willen verwurzelte Fähigkeit, zu handeln oder nicht zu handeln, dieses oder jenes zu tun und so von sich aus bewußte Handlungen zu setzen. Durch den freien Willen kann jeder über sich selbst bestimmen. Durch seine Freiheit soll der Mensch in Wahrheit und Güte wachsen und reifen" (KKK 1731). Die Freiheit als Voraussetzung zu sittlichen Entscheidungen erfährt der Mensch in den verschiedenen Dimensionen seines Menschseins.
Der Mensch ist eine einmalige, unwiederholbare und unverwechselbare Person. Trotz vieler innerer und äußerer Begrenzungen ist er frei. Er kann, sofern er nicht in schwerster Weise geistig oder seelisch krank ist, zu sich selbst und zu seinem Tun Stellung nehmen und sich selbst bestimmen. Er ist nicht ein Spielball des Schicksals, er spielt nicht eine bloße Rolle in Geschichte und Gesellschaft, und er ist auch nicht ein nur triebgesteuertes Wesen. Die Fähigkeit zu freier Stellungnahme und zu sittlicher Selbstbestimmung macht seine Würde als Mensch aus.
- "Die Würde des Menschen verlangt, daß er in bewußter und freier Wahl handle, das heißt personal, von innen her bewegt und geführt und nicht unter blindem innerem Drang oder unter bloßem äußerem Zwang" (GS 17).
"Mit Recht wird diese Freiheit heute hoch geschätzt und leidenschaftlich erstrebt. Denn zur Würde des Menschen gehört seine freie Selbstbestimmung (Autonomie); der Mensch will und muß sein persönliches und gesellschaftliches Leben eigenverantwortlich selbst gestalten" (KEK 1, 122).
Unsere Würde unterscheidet uns von allen anderen innerweltlichen Wesen; in ihr erfahren wir unsere Verantwortung; wir tragen Verantwortung für uns selbst und für andere. Diese Fähigkeit engt nicht ein, sondern befreit zu verantworteter Bindung. Die in Freiheit getroffenen Entscheidungen sind unsere persönlichen Entscheidungen. Es sollen überlegte Entscheidungen sein, denn für sie sind wir verantwortlich (vgl. KKK 1734-1736; VS 39).
Freiheit und Anspruch zu verantwortlicher Entscheidung erfahren wir grundlegend im Mitsein und in Mitmenschlichkeit. In Begegnungen, die uns sittlich herausfordern, erkennen wir, daß Freiheit nicht individualistische, egoistische oder Willkürfreiheit sein soll, sondern sie findet ihre Ermöglichung und ihre Grenzen an der Freiheit der anderen, an ihrer Zuwendung, an ihrer Liebe, an ihrer Würde und an ihren Rechten. Nur so ist ein sinnvolles Leben in Gemeinschaft möglich. Da jeder Mensch die gleiche Würde besitzt, müssen alle auf diese achten und dürfen sie niemals für egoistische Zwecke mißbrauchen (vgl. KKK 1738).
Diese Erfahrung der Freiheit als beanspruchte Freiheit hat zu dem allgemein anerkannten Prinzip geführt: "Was du nicht willst, daß man dir tu, das füg auch keinem andern zu" (Goldene Regel). "Die menschliche Person bedarf des gesellschaftlichen Lebens. Dieses stellt für sie nicht etwas Zusätzliches dar, sondern ist ein Anspruch ihrer Natur. Durch Begegnung mit anderen, durch wechselseitige Dienste und durch Zwiesprache mit seinen Brüdern und Schwestern entwickelt der Mensch seine Anlagen und kann seiner Berufung entsprechen" (KKK 1879). Identitätsfindung und können nicht auf Kosten anderer erstrebt werden. Wer das dennoch versucht, handelt zutiefst inhuman und verletzt dadurch sich selbst und den anderen. Wenn in der Gemeinschaft das Ethos der Mitmenschlichkeit überzeugend verwirklicht wird, kann es der einzelne in persönlicher Freiheitsentscheidung übernehmen und zur Grundlage seiner individuellen Identität und Selbstverwirklichung machen. "Je mehr man das Gute tut, desto freier wird man. Wahre Freiheit gibt es nur im Dienst des Guten und der Gerechtigkeit. Die Entscheidung zum Ungehorsam und zum Bösen ist ein Mißbrauch der Freiheit und macht zum Sklaven der Sünde" (KKK 1733).
Freiheit als sittlich beanspruchte Freiheit erfahren wir auch in der Erkenntnis unserer leiblichen Begrenztheit und Endlichkeit sowie in der Unausweichlichkeit von Leid, Unglück, Krankheit, Sterben und Tod. Vieles von dem, was uns als Schicksal trifft, können wir nicht begreifen. Auf die Frage nach dem Warum und Wozu haben wir oft keine befriedigende Antwort. Hier versagen alle großen Worte, alle einfachen Erklärungen und vordergründigen Tröstungen; hier gerät oft auch die Freiheit an eine Grenze, die eine Entscheidung kaum noch zuläßt. Aber selbst das Ertragen und Hinnehmen kann hier noch aus jener freien Grundentscheidung leben, die durch alle Begrenztheit und Endlichkeit durchträgt und auch im Leiden und Sterben nicht zurückgenommen wird.
Eine letzte wichtige Erfahrung von Freiheit als Voraussetzung und Anspruch der Sittlichkeit ist schließlich die Erfahrung des Versagens, der Sünde, der Schuld und der Vergebung. In ihnen leuchtet der Anspruch der sittlichen Freiheit in besonderer Weise auf. Sünde, Schuld und Vergebung lassen uns erfahren: Unsere Freiheit, in der wir zum Guten berufen sind, kann sich auch in Entscheidungen zum Bösen verfehlen; in unseren persönlichen Freiheitsentscheidungen können wir versagen und schuldig werden; unsere Entscheidungen haben schwerwiegende gute oder schlechte Folgen für uns und andere; sie können gerechte und ungerechte Strukturen und Institutionen schaffen. Die Geschichte des einzelnen Menschen wie der Menschheit ist nicht nur eine Geschichte gelungenen Menschseins, sondern auch eine Geschichte der Schuld, die der Umkehr und der Vergebung bedarf. Voraussetzung für sittliches Versagen wie für das Entstehen von Strukturen, in denen die Sünde sich verfestigt hat, ist immer die menschliche Freiheit, in der wir zum Guten berufen sind und oft doch das Böse tun (vgl. KKK 1739).
Zusammenfassend können wir sagen: Der Mensch besitzt die Entscheidungsfreiheit als beanspruchte Freiheit und ist so für sein Tun und Lassen verantwortlich. Er erfährt im Gewissen den unbedingten Anspruch, das Gute zu tun und das Böse zu meiden. In Grunderfahrungen leuchten ihm unverzichtbare vorgegebene Werte auf, die seine Freiheit unbedingt beanspruchen. Dazu gehören besonders die Achtung der Personwürde des Menschen, der Gleichheit aller Menschen, der Gleichwertigkeit und Gleichrangigkeit von Mann und Frau, der Gerechtigkeit und Liebe unter den Menschen und der Mitverantwortung für die Gestaltung und Bewahrung Schöpfung. In einer personalen Grundentscheidung bestimmt der Mensch auf Grund vorgegebener Werte selbst, wer er sein will und wie er im Mitsein mit anderen und in den Strukturen von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik sein Menschsein verwirklichen will. Diese Grundentscheidung fließt in sein persönliches Verhalten, in seine Motivationen und in seine konkreten Entscheidungen als tragende Grundintention ein und wird in ihnen bestätigt und verstärkt; sie kann aber auch durch schwerwiegende sittliche Fehlentscheidungen zerstört und widerrufen werden.
Ziel der verantwortlichen Freiheitsentscheidung als Antwort auf den sittlichen Anspruch ist das umfassend gelingende Menschsein in der Gemeinschaft der Menschen und in der Gesamtheit der Lebenswelt. Dieses Ziel sollen und können wir bejahen und erstreben, weil wir aus einem tiefen Urvertrauen heraus wissen, daß unser Leben und die Welt, in der wir leben, Sinn haben. Selbstverwirklichung als Verwirklichung von Freiheit empfängt von dieser Sinnvorgabe her ihre sittliche Rechtfertigung, wenn der Mensch diesen Sinn in allen Menschen ohne Ausnahme achtet und so ein Ethos des Mitseins in Mitmenschlichkeit, ein Ethos der Liebe verwirklicht. "Die Liebe ist das größte soziale Gebot. Sie achtet den anderen und dessen Rechte. Sie verlangt gerechtes Handeln, und sie allein macht uns dazu fähig" (KKK 1889)
3. Menschsein in Verantwortung vor Gott
Mit den Erkenntnissen und Einsichten über Freiheit und Sittlichkeit ist aber noch nicht die Antwort auf die Frage nach dem letzten Sinn und Grund von Freiheit und Sittlichkeit gegeben. Philosophen haben immer wieder betont, daß endliche Freiheit und aus Freiheit geschaffenes umfassend gelingendes Menschsein erst in einem tieferen Sinnzusammenhang ihren Urgrund und ihre letzte Erfüllung finden. Sie verteidigen die Eigenständigkeit des Sittlichen und seine Unableitbarkeit von äußeren Bestimmungen und Festlegungen und betonen, daß das Sittliche seinen Grund und seine Rechtfertigung in sich selbst hat. Zugleich verweisen sie aber darauf, daß endliche Freiheit und Verwirklichung von Sittlichkeit auf unendliche Freiheit und auf ein letztes Absolutes, den absoluten Gott als Grund von Freiheit und Sittlichkeit hinweisen. Andere betonen, daß der Mensch in der Gewissenserfahrung, in der Schulderfahrung, in Reue und Umkehr von der absoluten Person Gottes angerufen sei, von der her diese Erfahrungen erst einen letzten Sinn erhalten.
Im christlichen Glauben verstehen wir die Urerfahrung sittlicher Verantwortung grundsätzlich als Verantwortung des Menschen vor Gott. Von Gott als letztem Ursprung und Ziel des Menschen erhält alles sittlich gute Tun einen Sinnzusammenhang, den der Mensch zwar erahnen und grundsätzlich erkennen kann, über den er aber erst aus der Selbstmitteilung Gottes volle Klarheit und Sicherheit gewinnen kann. "Alle noch so reichen und tiefen Antworten auf die Frage nach dem Geheimnis des Menschen bleiben bruchstückhaft, wenn sie den Menschen nicht von diesem seinem letzten Grund und Ziel her verstehen" (KEK 1, 114).
Gott hat sich uns in seiner Offenbarung mitgeteilt. Indem wir ihn in Jesus Christus glaubend als letzten Grund und als Ziel unseres Lebens bejahen, ergibt sich für uns die ethische Grundfrage, was wir tun sollen, so, wie sie der Mann im Evangelium an Jesus richtet: "Guter Meister, was muß ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen?" (Mk 10,17). So stellt sich die ethische Grundfrage für den Glaubenden letztlich als Frage nach dem rechten Mitgehen des Menschen mit Gott, als Frage nach dem Leben aus dem Glauben, in welchem wir zur Freiheit der Kinder Gottes befreit sind (vgl. hierzu besonders KKK 2052-2055; VS 25).
II. Die Antwort in der Bibel
1. Ruf Gottes und Antwort des Menschen im Alten Bund
1.1. Gottes Ruf und des Menschen Verweigerung
Wie andere Völker sucht auch das Volk des Alten Bundes nach sittlichen Einsichten und Orientierungen, deren Befolgung das Leben des Menschen gelingen läßt. Die Erforschung der Geschichte Israels macht deutlich, daß das Gottesvolk wesentliche Einsichten über sittlich richtiges Handeln mit allen Völkern seiner Umwelt teilt. Mehr noch: Manches, was sich im Alten Testament an weisheitlicher Weisung, an sittlicher Botschaft der Propheten, an Geboten und Gesetzen findet, hat Israel von anderen Völkern gelernt und übernommen. Die Weisung des Alten Testaments, daß man nicht morden darf, den Besitz des anderen achten muß, vor Gericht kein falsches Zeugnis gegen seinen Nächsten ablegen darf, daß man die Eltern ehren soll und vieles mehr findet sich in ähnlicher Weise auch bei anderen Völkern; es entspricht der menschlichen Einsicht in richtiges Handeln überhaupt.
Anders als andere Völker sieht Israel jedoch den letzten Grund und Bezugspunkt seiner sittlichen Weisung weder im Menschen selbst noch in einer Welt- oder Götterordnung, sondern im Willen Gottes, der der einzige Gott und zugleich der Schöpfer der Welt und des Menschen ist. Alle "Gebote und Rechtssatzungen" sind darum für Israel Weisungen und Gebote des Herrn, woher ihre Einsichten und Inhalte auch immer stammen mögen. Dadurch ist alles, was recht und gut ist, der Verfügbarkeit durch Menschen entzogen. Was immer an Weisheit der Weltvölker in die ethische Unterweisung Israels eingegangen ist: Als Gebot und Weisung Gottes ist es die "bessere Weisheit Israels", die insofern "besser" ist, als sie nicht mehr nur "Menschenweisheit" ist, sondern Gottes Weisheit. An seine Gesetze und Rechtsvorschriften soll Israel sich halten: "Denn darin besteht eure Weisheit und eure Bildung in den Augen der Völker. Wenn sie dieses Gesetzeswerk kennenlernen, müssen sie sagen: Diese große Nation ist ein weises und gebildetes Volk. Denn welche große Nation hätte Götter, die ihr so nah sind, wie Jahwe, unser Gott, uns nah ist, wo immer wir ihn anrufen? Oder welche große Nation besäße Gesetze und Rechtsvorschriften, die so gerecht sind wie alles in dieser Weisung, die ich euch heute vorlege?" (Dtn 4,6-8).
Wenn darum jemand, der zum Gottesvolk gehört und seine Weisung empfangen hat, sich in seinem Verhalten zur Welt, zu seinem Nächsten und zu sich selbst verfehlt, wird er zugleich schuldig gegenüber seinem Gott: "Gegen dich allein habe ich gesündigt; ich habe getan, was dir mißfällt" (Ps 51,6). Und wenn er daraus in ein gutes und richtiges Verhältnis zur Welt, zum Nächsten und zu sich selbst umkehrt, so kehrt er zugleich zu Gott zurück: "Da sind wir, wir kommen zu dir; denn du bist der Herr, unser Gott" (Jer 3,22).
Wer dieser Gott ist, an den sich Israel in seiner ganzen Existenz gebunden weiß, beantwortet Gott selbst. Er offenbart sich als Gott der Freiheit und Befreiung, der sich liebend seiner Schöpfung zuwendet. Dies ruft er dem Volk immer wieder in Erinnerung, indem er darauf hinweist, daß er ihm seinen Namen geoffenbart habe. Im Namen JAHWE offenbart Gott nicht so sehr sein absolutes Sein als vielmehr seine absolute Freiheit, in welcher er sich in Liebe zum "Dasein für" (Proexistenz) bestimmt. Der weltüberragende Gott wendet sich in Liebe der Welt und den Menschen zu. Aus ihm empfangen sie ihr Dasein, und in ihm sollen sie ihre letzte Fülle finden. In der Offenbarung seines Namens teilt sich Gott dem Menschen mit und gewährt ihm, Gott mit diesem Namen zu rufen und so sein Leben vor Gott zu führen (vgl. Ex 3,13-15).
Die Selbstmitteilung Gottes an Welt und Mensch erreicht ihren Höhepunkt in Jesus Christus. Das letzte Ziel allen Handelns Gottes wird darin bestehen, "daß Gott herrscht über alles und in allem" (1 Kor 15,28).
Die Zuwendung Gottes zum Menschen wird im Alten Testament auf vielfache Weise bezeugt: in der Befreiung aus Ägypten, in den vielen Sprachbildern von Gott und in der im Buch Genesis.
Die Urtat der göttlichen Zuwendung ist die Befreiung Israels aus Ägypten. Jahwe stellt sich dem erwählten Volk so vor:
- "Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus" (Ex 20,2; Dtn 5,6; vgl. Hos 12,10; 13,4; Mi 6,4; Jer 7,22; Ez 20,6).
In Sprachbildern wird die Zuwendung Gottes zu seinem Volk so ausgedrückt: Er ist für sein Volk wie ein Vater (Hos 11,1ff; Jes 1,2; Jer 3,19; 31,20 u.a.), wie eine Mutter (Jes 49,15; 66,13), wie ein Bräutigam (Jes 2,5; 5,1; 54,4-6; Jer 2,2; Ez 16; Hos 2,18-25). Gott ist der "Gute Hirt" seines Volkes (Jes 40,11; Jer 31,10; Ez 34,11-22) und des einzelnen (vgl. Ps 23); er ist der König Israels und der Weltvölker (vgl. Ps 47,5-9; Jes 52,7-10 u.ö.). Das verheißende Bild vom Reich Gottes greift Jesus auf und macht es zum zentralen Punkt seiner Botschaft (Mk 1,14).
In der Schöpfungserzählung wird die Botschaft der Bibel von der Zuwendung Gottes zu Welt und Mensch als die Mitte der biblischen Offenbarung dargestellt. Bevor die Weisungen Gottes dem Menschen sagen, was er tun soll, wird ihm gesagt, was Gott für ihn getan hat. Vor der Verkündigung der Weisung an den Menschen steht im Alten Testament die Verkündigung der Großtaten Gottes für Mensch und Welt. Das rechte Handeln des Menschen ist die Antwort des Menschen auf Gottes Tat und Wort.
Darum muß die Frage, was wir tun sollen, immer von dem ausgehen, wer und was wir sind. In den Schöpfungserzählungen bietet die biblische Gottesoffenbarung in den Vorstellungen der damaligen biblischen Schriftsteller einen tiefen Einblick in die Geschichte Gottes mit dem Menschen. Gott schafft den Menschen, der innerhalb des Kosmos eine zentrale Stellung einnimmt:
- "Gott schuf den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie" (Gen 1,27).
Das ist die grundlegende biblische Aussage über den Menschen. Er ist ein Geschöpf, das in besonderer Weise von Gott her kommt und auf Gott bezogen ist.
Zugleich ist mit dem Begriff "Abbild" oder "Ebenbild" ausgedrückt, daß Gott den Menschen beauftragt, über die Schöpfung zu "herrschen", das heißt, sie in Gottes Namen und in seinem Sinn in gute Obhut zu nehmen:
- "Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land" (Gen 1,26).
Der Ansatzpunkt für die Ebenbildlichkeit ist hier ganz offensichtlich die Personalität des Menschen. Gott redet den Menschen mit "Du" an, und dieser darf Gott mit "Du" anreden. Das schließt von vornherein auch den Dialog mit den Mitmenschen ein, die ja ebenfalls vom Wesen her "Du" Gottes sind. Mit der Personalität ist wurzelhaft nicht nur die wahrnehmende und denkende Vernunft gemeint, sondern auch die Möglichkeit der freien Verfügung über sich selbst (Freiheit). Ihr Sinn ist das freie Ja zum Guten. Das Nein zum Guten ist zwar eine Möglichkeit der Freiheit, aber nicht ihr Sinn und niemals ihre Fülle (vgl. dazu KKK 356-358; KEK 1, 115-120).
Der Weltdienst gehört wesentlich zum Gottesdienst des Menschen (vgl. Gen 1). Dabei ist allerdings ein Zweifaches von großem Gewicht: Zum einen ist das Herrschen des Menschen ein Auftragsdienst. Der Schöpfer räumt seinem Geschöpf Mensch das freie, aber verantwortliche Handeln an seiner Schöpfung ein, jedoch nicht eine vom Schöpfer abgelöste willkürliche Verfügungsgewalt. Zum anderen ist nach biblischem Verständnis das Herrschen immer ein Handeln, das wesenhaft auf Lebensfülle und Heilsein des Beherrschten aus ist (vgl. Jes 9 und 11; Mk 10,43f). Herrschaft ohne Hege ist in biblischer Sicht böse.
Die Gottebenbildlichkeit betrifft gleichermaßen Mann und Frau (Gen 1,27). Es gibt hierin keine Abstufung. Darum widersprechen alle Diskriminierungen der Frau, wie sie die menschliche Kultur- und Zivilisationsgeschichte kennt, dem ursprünglichen Schöpferwillen. Die Gleichrangigkeit und Gleichwertigkeit von Mann und Frau ist und bleibt für Welt und Kirche eine feierliche Lehre der Gottesoffenbarung.
Die Gottebenbildlichkeit des Menschen ist das unzerstörbare Fundament der menschlichen Würde und der menschlichen Existenz- und Lebensrechte. Die Würde des Menschen wurzelt in seiner "Würdigung" durch Gott selbst. Der Mensch verdunkelt zwar durch Mißbrauch seiner Freiheit (in der Entscheidung für das Böse) diese Würde, aber er kann sie in ihrer Wurzel nicht vernichten. So verstanden ist Dienst am Menschen und an seiner Würde zugleich Gottesdienst. So ist die Gottebenbildlichkeit des Menschen der tiefste Grund dafür, daß das Ja zu Gott und das Ja zum Menschen unlösbar miteinander verbunden sind.
Repräsentanten der Menschheit sind nach der zweiten Schöpfungserzählung (Gen 2-3) Adam und Eva. Sie sind die Anrede-Partner Gottes, der bereits hier den Bundesnamen JAHWE trägt. Ihnen ist die Aufgabe zugewiesen, den Garten Eden "zu bebauen und zu hüten" (Gen 2,15). Dieser Garten ist nicht ein "Himmels-Garten", sondern steht für die Welt, die er dem Menschen zugedacht hat. Er ist zugleich ein "Gottes-Garten", in dem Gott dem Menschen gegenwärtig sein will. Der "Garten" ist letztlich ein Bild für die Gnaden- und Heilssphäre, für die der Schöpfer den Menschen geschaffen hat.
Im Garten soll der Mensch als freies Schöpfungswesen leben und zur Fülle des Lebens kommen. Er darf die Früchte aller Bäume essen mit Einschluß des geheimnisvollen "Baumes des Lebens". Nur einer wird ausgenommen: der "Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen" (Gen 2,17). Damit ist gemeint, daß der Mensch bei aller freien Selbstbestimmung nicht versuchen darf, sich selbst an die Stelle Gottes zu setzen und in eigener Verfügungsmacht Gut und Böse aus sich heraus festzulegen. Dieses Verbot Gottes ist wie alle seine Weisungen keine Willkürmaßnahme, sondern dazu gegeben, daß der Mensch nicht in die Macht des Todes gerate. Es ist auch keine bloße Gehorsamsprobe, sondern es stellt den Menschen vor die Entscheidung, in Freiheit das Ja zu Gott und damit das Ja zum Guten zu sprechen und zu leben.
Adam und Eva lassen sich auf die Stimme des Versuchers ein, die ihnen einredet, Gotte gehe es nur um sein eigenes Ich. Hier steht der vertrauende Glaube auf dem Spiel. Die Menschen entscheiden sich für das trügerisch verheißene Glück: Ihr Nein zu Gott führt auch zum Nein gegen sich selbst und gegen den andern. So setzt mit der verfehlten Ich-Bejahung die Sünde sein, in welcher sich der Mensch von Gott abwendet, der sich ihm zugewandt hat. Hierin schlägt die Bibel schon in ihrer "Urgeschichte" das Thema des Glaubens an. Dabei wird klar, daß biblisch "glauben" im Grunde nichts anderes bedeutet als dies: Gott seine heilvolle Zuwendung glauben (vgl. Gen 15,1-6; Jes 7,1-9; 31,1-3).
1.2. Der Bund Gottes mit Israel
Die biblische Urgeschichte (Gen 1-11) zeigt, daß Gottes Gnade und Gericht in der Geschichte des Heils gegenwärtig sind. Der Wille Gottes zum Mitgehen mit den Menschen führt zu einem Bund Gottes mit Noach (Gen 9) und mit allen Völkern der folgenden Zeit. Dieser Bund beinhaltet, daß Gott sich feierlich verpflichtet, künftig die Menschen und die Erde nicht durch eine Flutkatastrophe zu vernichten (Verheißungsbund). Nach dem Scheitern des Versuchs, einen Turm bis zur Himmelswelt zu errichten (Gen 11), erfolgt nach dem göttlichen Strafgericht der Sprachenverwirrung eine Begnadigung der Menschen auf einen neuen Weg hin: Gott beruft den Abraham zum Repräsentanten und Stammvater eines künftigen besonderen Gottesvolkes unter den Völkern. Die Zuwendung zu Abraham (Gen 15) erhält die Form eines Verheißungsbundes für die ganze Menschheit: "Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen" (Gen 12,3).
Die Nachkommenschaft, von der in der Abrahamsgeschichte die Rede ist (Gen 15,5; 21,12; 22,18), ist das Volk Israel. Auf das göttliche Bundesangebot (Ex 19,4-6) erfolgt der feierliche Bundesschluß zwischen Jahwe und Israel durch Mose als Bundesmittler (Ex 24,1-11). "Bund" wird jetzt eine Wirklichkeit. Gott, der Israel aus der ägyptischen Fron in den Raum der Freiheit geführt hat, bindet sich selbst. Auch Israel soll sich frei für immer an ihn binden. Das geschieht im liturgischen Bundesschluß (Ex 24). In der Mitte der kultischen Begehung "nimmt Mose die Urkunde des Bundes und verliest sie vor dem Volk" (Ex 24,7). Das Volk antwortet mit einem Ja, mit welchem es sich an Gott bindet: "Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun; wir wollen gehorchen!" (Ex 24,7). Gottes Wort und des Menschen Antwort bilden so den Kern des Bundesschlusses.
Die Bundesurkunde bzw. Bundescharta sind die "Zehn Gebote" (der Dekalog; vgl. Ex 24,7). Darum redet das Deuteronomium von den "Tafeln des Bundes" (9,9.11.15; vgl. 10,4) und nennt den Dekalog einfachhin "Bund" (4,13). Er beginnt mit der feierlichen göttlichen Selbstvorstellung: "Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus" (Dtn 5,6; Ex 20,2). Zuerst wird also im Dekalog Jahwe als Befreier und Erlösergott verkündet. Darum darf der übliche verkürzte Text "Ich bin der Herr, dein Gott", nicht im Sinne von Gott als einem Gott der Gebote und des Gerichts ausgelegt werden. Es handelt sich vielmehr in der Selbstvorstellung Jahwes um eine Frohbotschaft. Die Befreiung aus Ägypten ist die Grund-Erlösungstat des Bundesgottes und zugleich eine exemplarische Voraus-Tat seines zukünftigen Heilshandelns und somit eine "Real-Verheißung". Erst nach dieser "erinnernden" Selbstoffenbarung des Erlösergottes folgt der Weisungsteil, der als göttliche Wegweisung (Thora) für das "Wandern des Gottesvolkes mit seinem Gott" (vgl. Mi 6,8) verstanden werden will. Die "Zehn Weisungen" geben die Weisen an, wie der Mensch sein Ja zu Gott und zu seinem Bund realisieren muß. Ihre Erfüllung soll eine dankende Antwort des Menschen auf die göttlichen Worte und Taten sein. Ihre Verbotsform (nur das dritte und das vierte Gebot sind positiv formuliert) ist von ihrer Bestimmung her zu erklären; Gott will mit dem Bund eine Sphäre des Heiles markieren. Wer diese Grenze überschreitet, indem er den Bund bricht, fällt damit ins Unheil. Die negative Formulierung schafft gleichzeitig den Raum für die menschliche Freiheit, den Geist des Verbotes in kreativer Weise durch positive Haltungen und Taten zu verwirklichen.
Den "Zehn Weisungen" liegt eine auffällige Doppelstruktur zugrunde. Die ersten drei ("erste mosaische Tafel") sprechen das direkte Verhältnis des Gottesvolkes zu seinem Bundesgott an, die sieben folgenden Weisungen (nach katholischer und lutheranischer Zählung die "zweite mosaische Tafel") beziehen sich auf das gemeinschaftssichernde mitmenschliche Verhalten im Gottesvolk (Gott wird in keinem dieser Gebote genannt). Gottesliebe und Menschenliebe sind schon im Alten Testament unlösbar miteinander verbunden und machen zusammen die doppelte Richtung aus, die für das biblische Verständnis des Glaubens grundlegend ist).
1.3. Glaubensverkündigung und sittliche Botschaft bei den Propheten
Die Propheten sind von Gott "berufene Rufer", um die Gottesoffenbarung im Gottesvolk immer von neuem durchzusetzen. Wenn sie auch den Dekalog als solchen kaum ausdrücklich ansprechen (vgl. aber Hos 4,1ff und Jer 7,9), so begegnen doch dessen Weisungen und Grundanliegen beständig in ihren Schriften. Sie bilden jeweils den Maßstab ihrer Anklagen und Appelle.
Die Propheten müssen in ihrer Zeit zumeist um die Durchsetzung des ersten Gebotes kämpfen. Dabei richten sie sich auch gegen die Bilderverehrung. Doch verstehen vor allem Jesaja und Hosea diese Grundweisung auch so, daß die Bundestreue gegenüber Gott auch dann gebrochen wird, wenn man im Gottesvolk auf irdische Macht oder auf politische Großmächte baut statt auf die Allmacht Gottes (vgl. Jes 7; 31,1-3; Hos 7,8-16; 12,1f; 14,4). Zum ersten Gebot gehört somit für die Propheten auch das Thema des Glaubens und des Vertrauens auf Gott allein.
Als gleichrangig mit der ersten mosaischen Tafel gilt im prophetischen Schrifttum die zweite mosaische Tafel. So tritt schon der Prophet Natan (um 1000 v. Chr.) gegen König David auf, weil er die Frau des Hethiters Urija zum Ehebruch verführte und ihren Mann heimtückisch zu Tode kommen ließ (2 Sam 12). Elija (um 850) bekämpft nicht nur den Abfall zum Baal, sondern belegt ebenso das Verbrechen des Königspaares am Freibauern Nabot und seiner Familie (Begehren fremden Eigentums, Anstiftung zum Meineid, Justizmord, Aneignung der Güter des Ermordeten) mit einem schweren Strafurteil (1 Kön 21).
Die Schriftpropheten bieten beeindruckende Zeugnisse dafür, daß Gott das mitmenschliche Ethos besonders am Herzen liegt. So sieht Amos (um 760 v. Chr.), der erste der Schriftpropheten, seinen Hauptauftrag im Einsatz für "Recht und Gerechtigkeit" im Gottesvolk. Nach Amos holt sich das Gottesvolk am "Zertreten des Menschen" (2,7; 8,4) den Tod. Aber auch die Völkerwelt wird wegen Unmenschlichkeit ins göttliche Strafgericht gestellt (1,3; 2,3). Hosea (ab 750) ruft Israel das Gotteswort ins Gedächtnis: "Liebe will ich, nicht Schlachtopfer, Gotteserkenntnis statt Brandopfer" (6,6). Mangel an Gotteserkenntnis wird so umschrieben: "Fluch und Betrug, Mord, Diebstahl, Ehebruch" (4,2). Nach Jesaja (ab 740 v. Chr.) ist Jerusalem Sodom und Gomorra (1,10), weil keine mitmenschliche Gerechtigkeit mehr in der Stadt ist. Im Weinberglied (Jes 5) verwirft Gott seinen Weinberg Israel/Juda, weil er statt "Trauben" (Recht und Gerechtigkeit) nur "Stinklinge" (Gewalttat und Unrecht) dein hervorbrachte. Jeremia (ab 625 v. Chr.) sieht den Bundesbruch im Stehlen, Morden, Ehebrechen, meineidigen Schwören und in der Baalsverehrung offen zutage treten (vgl. 7,9).
In Israel hat sich häufig die Überzeugung gezeigt, daß der "Gottesdienst" im engeren Sinne das Primäre der Religion sei, der Dienst am Menschen dagegen das Sekundäre. Dieser Einschätzung treten alle Propheten entgegen. Das Recht-Tun gilt als Voraussetzung für den Kult (Jes 1,10ff). Am eindrucksvollsten geschieht das bei Micha, der den zu unerhörten kultischen Opfern bereiten Hörern das Wort entgegenruft: "Es ist dir verkündet worden, was gut ist und der Herr von dir erwartet: Nichts anderes als dies: Recht tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott" (6,8). Hier ist die Willensoffenbarung Gottes, wie sie Mose, Natan, Elija, Amos, Hosea und Jesaja verkündet haben, auf eine einfache Kurzformel gebracht. Nur wer so handelt, ist Bundespartner Gottes und handelt damit sittlich gut. Ob einer unsittlich bzw. unmoralisch handelt, entscheidet sich also vor allem daran, ob Menschen andere Menschen zu Mitteln ihres Macht-, Erwerbs- und Genußstrebens degradieren (vgl. Am 2,6-8).
1.4. Die messianischen Verheißungen von Recht und Gerechtigkeit in der kommenden Königsherrschaft
Der Glaube Israels ist zukunftsbezogen. Die Deutung des Gottesnamens "Ich bin da" (Ex 3,14) läßt sich zugleich auf die Zukunft hin formulieren: "Ich werde da sein." Ebenso weisen auch die "Sprachbilder" der Zuwendung Jahwes auf ihre volle Erfüllung hin. Das gilt besonders für die Botschaft: "Jahwe ist König." Als solcher wird er für immer dem Chaos der Geschichte ein Ende machen (vgl. Jes 52,7-10; Ps 96,10-13; Ps 98,4-9).
In der Linie der Natansverheißung an David (2 Sam 7) erwarten die Propheten einen endzeitlichen Heilbringer-König. Nach Ezechiel (34,23f) wird er ein "neuer David" sein, ein wahrer Hirte für sein Volk. Bei Jesaja (9,1ff) wird dem königlichen Heilbringer eine Hoheit und Macht zugesprochen, die eigentlich Gott zukommt. Er wird "Frieden ohne Ende" schaffen und unter den Menschen endgültig "Recht und Gerechtigkeit" aufrichten (Jes 9,6). Diese messianische Heilsfunktion tritt noch deutlicher zutage in der Aussage, daß der zukünftige König von Gott mit der Fülle des Geistes und seiner Gaben ausgestattet wird, damit er der Rechtshelfer der Armen und der Schwachen sei (Jes 11,1-5). Seine mitmenschliche Gerechtigkeit wird zum "Gürtel um seine Hüften" (11,5). Die Königsmacht und das Charisma der Weisheit ist ihm gegeben, daß er das Gottesrecht durchsetze, so daß in seinem Reich alle Menschen wahrhaft Mensch sein können.
Die Heilbringergestalt der "Gottesknechtlieder" (Jes 42,1-4; 49,1-6; 50,4-9; 52,13 - 53,12) weist nur in Ansätzen königliche Züge auf. Der Jahwe-Knecht gleicht eher einem Propheten und zugleich einem Weisheitslehrer besonderer Art. In ihm und durch ihn gelingt endlich auf vollkommene Weise der Bund Gottes mit den Menschen: "Ich habe dich geschaffen und dazu bestimmt, der Bund für mein Volk und das Licht für die Völker zu sein" (Jes 42,6; vgl. auch 49,6). Darum bringt er auch den Völkern das Gottesrecht (42,1). Verfolgt und anscheinend scheiternd, gibt er sein Leben dem Tod preis, trägt die Sünden der Vielen und tritt für die Schuldigen ein (53,12). Diese sich hinopfernde Menschenliebe ist der Grund dafür, daß Gott seinen Knecht dem Reich des Todes entreißt und ihn auf die höchste Höhe des Lebens stellt, damit er das Haupt "der Vielen" sei.
Diese wenigen Texte über die messianische Verheißung machen offenbar, was der Gott des Bundes vom menschlichen Bundespartner erwartet, nicht zuerst um seinetwillen, sondern um des Menschen und seines Heiles willen. Hier wird die Wahrheit jenes Wortes deutlich, das der Bischof Irenäus von Lyon (+ um 202) geprägt hat: "Gottes Glorie ist der lebendige Mensch, das Leben des Menschen aber ist die Anschauung Gottes" (Adv. haer. IV, 20,7).
1.5. Die Mahnung der Weisheitslehre des Alten Bundes zu einem guten Leben.
Israel rechnet nicht nur den Priester mit seiner Weisung und den Propheten mit seinem Wort zu den bevollmächtigten Lehrern des Volkes, sondern auch den Weisen mit seinem Rat, das heißt mit seiner erzieherischen Mahnung (vgl. Jer 8,8). Auch das reiche Weisheitsschrifttum ist Teil der biblischen Gottesoffenbarung.
Die Grundfrage allen weisheitlichen Bemühens lautet: "Wie kann das konkrete menschliche Leben vor Gott und der Welt gut werden und damit am besten gelingen?" Diese Frage bewegt die Menschen aller antiken Kulturen. Man versuchte, sie mit Hilfe der Vernunft und der Erfahrung zu beantworten. Der wohl früheste Ausdruck solcher weisheitlicher Lebenserfahrung ist das Sprichwort. So ist es nicht verwunderlich, daß im "Buch der Sprichwörter" sich ein Abschnitt findet (22,17 - 23,12), der sich eng an das ägyptische Weisheitsbuch der Amenemope (um 1000 v. Chr.) anlehnt.
Das Buch Jesus Sirach stellt bei aller Übernahme älteren Weisheitsgutes die Thora Gottes als Inbegriff aller Weisheit vor Augen. Auch das Buch der Weisheit Salomos (1. Jh. v. Chr.) hält diese Position, obwohl es dem griechischen Denken und Sprechen einen breiten Raum einräumt. Die Weisheitsbücher Ijob und Kohelet bringen in unterschiedlicher Weise tiefe Gedanken über den Menschen angesichts seines Leidens und der Leiden in der Welt in die Weisheitslehre Israels ein und brechen auf diesem Gebiet verfestigte Positionen der Tradition auf. In alledem wird deutlich: Jahwe selbst ist in seiner Willensoffenbarung der wahre und der beste Weisheitslehrer Israels.
Die Weisheit wird nicht nur als Kulturgut geschätzt, sondern auch als eine natürliche Eigenschaft des Menschen, die durch Erfahrung erworben und durch Erziehung vermittelt wird (Sir 9,17). Sie ist aber auch Gabe Gottes, die einzelnen Menschen aus Gnade mitgeteilt wird (Ijob 28,12-17). Als weise gilt, wer Menschenkenntnis, gesunden Verstand und Lebensklugheit besitzt. Ziel des weisen Handelns ist ein ungestörtes individuelles Lebensglück, das durch den Vollzug des erfahrungsgemäßen und klugen Verhaltens unmittelbar verwirklicht wird (Spr 10,4-17). Wo das Gesetz Jahwes Norm weisen Handelns ist, gilt der Sünder als Tor, der Gerechte aber als weise und klug (Ps 14,1). Die Weisheit führt zur Glückseligkeit, zumal der Weise sich ganz bewußt als ein Geschöpf Gottes und als ein Mitglied des von Gott auserwählten Volkes verhält.
Faßt man die Fülle der Aussagen des Alten Testaments zur Frage nach dem Menschen, nach seiner Würde, nach seiner Freiheit, nach seiner sittlichen Bindung und letzten Sinngründung zusammen, so wird deutlich, daß man dem Menschen nur gerecht werden kann, wenn man ihn von seiner Gottesbeziehung her sieht. In ihr gründet die hohe Würde der menschlichen Person, ihre herrscherliche Freiheit, ihre Gleichrangigkeit als Mann und Frau und ihr sittlicher Auftrag, im Mitgehen mit Gott die Weisungen der "Urkunde des Bundes" als Geschenk des liebenden Gottes anzunehmen und sich von ihnen leiten zu lassen. In der Praxis des Glaubens wird das sittliche Handeln und Verhalten zum Zeichen der Bewährung des Glaubens, der Liebe und des Vertrauens darauf, daß die verheißene Zukunft des Heils nicht durch menschliche Leistung errungen werden muß, sondern im Mitgehen mit Gott von der endgültigen Zuwendung Gottes im "endzeitlichen Bund" erwartet werden darf.
2. Heilsverkündigung und sittliche Botschaft im Neuen Bund
2.1. Der Ruf Jesu und die Antwort des Menschen
Die sittliche Botschaft Jesu läßt sich ohne die Geschichte und die Erfahrungen Israels in seinem Bund mit Gott nicht begreifen. Wie Gott im Sinai-Bund vom Volk die Antwort der Treue zu ihm und der sittlichen Bewährung in der Welt erwartet, so verkündet auch Jesus den barmherzigen Gott, der von den Menschen eine entsprechende Haltung, vor allem Barmherzigkeit verlangt. Den Dekalog als Grundcharta des sittlichen Tuns setzt Jesus voraus (Mk 10,19) und baut auf ihm seine sittlichen Weisungen auf (vgl. Mt 5,21-48). Aber sein sittlicher Anruf erlangt durch die von ihm verkündete Gottesherrschaft eine neue Begründung, verpflichtende Kraft und letzte Gültigkeit. Jesus führt das bisher Verkündigte in einem neuen Horizont auf eine letzte Höhe (vgl. Mt 5,17). Ohne der gläubige Annahme seiner Botschaft ist sein weitreichendes und tiefgreifendes Ethos nicht zu verstehen, geschweige denn zu verwirklichen.
Diese neue Botschaft Jesu faßt Markus in die markanten Sätze zusammen:
"Erfüllt ist die Zeit und nahe herbeigekommen die Gottesherrschaft. Kehrt um und glaubt an das Evangelium!" (1,15).
Das ist eine Proklamation und ein Mahnruf, die Bekanntmachung eines göttlichen Geschehens und die Forderung einer menschlichen Antwort. Jesus sagt bei seinem Auftreten den Menschen eine bedeutsame Stunde an: Jetzt ist die Zeit der "Erfüllung" gekommen. Ihr geht eine "Verheißung" voraus, nämlich die prophetische Verheißung der künftigen Heilszeit. In ihr sieht Jesaja das Volk in einem neuen Exodus aus der Gefangenschaft heimkehren und läßt ihm einen Freudenboten vorauseilen:
- "Wie willkommen sind auf den Bergen die Schritte des Freudenboten, der Frieden ankündigt, der eine frohe Botschaft bringt und Rettung verheißt, der zu Zion sagt: Dein Gott ist König" (Jes 52,7).
Das ist das "Evangelium", die "frohe Botschaft" von Gottes befreiender Herrschaft, die mit dem Kommen Jesu hereinbricht und in seinem Wirken aufgerichtet wird.
- "Geht und berichtet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt: Blinde sehen wieder, Lahme gehen, und Aussätzige werden rein; Taube hören, Tote stehen auf, und den Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt!" (Lk 7,22f).
Jesus predigt für die "Armen", seine Heilungen und Dämonenaustreibungen (Lk 11,20) sind Anzeichen dafür, daß die Gottesherrschaft im Durchbruch und schon gegenwärtig ist, aber sie wird erst am Ende der Zeiten vollendet. Deswegen sollen wir beten: "Dein Reich komme!"
Die Herrschaft Gottes ist Befreiung, nicht Unterdrückung, bringt Vereinigung, nicht Trennung, setzt andere als die unter Menschen üblichen Maßstäbe. Das wird in Jesu Wort und Beispiel sichtbar. Er hilft und heilt, hat Geduld mit den Sündern und vergibt ihnen. So macht er die Barmherzigkeit Gottes anschaulich und erfahrbar.
Jesus selbst ist in seiner Person die den Menschen zugewandte Liebe Gottes und zugleich der Ruf Gottes an die Menschen zu gleicher Liebe. Der in der "Fülle der der Zeit" gesandte Sohn Gottes (Gal 4,4) ist in die geschichtlichen Bedingungen menschlicher Existenz eingegangen und hat sich ihnen unterworfen. Sein Erbarmen mit dem Volk (Mk 6,34; 8,2 u. par.) gilt besonders den Verachteten und Benachteiligten, den Sündern, den Armen und den Notleidenden. "Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken" (Mk 2,17). Diese "Option für die Armen" ist als Ausdruck des Willens Gottes, die Verlorenen zu retten, für alle Zeiten gültig.
Wie die Herrschaft Gottes mit Jesus in die Geschichte einbricht, so soll sie sich weiter in ihr durchsetzen. Jesus wendet sich zunächst an das alte Gottesvolk Israel, an die "verlorenen Schafe des Hauses Israel" (Mt 10,6). Aus ihm will er die an seine Botschaft Glaubenden sammeln, um die heilige Gottesgemeinde der Endzeit zu bilden. Als sich dagegen Widerstände kundtun, die letztlich zum Kreuzestod Jesu führen, nimmt er die Botschaft nicht zurück, sondern verdeutlicht, daß dennoch Gott sein Reich herbeiführen wird (vgl. Mk 14,25).
Mit dem Kreuzestod Jesu und seiner Auferweckung eröffnet Gott die neue Heilsmöglichkeit. Jesu Sterben "für viele" (Mk 14,24 u. par.), das heißt für die Erlösung aller Menschen, wird in der Auferweckung des Gekreuzigten zu einem Weg, Gottes befreiende Herrschaft für die ganze Menschheit aufzurichten. Die Kirche Jesu Christi soll der Ort werden, an dem die "Kräfte der kommenden Welt" (Hebr 6,5) wirksam werden und die Welt erfassen.
Diese befreiende Herrschaft Gottes fordert zu sittlichem Handeln heraus. Der Mensch erfährt diese Forderung in der Spannung zwischen Wirklichkeit und Verheißung, zwischen Gegenwart und Zukunft. Gottes gegenwärtiges Heilshandeln in Jesus Christus verlangt von den Hörern, daß sie seinen Willen erkennen, ihn sich zu eigen machen und alles tun, damit sich die Herrschaft Gottes verwirkliche. Somit fordert die Herrschaft Gottes die Menschen zur eigenen Entscheidung und zum Handeln in dieser Zeit, in den jetzigen Weltverhältnissen heraus. Sie zwingt sich den Menschen nicht auf, nimmt ihnen Anstrengung und Bemühen nicht ab. Alle werden aufgerufen, zu allen Menschen barmherzig zu sein, wie sie jetzt Gottes der Barmherzigkeit erfahren (Lk 6,36). Das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht (Mt 18,23-35) zeigt, was Gott von den Menschen erwartet, denen er ihre Schuld vergeben hat. Das Hauptgebot, das neben die Gottesliebe mit gleichem Gewicht die Nächstenliebe stellt (Mt 22,37-40; Mk 12,29-31), will so verstanden sein, daß sich die Gottesliebe in der Nächstenliebe erweist und bewährt. Wie weit diese Liebe gehen soll, verdeutlicht das Gebot der Feindesliebe (Mt 5,43-48). Im Gericht des Menschensohnes werden allein diejenigen bestehen, die den Hungernden und Dürstenden, den Kranken und Gefangenen geholfen haben (Mt 25,31-46). Der Grund für die von Gott geforderte Menschenliebe lautet: "Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht" (1 Joh 4,20).
Die Forderung der freien Entscheidung geht auch aus den Drohworten hervor, die Jesus gegen jene richtet, die sich seiner Botschaft verschließen. Jesus hat harte Worte gefunden gegen die galiläischen Städte, die viele seiner Taten sahen und dennoch nicht umkehrten (Mt 10,20-24). Öfter hat er "dieses böse und treulose Geschlecht" getadelt, um das er vergeblich warb (Mt 12,39; 16,4; Mk 9,19). Ortschaften, die sich der Frohbotschaft verschließen, wird es im Gericht schlimmer ergehen als Sodom (Lk 10,12). Auf der anderen Seite gibt es leuchtende Beispiele von Menschen, die Jesu Wort aufnehmen und ihr Leben ändern: der Zöllner Levi (Lk 19,1-9) und nicht zuletzt die mit Jesus besonders eng verbundenen Jünger, die Haus und Familie verlassen haben und sein Wanderleben in Armut teilen (vgl. Mk 10,28-30).
Das Kommen der Gottesherrschaft berechtigt nicht dazu, die Änderung der Weltverhältnisse tatenlos Gott zu überlassen. Der Ausblick auf die künftige Neuschöpfung durch Gott, in der alles Leid, alle Not und alle Trauer überwunden sein werden (Offb 21,3-5), soll ein ständiger Antrieb sein, die Weisungen Jesu für das Leben in der Welt in die Tat umzusetzen. Das scheinbar Utopische ist eine gewaltige Zugkraft, weil Gott mit seiner Zusage dahintersteht. Aus der gegenwärtig erfahrenen Hilfe Gottes erwächst ein unerschütterliches Vertrauen darauf, daß Gott seine Herrschaft vollenden wird. Das lehrt uns auch das "Vater unser", in welchem wir Gottes Hilfe für die Gegenwart und das Kommen seines Reiches für die Zukunft erbitten und uns zugleich unserer eigenen Verpflichtungen bewußt sind.
2.2. Umkehr, Glaube und Nachfolge
Die grundlegenden Forderungen Jesu sind Umkehr, Glaube und Nachfolge (vgl. Mk 1,15; 3,13-16; Joh 8,12 u. a.). Umkehr setzt Glauben voraus, und im Glauben erfolgt eine Umkehr. Glaube und Umkehr verlangen eine Neuorientierung des ganzen Lebens gemäß den sittlichen Forderungen Jesu. Die Umkehrpredigt des Täufers Johannes, der mit dem Zorngericht Gottes droht, ergänzt Jesus in entscheidender Weise. Als erstes verkündet er die Gnadenherrschaft Gottes und fordert ein vorbehaltloses Vertrauen auf das von ihm verkündete Evangelium.
Unter Glauben versteht Jesus ein Sich-Einlassen auf die in ihm und seinem Wirken erfahrbare Gegenwart Gottes. Es ist weniger ein Ergreifen als ein Sich-ergreifen-Lassen von Gottes Nähe und Macht. Darum begnügt sich Jesus bei den Heilungen mit dem Vertrauen zu ihm und zu der in ihm wirksamen Kraft Gottes (Mk 5,25-34). Er lobt den Glauben des heidnischen Hauptmanns (Mt 8,10) und tadelt das mangelnde Vertrauen seiner Jünger (Mk 4,40f; 8,17f). Die Kraft des Glaubens vermag mit Gottes Hilfe "Berge zu versetzen" (Mk 11,22f). Mit solchem lebendigen Glauben ist immer auch das Bekenntnis verbunden, daß man zu Recht auf Jesus vertrauen kann. Auf dieser Grundlage konnte bei den Jüngern und in der Urgemeinde das Bekenntnis zu Jesus, dem Messias und Sohn Gottes, erwachsen (Bekenntnisglaube).
Der Glaube verwirklicht sich in der Nachfolge, zu der Jesus einzelne Menschen und die ganze Menschheit ruft. Er beruft Jünger zu Begleitern und Boten bei seiner Verkündigung der Gottesherrschaft (Mk 3,13-16; 6,7-13), stellt harte Forderungen an sie (Lk 9,57-62; Mt 8,19-22) und bildet mit ihnen eine Lebens- und Schicksalsgemeinschaft.
Diejenigen, die Jesus in seine engere Nachfolge berufen hatte, behielten nach seinem Tod und seiner Auferstehung ihre besondere Bedeutung als Zeugen seines irdischen Lebens und seiner Auferstehung. Aber weil Jesu Ruf sich an alle richtet, bezog die Kirche nach Ostern das Jüngertum Jesu auf alle ihre Glieder. Nachfolgen wird ein Ausdruck für den Glauben an Jesus Christus (Joh 8,12).
Lebendiger Glaube drängt zur Bewährung in der Tat, zum Tun in der Liebe. "Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr!, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt" (Mt 7,21). So gehört zum Glauben die Liebe.
In den Evangelien sind die Worte, die an einzelne oder an alle gerichtet sind, nicht immer klar zu unterscheiden. Die Aufforderung zur Kreuzesnachfolge (Mk 8,34), zur Absage an den versklavenden Reichtum (Mk 10,42-45) ist allen zugesprochen. Jesu Wort an den reichen jungen Mann dagegen ist ein konkreter Nachfolgeruf an einen einzelnen (Mk 10,21).
Auch nach Ostern gibt es Berufungen, die über das Maß des allgemein Verbindlichen hinausgehen. Diese besonderen Rufe haben in der Kirche zur Lebensform der "Evangelischen Räte" geführt. Freiwillige Armut, ehelose Keuschheit und vollkommener Gehorsam sind besondere Weisen, den Ruf Gottes zur Nachfolge zu verwirklichen. Jesus
2.3. Die Seligpreisungen und die "radikalen" Forderungen Jesu
Mit der Verkündigung des schon angebrochenen, aber noch nicht vollendeten Reiches Gottes verbindet Jesus in der Bergpredigt die Seligpreisungen. Sie "stehen im Herzen der Predigt Jesu. Sie nehmen die Verheißungen wieder auf, die dem auserwählten Volk seit Abraham gemacht wurden. Die Seligpreisungen vollenden die Verheißungen, indem sie diese nicht mehr bloß auf den Besitz des Landes, sondern auf das Himmelreich Jesus ausrichten" (KKK 1716). "Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich.
Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden.
Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden das Land erben.
Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie werden satt werden.
Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden.
Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott schauen.
Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne Gottes genannt werden.
Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihnen gehört das Himmelreich.
Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt: Euer Lohn im Himmel wird groß sein" (Mt 5,3-11).
Jesu Botschaft von der nahegekommenen Gottesherrschaft gilt allen Menschen, sie grenzt niemanden aus. Dennoch hat sie ihre bevorzugten Adressaten unter den "Armen". Sie sind schon im Alten Testament die besonderen Schutzbefohlenen Gottes. Sie sind dadurch ausgezeichnet, daß sie vorbehaltlos die Erhaltung ihres Lebens und ihre Rettung vor dem Untergang von Gott erwarten. Ihre Grundhaltung ist Vertrauen und Hingabe an Gott, "den Vater der Waisen und Witwen" (Ps 68,6), den Helfer der Armen (Jak 2,5).
Jesus greift diese Erwartung auf und bezieht sie auf alle Menschen. Die Güter des Himmelreiches sind und bleiben den "Armen" zugesagt. Aber arm ist der einzelne nicht einfach aufgrund seines Schicksals; auch die schicksalhafte Armut muß und kann gewendet werden zur Einsicht in die wahre Bedürftigkeit und zur Aussicht auf die Güter des Himmelreiches. Diese Armut, in Mt 5,3 als "Armut vor Gott" bezeichnet, wird zur Einlaßbedingung für alle, die berufen sind, in das von Jesus verheißene Himmelreich einzugehen. Daher gilt auch für uns: Die Armut vor Gott ist unsere eigentliche Chance.
Die Seligpreisung der Armen wie auch die folgenden Seligpreisungen Jesu wecken Hoffnung bei den Betroffenen; sie lassen sie nicht nur ausschauen auf die verheißenen Güter, sondern sie bewegen sie Jesus schon in der Gegenwart und beflügeln sie zu einer aktiven Nachfolge Jesu. Den "Trauernden" teilt sich der verheißene Trost nicht erst am Ende, sondern auch jetzt schon lösend und erlösend mit. Jesu Verkündigung bewirkt auch, daß die Menschen sich ändern und wahrnehmen, daß nicht den Gewalttätigen, sondern den "Sanftmütigen" (die keine Gewalt anwenden) das Land der Verheißung zufallen wird. Die Zukunft greift schon in die Gegenwart vor. Die Gegenwart ist nicht nur die Zeit des "Hungerns und Dürstens", sondern auch schon die Zeit Gottes, in der er seine "Gerechtigkeit" aufrichtet und gegen alle Ungerechtigkeit der Menschen wirken läßt.
Mit der Seligpreisung der "Barmherzigen" beginnt eine zweite Strophe der Bergpredigt. In ihr zeigt sich noch stärker als in der ersten Strophe das aktive Moment der Nachfolge, das Jesus bei seinen Hörern herausfordert. Im Indikativ der Anrede an die "Barmherzigen", an die, die "ein reines Herz" haben, an die "Friedensstifter" und die, die um der Nachfolge willen "verfolgt werden", ist unüberhörbar ein Imperativ angelegt, wodurch der Bewährung der genannten Grundeinstellungen ein besonderes Gewicht zukommt. Christen bewähren sich dadurch, daß sie unter dem Eindruck der verheißenen und mit Jesus schon nahegekommenen Gottesherrschaft die bestehenden Nöte und Aufgaben der Zeit nicht übersehen, sondern annehmen und aller Versuchung der Verharmlosung oder der Resignation widerstehen.
Die "radikalen" Forderungen der Bergpredigt sind im Rahmen der Reich-Gottes-Predigt zu verstehen. Das bisherige, in Israel geltende sittliche Gesetz soll nicht abgeschafft, sondern in höchster Weise erfüllt werden (Mt 5,17). Es ist kein Sittengesetz für wenige Berufene, sondern verbindliche Weisung für alle, die nach der Gottesherrschaft streben. Sie sollen den Willen Gottes, wie Jesus ihn verkündet, bis zum äußersten erfüllen. Die Antithesen (Mt 5,20-48) sollen aufzeigen, wie die Gottes- und Nächstenliebe ohne Vorbehalt zu üben ist. "Ihr habt gehört, daß gesagt worden ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen . . ." (Mt 5,43f). Das Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe ist eine Zusammenfassung der in der Bergpredigt geforderten Sittlichkeit. Die Goldene Regel "Was ihr von anderen erwartet, das tut ebenso auch ihnen" (Lk 6,31; vgl. Mt 7,12) ist ein praktischer Wegweiser zur Erfüllung der Nächstenliebe, weil sie jedem aus seiner natürlichen Selbstliebe heraus sagt, was er tun soll.
Die "radikalen" Forderungen Jesu greifen bis an den Grund des Herzens (Mt 5,28; 6,20f.24) und rufen den Menschen zu höchster Großmut auf (Feindesliebe), derer er fähig ist. Sie verlangen nicht nur lauterste Gesinnung, sondern zugleich Verwirklichung im Tun. Sie betreffen zuerst die Jüngergemeinschaft (die Kirche), deren Ethos sich jedoch auf die ganze menschliche Gesellschaft auswirken muß. Den Jüngern Christi ist eine Verantwortung für das Wohl aller Menschen und für die Entwicklung des Gemeinwohls der Gesellschaft aufgetragen.
Die Auslegung der Bergpredigt durch die Jahrhunderte zeigt, wie schwierig es ist, die Weisungen Jesu auf die konkreten Weltverhältnisse anzuwenden. Sie hat immer wieder zu Abschwächungen der Forderungen Jesu wie zu schwärmerischer Utopie geführt. Gegenüber diesen Extremen will Jesus unter dem Leitbild der Gottesherrschaft die Herzen herausfordern, um die Welt ihrem eigentlichen Ziel näherzubringen. So bleibt die Bergpredigt eine immer neu zu bewältigende Aufgabe und eine dauernde Herausforderung.
Inhaltlich können die radikalen Forderungen Jesu auch Menschen nahegebracht werden, die den christlichen Glauben nicht teilen, aber nach einer "humanen" Ethik streben, die das wahre Wohl aller Menschen erreichen will. Letztlich wird das, was bloß menschliche Maße übersteigt, allein dem Maß des Menschen gerecht. Insofern ist das, was Jesus seiner Jüngergemeinde aufgetragen hat, auch für die ganze menschliche Gesellschaft bedeutsam. Eine vernunftgemäße Ethik vermag vor falschen Folgerungen für das Verhalten in der Welt zu bewahren und von den grundsätzlichen Weisungen Jesu zu praktikablen Handlungsformen zu führen. Doch muß sie sich davor hüten, die radikalen Forderungen Jesu abzuschwächen und ihnen ihre Kraft, die zu Höchsttaten der Liebe treibt, zu nehmen. Das ist eine nie vollkommen zu lösende Aufgabe. Das Bemühen, die Herausforderungen Jesu in der Welt in Taten umzusetzen, bleibt ein nie endender Prozeß.
Jesus hat in seine Verkündigung auch "weisheitliche" Motive aufgenommen, so beim Gebot der Feindesliebe: Gott läßt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten, und er läßt regnen über Gerechte und Ungerechte (Mt 5,45), oder bei der Mahnung, nicht ängstlich zu sorgen, durch den Hinweis auf die Vögel des Himmels und die Blumen des Feldes (Mt 6,26-30). Aber diese Motive, die an die Einsicht des Menschen appellieren, stehen nicht unverbunden neben seiner Reich-Gottes-Predigt, sondern dienen dazu, die Hörer zur Annahme seiner Botschaft und Forderung zu bewegen: "Seid vollkommen, wie auch euer himmlischer Vater vollkommen ist" (Mt 5,48); "sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit" (6,33). Jesu radikale Forderungen sind menschlicher Einsicht nicht unzugänglich, aber sie bleiben für die meisten Menschen "anstößige" Zumutung.
2.4. Die Aufnahme des Ethos Jesu in der Kirche
In den urchristlichen Gemeinden machen sich die Christen die sittlichen Forderungen Jesu zu eigen und bemühen sich um ihre Anwendung auf den konkreten Lebensvollzug. Schon in der Überlieferung der Botschaft Jesu in der Auswahl und Wiedergabe der von ihm überlieferten Worte und Verhaltensweisen zeigt sich die Bindung der Urkirche an den Willen und die Weisung ihres Herrn. Jesus Christus ist für sie die höchste und unangefochtene Autorität, weil er wie einer lehrt, der "(göttliche) Vollmacht hat" (Mk 1,22; Mt 7,28f). Diese Überzeugung wird nach Ostern durch die Worte des auferstandenen Herrn an seine Jünger gestützt (vgl. Mt 28,18). Er gibt ihnen den Auftrag, "alles zu lehren, was ich euch aufgetragen habe" (Mt 28,18). Mit der Verkündigung des Evangeliums verbindet sich der Auftrag zur sittlichen Belehrung. Dabei steht die Autorität Jesu absolut über der Gemeinde der Gläubigen: "Einer ist euer Meister, ihr alle aber seid Brüder" (Mt 23,8).
Die prägende Kraft des Ethos Jesu wird am deutlichsten daran erkennbar, daß die frühen Gemeinden trotz aller Unterschiede einhellig das Liebesgebot als höchsten Auftrag bezeugen. Für Paulus ist es die Zusammenfassung und Erfüllung des "ganzen Gesetzes" (Gal 5,14; Röm 13,8-10), das "Gesetz Christi" schlechthin (Gal 6,2), das nicht gesetzlich versklavt, sondern befreit. Die Urgemeinde in Jerusalem bemüht sich um eine Gemeinschaft, in der es keine Bedürftigen geben (Gütergemeinschaft) und der Geist der Eintracht herrschen soll (Apg 2,42.44.46; 4,32). In den Gemeinden des paulinischen Missionsgebietes klingt die Mahnung zur Liebe als das Wichtigste und spezifisch Christliche immer wieder auf (1 Thess 4,9f; Phil 1,9f; Kol 3,12-14; Eph 4,32; 5,2 u. a.). Im juden-christlichen Raum ist die Liebe das "königliche Gesetz" (Jak 2,8), und das Evangelium ist das "Gesetz der Freiheit" (Jak 1,25; 2,12).
Allerdings haben die urchristlichen Verkündiger auch sittliche Vorstellungen und Ausdrucksformen aus der Gesellschaft aufgenommen, wenn sie mit der Botschaft Jesu vereinbar waren. Manches davon ist durch zeitgeschichtliche Wertungen bedingt, die keine absolute Gültigkeit beanspruchen können. Die soziale Stellung der Frauen, der Kinder, der Sklaven, die Gestaltung des Ehe- und Familienlebens setzen die damaligen gesellschaftlichen Strukturen voraus, eine noch patriarchalische Ordnung, die heute mit Recht, in Übereinstimmung mit der Botschaft Jesu, überholt ist. Ähnliches gilt für die Ausübung der staatlichen Gewalt, die in einem demokratischen Staat anders aussieht und anders ausgeübt wird als im damaligen Römischen Reich. Aber was Paulus den Römern sagt, gilt auch weiterhin: "Wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist: was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist" (Röm 12,2). So ist der Christ auch in seiner vom Glauben erleuchteten Vernunft gefordert, die sich jeweils ergebenden Wertungen zu prüfen und das sittlich Richtige festzustellen. Das verbindet die Kirche mit dem sittlichen Erkennen und Streben der ganzen Menschheit (vgl. Phil 4,8).
Wie Jesus das sittliche Tun auf Gottes gnädiges Handeln gründete, wußte sich die Urkirche durch den in der Taufe verliehenen Heiligen Geist getragen. "Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist" (Röm 5,5). Was menschliche Schwäche nicht zu erreichen vermag, wird durch das Wirken des Geistes möglich. "Denn das Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes" (Röm 8,2). "Wenn ihr euch vom Geist führen laßt, dann steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz" (Gal 5,18), das unfrei macht und zur Sünde führt. Die urchristliche Mahnrede weist immer wieder auf die Taufe hin, in der wir eine "Neuschöpfung" werden (2 Kor 5,17). "Ihr habt den alten Menschen mit seinen Taten abgelegt und seid zu einem neuen Menschen geworden, der nach dem Bild seines Schöpfers erneuert wird" (Kol 3,9f). "Zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist!" (Eph 4,24). Ein Musterbeispiel solcher Taufverkündigung ist der erste Petrusbrief, der in konkreten Mahnungen daran erinnert, daß christliches Leben der ständigen Erneuerung bedarf.
2.5. Die Verwirklichung der Forderung Jesu als bleibender Anspruch
In ihrem sittlichen Streben, das die frühen Christen als "Einübung des Christlichen" verstanden, wußten sie sich auf die Gemeinde verwiesen, in der sie lebten. Zwar richtet sich die sittliche Weisung primär an den einzelnen, denn nur er kann Subjekt der Verantwortung sein, aber ein christliches Leben, isoliert von der Gemeinde, war für die damaligen Christen undenkbar. Darum versucht Paulus, seine noch in mancherlei heidnischen Gewohnheiten befangenen Gemeinden zu christlichen Gemeinschaften zu formen, besonders die Gemeinde von Korinth (vgl. den ersten Korintherbrief). Gemeinden in der Diaspora galt es zu ermutigen, die heidnischen Mitbürger von der Redlichkeit und Rechtschaffenheit der Christen zu überzeugen (1 Petr 2,11f). Andere, schon länger bestehende Gemeinden mußten gemahnt werden, ihr Anderssein nicht zu vergessen, ihre christliche Berufung nicht zu verleugnen und ihre Identität zu wahren (Eph 4,17-24; 5,7-14). Wie einst die Jünger Jesu sollen die Gemeinden Salz der Erde und Licht der Welt sein (Mt 5,13f; vgl. Phil 2,14f). Lukas beschreibt das Leben der Gemeinde mit Gebet, Verkündigung, Brotbrechen und Dienst an Armen (Apg 2,41ff). Mit zunehmendem gesellschaftlichen Einfluß wächst auch die Verantwortung der Kirche und jeder ihrer Gemeinden für die Aufgaben in der Welt.
In ihrem sittlichen Verhalten wußten sich die urchristlichen Gemeinden streng an die überlieferten Worte Jesu gebunden. Das zeigt sich zum Beispiel in der Frage der Ehescheidung (1 Kor 7,10f; Mk 10,11f). In den bestehenden Verhältnissen und Wechselfällen des Lebens mußten vermittelnde Lösungen im Geist der Weisungen Jesu gefunden werden. So gibt Paulus von sich aus Anordnungen, wie die Korinther bei schon geschiedenen Ehepartnern und bei religiös gemischten Ehen verfahren sollten (1 Kor 7,11-16), und Matthäus fügt für juden-christliche Gemeinden beim Ehescheidungsverbot die Klausel "außer im Fall von Unzucht" ein (Mt 5,32; 19,9). Doch auch andere Weisungen Jesu bereiteten pastorale Schwierigkeiten, so etwa die Aufforderung Jesu zu unermüdlichem Verzeihen angesichts von schweren Übeltätern und hartnäckigen Sündern in den Gemeinden (vgl. Mt 18,15-17 mit 18,21f; 1 Kor 5) oder im Fall von Rechtsstreitigkeiten zwischen Gemeindegliedern (1 Kor 6). Auch Jesu freimütiges Verhalten zu den Frauen führte in der Urkirche zu unterschiedlichen Reaktionen. Das alles wirft Licht auf die Schwierigkeiten, denen sich schon die Urkirche in der Deutung und Befolgung der sittlichen Botschaft Jesu gegenübersah.
Die Schwierigkeiten in der Auslegung und Anwendung der sittlichen Forderungen Jesu haben sich seitdem vielfach vermehrt und erweitert. Sie verlangen eine ständige Besinnung und immer neue Antworten. Um in der heutigen komplexen Lebenswelt sittliche Orientierungen zu finden, muß die vom Glauben geleitete Vernunft das jeweilig Geforderte und der Intention Jesu Entsprechende zu erkunden und zu bestimmen versuchen. Dazu ist die ganze Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden aufgerufen.
3. Die Grundstruktur des biblischen Ethos
Das biblische Ethos im Alten wie im Neuen Testament baut sich auf der Glaubensüberzeugung auf, daß sich Gott als Heil der Menschen geoffenbart hat, und zwar in einer geschichtlich voranschreitenden Offenbarung bis hin zur endgültigen Offenbarung in Jesus Christus. Die Offenbarung geschah "viele Male und auf vielerlei Weise" einst gegenüber den Vätern durch die Propheten, zuletzt aber durch den Sohn, den er "zum Erben des Alls eingesetzt" hat (Hebr 1,1f). Die dem Menschen als geistbegabtem Wesen verliehene Fähigkeit, mit seiner Vernunft das sittlich Gute zu erkennen, mit freiem Willen zu bejahen und nach Kräften zu erfüllen, wird damit in einen neuen Horizont gerückt. Gott selbst, auf den in seiner Gutheit alles sittliche Tun angelegt ist, hat dem Menschen die Richtung seines sittlichen Verhaltens gezeigt und den Sinn seines Strebens erschlossen. Darum orientiert sich das biblische Ethos am Wort Gottes, wie es die Glaubenden in der lebendig bezeugten Überlieferung und in den biblischen Urkunden erkennen können. Das Wort des Glaubens ist jedem nahe, der es im Herzen annehmen will und mit seinem Mund bekennt (Röm 10,8). Es ist kein "fremdes" Wort, sondern ein sich menschlicher Einsicht erschließendes Wort (Mi 6,8), das ihn zu Menschlichkeit und mitmenschlicher Gemeinschaft zu befreien vermag.
Befreiend wirkt die biblische Verkündigung, daß Gott zuerst seinen Heilswillen offenbart und durch Taten des Heils bekundet. Erst aus der Zusage göttlicher Errettung entspringt der sittliche Imperativ, aus Gottes Gnade und Erbarmen sein Anspruch. Gott begründet einen Bund mit der Menschheit, zunächst mit Israel, dann mit der Völkerwelt. Aufgrund der Befreiung aus dem Sklavenhaus Ägypten fordert Gott von Israel, seine Gebote (den Dekalog) zu halten. Jesus verkündet die mit ihm hereinbrechende befreiende Gottesherrschaft und ruft dazu auf, sich entsprechend der erfahrenen Liebe und Barmherzigkeit Gottes zu verhalten. Das Sittliche . erscheint als geschenktes Können, als gnadenhaft gewährte Ermöglichung durch Gott, dann aber auch als bindende Anforderung.
Das Ethos ist zwischen Heilszuwendung und Verheißung endgültigen Heils eingespannt. Beides, Gottes gnadenhafte Initiative und das dadurch ermöglichte, davon getragene menschliche Bemühen, ist unlöslich miteinander verbunden, bis trotz allen menschlichen Versagens Gott am Ende sein vollendetes Reich herbeiführt. Diese Zukunftserwartung setzt bereits in der Geschichte neue Möglichkeiten ethischen Verhaltens frei, und zwar aus dem unbedingten Glauben an Gottes Macht, seine in Jesus und seinem Wirken angebrochene Herrschaft zu vollenden. Diese neuen Möglichkeiten ethischen Verhaltens beziehen sich auf neue ethische Fragestellungen, die zwar nicht aus der Schrift unmittelbar beantwortet werden können, aber ihren Lösungsansatz im biblischen Ethos finden.
Der Inbegriff christlicher Ethik ist das Liebesgebot, das untrennbar die Gottesliebe und die Nächstenliebe in sich vereinigt. Die Gottesliebe muß sich in der Nächstenliebe zeigen und bewähren; die Nächstenliebe findet in der Gottesliebe ihren Halt und ihren Richtungssinn. Das Unterscheidende und Entscheidende der christlichen Ethik hängt mit der Person Jesu Christi zusammen. "Er hat alle Neuheit gebracht, indem er sich selbst brachte" (Irenäus von Lyon, Adv. haer. IV, 34,1). Jesus ist die menschgewordene Liebe Gottes, die zum Richtmaß ethischen Verhaltens wird. In seiner Person, in seinen Worten und Taten wird Gottes Wille anschaulich und erfahrbar. Darum ist mit Glauben und Umkehr die Nachfolge Jesu als Grundorientierung verbunden. Dazu gehört der Weg Jesu über das Kreuz zur Auferstehung. Die paulinische Freiheitslehre ist entscheidend im Glauben an den erlösenden Tod und die Auferstehung des Herrn gegründet. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben, damit wir seinen Spuren folgen (1 Petr 2,21). So ist das biblische Ethos aus der Botschaft von der Gnade und Liebe Gottes, die sich in höchster Weise in Jesus Christus erschlossen hat, zu begreifen. Es ist dadurch ein eigenständiges und unverwechselbares Ethos.
Das Eigentliche christlicher Ethik ist jene Liebe, die an der Liebe Jesu teil hat und an ihr Maß nimmt, "einander zu lieben, wie ich euch geliebt habe" (Joh 13,34), eine Liebe bis zum äußersten, bis zur Hingabe des Lebens für die anderen (vgl. Joh 13,1; 1 Joh 3,16; vgl. KKK 1823 über die Liebe als das "neue Gebot").
III. Grundvollzüge des Lebens aus dem Glauben
1. Christliche Grundhaltungen
Die Sittlichkeit umfaßt nicht nur das rechte Tun und Lassen in einzelnen Handlungen, sondern zunächst die richtigen Einstellungen und Grundhaltungen, von denen jeweils die entsprechenden einzelnen Handlungen geleitet werden. Wir bezeichnen solche Grundhaltungen als Tugenden. "Die menschlichen Tugenden sind feste Haltungen, verläßliche Neigungen, beständige Vollkommenheiten des Verstandes und des Willens, die unser Tun regeln, unsere Leidenschaften ordnen und unser Verhalten der Vernunft und dem Glauben entsprechend lenken. Sie verleihen dem Menschen Leichtigkeit, Sicherheit und Freude zur Führung eines sittlich guten Lebens. Der tugendhafte Mensch tut freiwillig das Gute" (KKK 1804). Im Philipperbrief heißt es: "Was immer wahrhaft, edel, recht, lauter, liebenswert ist, darauf seid bedacht" (4,8).
Die richtige innere Einstellung des Christen kommt vor allem in den Grundhaltungen des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe zum Ausdruck, die wir auch als göttliche oder theologische Tugenden bezeichnen (vgl. hierzu und zum Folgenden KKK 1803-1832).
Im Neuen Testament findet sich manchmal die Reihenfolge Glaube, Liebe, Hoffnung. Das ist gut begründet, weil der Glaube sich in der Liebe unmittelbar auswirken soll (vgl. Gal 5,6), während sich der Mensch in der Hoffnung auf die Vollendung hin ausstreckt. Nur an einer Stelle findet sich in der Heiligen Schrift die Reihenfolge Glaube, Hoffnung, Liebe (1 Kor 13,13). Das ist am Ende des Hohenliedes der Liebe gut zu verstehen, weil dort der besondere Nachdruck auf die Liebe gelegt wird. In der christlichen Tradition ist die Reihenfolge Glaube, Hoffnung, Liebe üblich geworden und bis heute so geblieben.
Die drei Grundhaltungen Glaube, Hoffnung, Liebe werden im Neuen Testament auf unterschiedliche Situationen bezogen. So sind als Ausfaltungen der Liebe bestimmte sittliche Grundhaltungen in sogenannten "Tugendkatalogen" zusammengestellt (Gal 5,22f; Kol 3,12; Eph 4,2; 4,32 - 5,2; 5,9; 1 Tim 6,11; 2 Tim 2,22; 1 Petr 1,5-7 usw.). Bei Glaube, Hoffnung und Liebe geht es um die innere Offenheit des Menschen auf Gott hin; man nennt sie theologische Tugenden, weil sie unmittelbar auf Gott bezogen sind. Sie werden uns geschenkt, wenn wir in der Taufe als Gotteskinder angenommen werden. Sie durchdringen, weil unser Festhalten an Gott auch unser ganzes Leben durchdringen soll, unser gesamtes Tun und Lassen. So wirken sie sich aus in den sogenannten sittlichen Tugenden, in denen wir das richtige Verhältnis zu unseren Mitmenschen und zu den Aufgaben unseres Lebens gewinnen. Solche sittlichen Tugenden entstehen nicht von selbst; von Gottes Gnade getragen, müssen wir uns um sie bemühen; so nennt man sie auch erworbene Tugenden. Unter ihnen kommt den sogenannten "Kardinaltugenden" Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maßhalten besondere Bedeutung zu. Sie werden "Kardinaltugenden" (Cardo = Türangel) genannt, weil sich um sie das ganze sittliche Leben dreht.
1.1. Glaube
Der Hebräerbrief umschreibt den Glauben als "Feststehen in dem, was man erhofft, Überzeugt-Sein von Dingen, die man nicht sieht" (Hebr 11,1). Der Glaube wird hier ganz im Blickfeld der Hoffnung gesehen. Vorbilder für einen solchen Glauben sind Abel, Henoch, Noach und besonders Abraham. "Abraham glaubte dem Herrn, und der Herr rechnete es ihm als Gerechtigkeit an" (Gen 15,6).
Die Heilige Schrift versteht unter Glauben weder ein einfaches Meinen noch ein bloßes Überzeugtsein der Vernunft. Das Hebräische verwendet eine Reihe von Ausdrücken für das mit Glauben Gemeinte. Dabei werden besonders die Wurzeln "aman" (vgl. Amen) im Sinne von Festsein, Sich-Halten an etwas und "batah" im Sinne von Gewißsein und Vertrauen verwendet. Glauben bedeutet also vor allem ein Sich-Gründen des Menschen in Gott. Dieses gibt ihm Sicherheit und Grundvertrauen auf Gott, in dem er sich geborgen weiß.
Glauben betrifft den ganzen Menschen. Im Glauben richtet er sich auf Gott aus. Glauben heißt leben, wie es der Zuwendung Gottes entspricht. Deshalb ist Glaube auch Vollzug der Sittlichkeit. Sittlich schlechtes Handeln wird dem Anspruch des guten Gottes nicht gerecht; unser Handeln ist sittlich gut, insofern es auf das Gute überhaupt und damit auf den Guten, auf Gott abzielt (Lk 18,19 par.). Paulus spricht vom "Werk des Glaubens" (1 Thess 1,3) und verbindet den Glauben mit der Nächstenliebe. Diese ist der Einheitsgrund des gesamten sittlichen Verhaltens. Was immer der Mensch leistet oder tut, wenn er die Liebe nicht hat, ist er nichts (vgl. 1 Kor 13,2). "Denn in Christus kommt es nicht darauf an, beschnitten oder unbeschnitten zu sein, sondern darauf, den Glauben zu haben, der in der Liebe wirksam ist" (Gal 5,6; vgl. 1 Kor 13; 1 Tim 1,5; 4,12; 2 Tim 1,13; Tit 3,15 usw.).
Es gehört zur Aufgabe der Kirche, "die Botschaft zum Glauben und zur Anwendung auf das sittliche Leben" zu verkünden (LG 25). Der Glaube soll dem Leben seine christliche Gestalt geben. Er ist nicht nur ein Fürwahrhalten von Sätzen, sondern umfassender ein Leben aus dem Vertrauen auf Gott und auf seine Liebe. Deshalb spricht die Kirche mit der Heiligen Schrift vom "Gehorsam des Glaubens" (DV 5; vgl. Röm 1,5), in welchem sich der Mensch Gott in Freiheit überantwortet.
Glauben ist Antwort auf das Wort und die Liebe Gottes. Der Glaubende versteht sich in seiner ganzen Existenz als von Gott beschenkt. Es ist seine höchste Würde, von ihm geliebt zu sein und aus der Kraft der Liebe zu leben. Die Liebe Gottes beläßt dem Menschen seine Freiheit. Er kann sich daher in vertrauensvollem Glauben auf Gott einlassen oder sich in Unglauben von ihm abkehren.
Unglaube leugnet die eigene Geschöpflichkeit und die Gottverwiesenheit des Menschen. Er ist nicht nur bewußte Ablehnung Gottes oder einzelner Glaubenswahrheiten, sondern auch Verneinung der Gottesbezogenheit des Menschen durch seine gesamte Lebenshaltung. Dadurch verfehlt der Mensch auch die Sinnerfüllung, auf die hin er geschaffen ist.
Durch den Glauben richtet der Mensch sich selbst auf Gott hin aus und antwortet damit auf das Entgegenkommen Gottes. Der Glaube kann auch dort noch wirksam sein, wo sich der Mensch des Zieles seines Handelns nicht ausdrücklich bewußt ist oder dieses Ziel nicht ausdrücklich kennt. Wenn Heiden zeigen, "daß ihnen die Forderung des Gesetzes ins Herz geschrieben ist" und ihr Gewissen davon Zeugnis ablegt (Röm 2,15), dann hat Gott ihnen im Gewissen seinen Willen offenbart; indem sie ihrem Gewissen gehorchen, erkennen sie Gott an.
Der Mensch kann sein Leben aber auch auf "Götzen" ausrichten. Damit sind "Wirklichkeiten" gemeint, die er an die Stelle Gottes setzt, obwohl sie geschaffen und begrenzt sind. Solche Götzen können sein: Macht, Reichtum, Lebensgenuß usw. Wer ihnen verfällt, gerät in Widerspruch zu Gott und seinem Willen. Der Glaube wächst mit der Glaubenseinsicht. Deshalb ist das rechte vernunftgemäße Verstehen des Glaubens für das sittliche Handeln bedeutsam. Das Glaubenswissen über Gott, über die Menschwerdung Jesu Christi, seinen Tod und seine Auferstehung sowie über das Wirken des Heiligen Geistes erschließt dem Menschen die Liebe Gottes und weckt in ihm Vertrauen und Hoffnung. Das gläubige Verstehen hilft ihm, den Glauben vor der eigenen Vernunft und vor Angriffen von außen zu rechtfertigen.
Der Glaube ist nicht etwas, das der Glaubende ein für allemal "hat". Glauben heißt einen Weg gehen. Dieser Weg kann beschwerlich sein; auf ihm gibt es auch Suchen und Tasten, Verwirrtsein, Zweifel und Dunkelheit. Glauben ist mehr als Einsicht des Verstandes und Leistung des Willens; er ist vertrauende Hingabe an den Herrn, in welcher wir ihn immer wieder bitten: "Ich glaube. Hilf meinem Unglauben!" (Mk 9,24).
Glaube und Leben aus dem Glauben stehen immer auch in enger Bindung und Verbindung mit der Gemeinschaft der Glaubenden. Jesus hat uns der Gemeinschaft der Glaubenden in der Kirche anvertraut, damit wir immer tiefer in die Wahrheit des Glaubens hineinwachsen und einander im Glauben stärken. In der Vielfalt der Weltanschauungen und Überzeugungen sind Gemeinde und Gesamtkirche der Hort, in welchem sich diejenigen finden, die glaubend das Wort Gottes empfangen und es weitergeben.
Glaubensüberzeugungen und sittliche Überzeugungen stehen immer im Zusammenhang mit der Umwelt. Die Gemeinschaft der Glaubenden ist eine große Hilfe für den einzelnen. Denn wie sich die Liebe dort am gewissesten ist, wo sie angenommen und erwidert wird, so findet auch der Glaube den tiefsten Halt, wo er in Gemeinschaft gelebt und bezeugt wird. In diesem Glauben soll sich der einzelne in den verschiedenen Lebenssituationen bewähren, besonders dann, wenn er Widerspruch erfährt oder in Glaubensschwierigkeiten gerät. Hier ist Glaubenswissen wichtig, aber allein nicht ausreichend. Der Glaube muß gelebter Glaube sein. Wir müssen ihn bekennen und dürfen ihn nicht verleugnen.
- "Wer sich nun vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel verleugnen" (Mt 10,32f).
Solcher Glaube ist dann auch immer mit der Liebe zu Gott und den Menschen und mit der Hoffnung verbunden.
1.2. Hoffnung
Unser christliches Leben, das sich in Glaube und Liebe verwirklichen soll, ist von der Hoffnung erfüllt. Wenn Christen von ihrer Hoffnung sprechen, meinen sie damit jene Grundhaltung, in der sie mit Zuversicht darauf vertrauen, daß Gott seine Verheißung in Jesus Christus erfüllt: das Heil für jeden einzelnen Menschen, für die Kirche, für die gesamte Menschheit, ja für die ganze Schöpfung in der Herrlichkeit des neuen Himmels und der neuen Erde. Das ist der Inhalt der christlichen Hoffnung. Von ihr sollen wir Zeugnis geben durch alle unsere kleinen Hoffnungen hindurch, auch in allen Enttäuschungen und Leiden. Weil Jesus durch sein Leiden am Kreuz und durch seine Auferstehung den Tod überwunden hat, gibt es begründete Hoffnung in einer Welt, in der viele Kreuze aufgerichtet wurden und werden.
Christliche Hoffnung knüpft an die Ursehnsucht des Menschen nach Glück an. Der Mensch trägt eine Sehnsucht in sich, die durch die Güter der Welt nie voll zu stillen ist. Hinter allen Hoffnungen des Lebens steht die große Hoffnung auf bleibende Erfüllung in einer letztgültigen Vollendung, im Heil (Röm 8,24).
Christliche Hoffnung ist etwas anderes als Optimismus und Fortschrittsglaube. In ihr richten wir unser Leben auf Gott aus, weil wir darauf vertrauen, daß wir in ihm die endgültige Erfüllung finden. Für Christen ist ihre Hoffnung weder Vertröstung noch Weltflucht. Für sie ist das Leben in dieser vergänglichen Welt der Weg ins ewige Leben. Die Hoffnung ist ihnen Grund, sich in der Welt und für die Welt einzusetzen, denn diese Welt soll sich in Gott vollenden (vgl. GS 39). Die Vater-unser-Bitte "Dein Reich komme" zielt darauf ab, daß der Wille Gottes in der Welt wirksam werde und das Leben der Menschen bestimme. Denn das Gottesreich soll schon hier Gestalt annehmen, auch wenn es sich erst in der Ewigkeit vollendet.
Christliche Hoffnung ist nicht mit innerweltlicher Utopie zu verwechseln, die ein innerweltliches Glück verheißt, das mit menschlicher Kraft und mit Mitteln der Welt erstrebt werden soll. Utopien, die irdische Paradiese verheißen, treiben in Verzweiflung und Resignation, weil sich die großen Hoffnungen nicht erfüllen.
Im Zusammenhang mit der christlichen Hoffnung kann eine rechtverstandene Utopie insofern hilfreich sein, als Christen sich nie mit den bestehenden Verhältnissen in der Welt abfinden dürfen, sondern immer bestrebt sein müssen, das Ungenügen und das Unrecht in der Welt zu erkennen und auf eine bessere Welt hinzuarbeiten. Christen werden sich aber immer zugleich dessen bewußt sein, daß es volle Gerechtigkeit und unbedrohten Frieden in dieser Welt nicht gibt.
Die christliche Hoffnung richtet sich auf die Auferstehung und das ewige Leben, auf die bleibende Anteilnahme am Heil, das Gott uns verheißen hat. - Unser Leben steht zwar immer unter der Erfahrung der Vergänglichkeit, aber zugleich verlangt es nach dem Bleibenden, nach Ewigkeit, nach dem, was die Heilige Schrift als "Heimat" (Hebr 11,14-16), als "Wohnung bei Gott", als "ewiges Haus" (2 Kor 5,1) beschreibt. - Jede Erfahrung von Glück ist das Versprechen eines Glücks, das der vergängliche Augenblick nicht einlösen kann. Der Mensch findet die volle Erfüllung seiner Hoffnung nicht in der Vergänglichkeit der irdischen Zeit, sondern im ewigen Leben bei Gott (2 Kor 4,17ff; 5,1; 2 Tim 2,10; 1 Petr 5,10; Hebr 12,28 usw.).
Christliche Hoffnung erwartet das Heil für den ganzen Menschen. Die Heilige Schrift spricht nicht von einer Auferstehung der Seele, sondern von der Auferstehung der Toten (Jes 26,19; Dan 1,22; Mk 9,10; 12,25f; 1 Kor 15,35-55), bei der der Leib des Menschen verklärt und dem Leib des auferstandenen Herrn gleichgestaltet wird (Phil 3,21).
Das Heil, das Gott verheißt, ist Gott selbst. In der Gemeinschaft mit ihm vollendet sich unser Leben. Von dieser Gemeinschaft mit Gott ist dann auch die Gemeinschaft der Menschen, die bei Gott leben, geprägt. Deshalb beschreibt die Heilige Schrift das Heil mit Bildern, die Gemeinschaft und Begegnung ausdrücken: als Gottesschau (1 Kor 13,12; 2 Kor 5,7; 1 Joh 3,2), als Hochzeit (Hos 2,21f), als Mahlgemeinschaft (Jes 25,6-8; Mt 25,10; Lk 14,15ff) und als umfassenden Frieden.
Unsere Hoffnung richtet sich nicht nur auf die Auferstehung der Menschen, sondern auch auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Die Gestalt dieser Welt wird vergehen (Mt 24,29 par.; Jes 66,22; 2 Petr 3,10-12), aber es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben (Jes 65,17; 66,22; 2 Petr 3,13; Offb 21,1). Die ganze Schöpfung, die Gott um des Menschen willen geschaffen hat, wird von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit sein (vgl. Röm 8,19-21; GS 39). Nichts von dem, was geschaffen worden ist, wird verloren oder vergeblich sein. "Die Liebe wird bleiben wie das, was sie einmal getan hat" (GS 39). Das Zweite Vatikanische Konzil behält in seinen Aussagen den biblischen Begriff "neue Erde" ausdrücklich bei, um darauf hinzuweisen, daß der ganzen Wirklichkeit die Vollendung in Christi Wiederkunft verheißen ist. Die christliche Hoffnung erwartet im Vertrauen auf Gottes Zusage den neuen Himmel und die neue Erde als endgültige Gestalt der in Jesus Christus erlösten und befreiten Schöpfung.
Das Heil, auf das Christen hoffen, ist schon angebrochen. Das wirft auf unser irdisches Leben neues Licht. Schon hier wird Gott durch seinen Geist wirksam:
- "Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung" (Gal 5,22f).
Die Vollendung und Offenbarung des endgültigen Heils steht aber noch aus. Wir "warten darauf, daß wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar werden" (Röm 8,23).
Man wirft dem Christentum vor, es verkünde eine Hoffnung, die durch nichts begründet sei. Christen können dem entgegenhalten, daß ihre Hoffnung begründet ist in der Geschichte Gottes mit den Menschen und besonders in der Auferstehung Jesu Christi. In der Geschichte des Heils hat die Menschheit immer wieder in Gottes machtvollem Handeln seine Treue erfahren. Diese Erfahrung hat zu der Glaubensgewißheit geführt, daß Gott treu ist (Hos 2,22; Dtn 32,4). Noch deutlicher wird die Begründung der Hoffnung im Neuen Testament:
- "Wenn Jesus - und das ist unser Glaube - gestorben und auferstanden ist, dann wird Gott durch Jesus auch die Verstorbenen zusammen mit ihm zur Herrlichkeit führen" (1 Thess 4,14; vgl. 1 Kor 15,18-22).
Das Heil, auf das wir hoffen dürfen, ist nicht ein Ergebnis menschlicher Leistung, sondern ein Geschenk der Gnade Gottes. Dieses Heil besteht darin, daß Gott dem Menschen Anteil gibt an seinem göttlichen Leben und daß der Mensch in dieser Gemeinschaft seine Erfüllung findet. Daraus, daß uns das Heil geschenkt wird, folgt nicht, daß wir untätig bleiben sollen. Im Gegenteil, die Hoffnung leitet uns an, im Aufblick zur erhofften Wirklichkeit unser Leben zu gestalten.
Die Hoffnung hat also Auswirkungen auf die Einstellungen und das Verhalten der Menschen. Sie gibt Freude und Zuversicht:
- "Die aber, die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft, sie bekommen Flügel wie Adler. Sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und werden nicht matt" (Jes 40,31).
Hoffnung bewahrt vor Resignation. Sie gibt Mut auch dort, wo äußerlich gesehen alles hoffnungslos zu sein scheint. Der Christ kann das Scheitern mancher Hoffnung bestehen. Er ist davon überzeugt, daß der Sinn seines Lebens nicht vom Gelingen einzelner Handlungen abhängt, sondern von der Ausrichtung seiner ganzen Existenz auf die ewige Berufung. So kann er sogar "gegen alle Hoffnung" hoffen (vgl. Röm 4,18). Deshalb ist Hoffnung auf Zukunft und Heil auch für die Gegenwart von Bedeutung.
Hoffnung will geübt und genährt werden. Das geschieht dadurch, daß wir der Großtaten Gottes gedenken. Solches Gedenken soll zum Dank werden. Wir nähren die Hoffnung, indem wir Gott danken für alles, was er Gutes getan hat. Aus diesem Dank erwachsen Vertrauen und Zuversicht (vgl. Röm 8,31f).
Die Angst vor der Zukunft steht in einer gewissen Spannung zur Hoffnung. Manchmal steigt im Menschen die Angst vor der Zukunft und dem Neuen, das sie mit sich bringt, auf. Es gibt nicht nur die freudige Zuversicht, sondern auch die bange Sorge und die Angst vor dem Unerwarteten. Die christliche Hoffnung befreit nicht von solchen Ängsten, aber sie gibt die Kraft, sich ihnen zu stellen und sie zu tragen in Verbundenheit mit dem Herrn, der selbst Todesangst durchlitten hat (Mt 26,37).
Hoffnung ist ein zuversichtliches Warten und Erwarten, das mit Geduld verbunden ist. Aus Mangel an Vertrauen und Zuversicht können Ungeduld und sogar Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung erwachsen. In der Versuchung zur Hoffnungslosigkeit gibt uns Gott in seiner Treue Grund zur Zuversicht: "Gott ist treu; er wird nicht zulassen, daß ihr über eure Kraft versucht werdet" (1 Kor 10,13).
Besonders eindrucksvoll verwirklicht sich die Hoffnung als theologische Tugend im Gebet. Jesus hat uns selbst das klassische Gebet der Hoffnung gelehrt, das Vater-unser, das unser Denken und Handeln auf das Kommen seines Reiches ausrichtet. Indem wir es in seinem Geist beten, werden zugleich alle Zukunftserwartungen, Wünsche, Hoffnungen, Ängste durch unser Vertrauen auf Gott und seine Zusage geläutert (weitere klassische Formulierungen unserer Hoffnung finden sich in den Psalmen, besonders in Ps 130).
1.3. Liebe
Der Glaube wird in der Liebe wirksam (vgl. Gal 5,6). Dadurch wird die Liebe zur entscheidenden Grundhaltung des Christen. Paulus stellt sie noch über Hoffnung und Glaube:
- "Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; doch am größten unter ihnen ist die Liebe" (1 Kor 13,13).
Die drei Grundhaltungen des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe dürfen nicht gegeneinander ausgespielt oder auseinandergerissen werden; sie gehören innerlich zusammen:
- "Wenn man fragt, ob jemand ein guter Mensch ist, fragt man nicht nach dem, was er glaubt oder hofft, sondern nach dem, was er liebt. Denn wer in der richtigen Weise liebt, glaubt und hofft zweifellos auch in der richtigen Weise; wer aber nicht liebt, dessen Glaube ist leer, mag auch wahr sein, was er glaubt; und seine Hoffnung ist leer, mag auch das, was er hofft, der Lehre gemäß zur wahren Seligkeit gehören" (Augustinus, Ench. 117).
Liebe stiftet Einheit zwischen Personen. Menschen, die einander lieben, fühlen sich miteinander verbunden. Liebe ist dann echt, wenn der Mensch sich ganz in sie einbringt. Deshalb sagt die Heilige Schrift von der Liebe zu Gott: "Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft und mit all deinen Gedanken" (Lk 10,27 par.; Dtn 6,4).
In der Liebe spiegelt sich die Sehnsucht des Menschen nach Begegnung und Erfüllung in Gemeinschaft wider. Der Mensch empfängt die Liebe als Geschenk und antwortet darauf mit seiner Liebe.
Wenn wir von Liebe sprechen, denken wir zunächst an die Liebe zum Mitmenschen. Sie bedeutet vor allem Wohlwollen und Sorge um das Wohl des anderen. Sie will, daß es dem anderen gut geht und daß er glücklich ist. Sie bejaht den anderen als Person in ihrer Freiheit und Eigenentscheidung.
Zur Liebe gehört auch die Bereitschaft zum Verzichten. Das kann sogar so weit gehen, daß jemand sein Leben für andere hingibt. "Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt" (Joh 15,13).
Nicht jeder steht zu jedem anderen in der gleichen Beziehung. Darum ist auch die Liebe und das, was sie an Gesinnung und Tat fordert, jeweils verschieden. Es gibt Geschwisterliebe, Elternliebe, Kindesliebe, Freundesliebe, eheliche Liebe. In allen diesen Formen sind Liebende in je eigener Weise füreinander da. Eine andere Form der Liebe ist die Liebe zum Fremden, wie sie am Beispiel des barmherzigen Samariters deutlich wird (vgl. Lk 10,25-37). Dieser begegnet einem hilfsbedürftigen Menschen, den er nicht kennt und nie wiedersehen wird. Er leistet ihm selbstlose Hilfe, kümmert sich darum, daß er versorgt ist, und geht dann weiter seinen eigenen Weg. Wieder eine andere Form der Liebe ist die "Fernstenliebe". Sie kommt darin zum Ausdruck, daß Menschen durch persönlichen Einsatz oder durch materielle Mittel für Menschen in anderen Ländern und Kontinenten sorgen oder politisch für sie eintreten. Als höchste Form der Liebe gilt nach den Worten Jesu die Feindesliebe (Mt 5,43-47). In ihr sollen wir sogar noch denen Gutes tun, die uns Böses zufügen.
Liebe will immer das Wohl des anderen, zugleich schenkt sie aber auch Glück Sinnerfüllung des eigenen Lebens. Darin, daß sie beglückt, findet die Liebe ihr eigenes Glück. Es macht glücklich, einen anderen zu lieben, aber in der Liebe lebt immer auch das Verlangen nach eigenem Glück. Das ist kein verwerflicher Egoismus. Liebe ist nicht erst dann sittlich wertvoll, wenn sie keinerlei Ichbezogenheit enthält und zu reiner Selbstlosigkeit wird. Allerdings erfordert wahre Liebe, daß wir vordergründige Eigeninteressen zurückstellen und den anderen nicht zum bloßen Mittel für das eigene Glück machen. Liebe fordert Treue, die sogar bis zur Hingabe des eigenen Lebens reichen kann.
Jede echte menschliche Liebe geht über das menschliche Du hinaus und bezieht sich immer, wenn auch unbewußt, auf Gott. Sie liebt im Nächsten Christus. In der Liebe zu einem Menschen wird immer schon mehr bejaht, als dieser von sich aus erwarten und bieten kann. Dadurch, daß wir den Menschen um seiner selbst willen lieben, lieben wir Gott, der den Menschen erschaffen, erlöst und zum Heil berufen hat.
Im Alten Bund ist die Einsicht in das tiefere Wesen der Liebe erst allmählich gewachsen. Aus der Vorzeit stand in Erinnerung noch das "Faustrecht der Stärkeren" und eine maßlose Rache (vgl. Gen 4,24: "Wird Kain siebenfach gerächt, dann Lamech siebenundsiebzigfach"). In Israel wurde solcher Willkür ein Ende gesetzt durch die sogenannte "talio"-Formel, nach welcher die Vergeltung nicht über den erlittenen Schaden hinausgehen darf (vgl. Dtn 19,21: "Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß"). Dieser "Fortschritt" wirkte weiter und führte über die vielfältige Forderung, dem Mitmenschen im Namen des Bundesgottes gerecht zu werden (vgl. die zweite mosaische Tafel des Dekalogs, Am 5,24; Hos 4,1ff; Jes 1,17; Mi 6,8; Jer 7,1-15 u. a.) und sich ihrer in Barmherzigkeit anzunehmen (vgl. Hos 6,6; Sach 7,9; Jes 58,7f u. a.), schließlich zum Liebesgebot. "An den Kindern deines Volkes sollst du dich nicht rächen und ihnen nichts nachtragen.
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst" (Lev 19,18), und schließlich sogar: "Du sollst ihn (den Fremden) lieben wie dich selbst" (Lev 19,34).
Im Neuen Testament bekommt das Gebot der Nächstenliebe durch die Verbindung von Gottes- und Nächstenliebe einen letzten Ernst. Die Nächstenliebe ist ebenso wichtig wie die Gottesliebe (Mt 12,39). In der Nächstenliebe erweist sich die Liebe zu Gott, bewährt sie sich und findet eine konkrete Anwendung. "Niemand hat Gott je geschaut; wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist in uns vollendet" (1 Joh 4,12). "Wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht" (1 Joh 4,20).
Der Zusatz im Gebot der Nächstenliebe "wie dich selbst" ist keine Begrenzung, als brauche man den Nächsten nur so weit zu lieben, wie die Selbstliebe reicht. Vielmehr soll die naturhaft im Menschen vorhandene Selbstliebe wie ein Stachel wirken, die Liebe zum Nächsten in der Tat zu erfüllen. Was man für sich selbst tut, um das eigene Wohl zu fördern, soll man auch den anderen tun.
Eine solche Weisung, die zum Tun drängt, gleichsam ein praktischer Wegweiser, wie man die Liebe zu anderen Menschen bestätigen soll, ist auch die Goldene Regel:
- "Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen" (Mt 7,12; Lk 6,31).
Anders als die negative Fassung der Goldenen Regel im Alten Testament "Was dir selbst verhaßt ist, das mute auch einem anderen nicht zu" (Tob 4,15), drängt die positive Formulierung im Neuen Testament auf Werke der Nächstenliebe. Das wichtigste Gebot ist das Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe, an dem das ganze Gesetz und die Propheten hängen (Mt 22,40). Das Liebesgebot macht nicht vor den Undankbaren und Nichtliebenswürdigen halt, sondern schließt auch Böse und Feinde ein.
Das Maß der Nächstenliebe ist letztlich jene Liebe, die Jesus den Menschen bis zur Hingabe seines Lebens geschenkt hat. Er selbst nennt es ein neues Gebot:
- "Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben" (Joh 13,34).
Neu ist es nicht gegenüber der Formulierung des alttestamentlichen Gebotes "Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst" (Lev 19,18), sondern neu ist Verständnis im Blick auf die in Jesus sichtbar und greifbar gewordene Liebe Gottes. Sie soll in der Kirche weiterwirken (vgl. 1 Joh 2,8). Wie Jesus die Seinen bis zum äußersten geliebt hat (Joh 13,1), so müssen auch wir bereit sein, für die Brüder und Schwestern das Leben hinzugeben (vgl. 1 Joh 3,16). Der Christ wird in die Liebesbewegung einbezogen, die von Gott ausgeht, sich in der Liebe Jesu bekundet und in der Liebe der Seinen Frucht trägt. Sie soll zu deren Kennzeichen werden (Joh 13,35). Weil uns Gott zuerst geliebt hat, können wir einander lieben (1 Joh 4,10).
1.4. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue
Glaube, Hoffnung und Liebe wirken sich im sittlichen Handeln aus. Sie führen zu Verhaltensweisen, die als "sittliche Tugenden" bezeichnet werden. Als solche heben sich aus der Bibel Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue hervor. Gegenüber einer engen und ängstlichen Gesetzesgerechtigkeit gelten diese drei Tugenden als das sittlich Geforderte (Mt 23,23b). Sie sind das "Wichtigere" im Gesetz.
Gerechtigkeit ist nach dem Verständnis der Bibel Gottesgabe und Verheißung, die von den Menschen ein gemeinschaftsentsprechendes Verhalten erwartet. Gerechtigkeit bedeutet somit in diesem Zusammenhang - über die Gebundenheit an das Gesetz mit seinen Rechtsvorschriften hinaus - eine mitmenschliche Haltung, die bemüht ist, nach der Weisung Gottes jedem Menschen das Seine zukommen zu lassen. Sie ist somit der feste und beständige Wille, jedem sein Recht zu gewährleisten.
In der Heiligen Schrift wird das damit begründet, daß Gott gerecht ist und gerechte Taten liebt. "Wer rechtschaffen ist, darf sein Angesicht schauen" (Ps 11,7). Der König, der eine gerechte Herrschaft ausübt, der das Recht liebt und das Unrecht haßt, wird von Gott mit dem Öl der Freude gesalbt (Ps 45,7). Gott schafft auf Erden Gnade, Recht und Gerechtigkeit (Jer 9,23). Unter den Geboten des Heiligkeitsgesetzes heißt es: "Du sollst deinen Nächsten nicht ausbeuten und ihn nicht um das Seinige bringen . . . Du sollst in der Rechtsprechung kein Unrecht tun" (Lev 19,13.15), und im Deuteronomium heißt es: "Du sollst das Recht nicht beugen. Du sollst kein Ansehen der Person kennen . . . Gerechtigkeit, Gerechtigkeit - ihr sollst du nachjagen, damit du Leben hast" (Dtn 16,19f). Die Propheten werden nicht müde, gegenüber einer veräußerlichten Kultfrömmigkeit Taten der Gerechtigkeit und Liebe zu fordern. "Ist nicht das ein Fasten, wie ich es liebe: ungerechte Fesseln lösen, Stricke des Jochs entfernen, Gefolterte freilassen, jedes Joch zerbrechen?" (Jes 58,6).
Die mitmenschliche Gerechtigkeit ist nach dem Zeugnis der Propheten ein Grundanliegen des Bundesgottes (Am 5,21-24; Jes 5,1-7), ja die Menschenrechte sind nach ihrem Zeugnis Gottesrecht. Weil Gott zu seinem Volk gerecht ist und es in Gerechtigkeit führt, soll im Volk Gerechtigkeit herrschen. Wer in Gerechtigkeit vor Gott wandelt, bestätigt dadurch den Bund mit Gott. Wie eine Zusammenfassung der alttestamentlichen Weisung klingt das Wort des Propheten Micha: "Es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Nichts anderes als dies: Recht tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott" (6,8).
Das sind die "wichtigeren" Gebote, wie sie auch bei Matthäus (23,23) aufgezählt werden. "Rechttun" steht als umfassender Ausdruck für das rechte Verhalten zum Mitmenschen voran; in der Güte und Treue soll es sich bewähren. Gerechtigkeit muß sich besonders im Beistand für die ungerecht Behandelten, die Benachteiligten und Unterdrückten erweisen. Das Unrecht an ihnen soll durch Wiederherstellung des Rechts beseitigt werden. Denen, die von einem persönlichen schweren Schicksal betroffen sind, wie etwa Behinderung oder Unfall, soll sozialgerechte Hilfe gewährt werden. Die Sachgerechtigkeit ist nicht der einzige Maßstab, nach welchem Recht zuzumessen ist, dazu muß noch die sein Personengerechtigkeit kommen, die dem einzelnen nach seiner Veranlagung, seinem Werdegang, seinem Schicksal gerecht zu werden versucht.
Für Jesus ist in der Bergpredigt das "Suchen der Gerechtigkeit Gottes", das heißt das Bemühen um die von Gott geforderte und durch ihn ermöglichte Gerechtigkeit, neben dem Suchen des Reiches Gottes der dringlichste Anruf (Mt 6,33). Man soll "hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit" (Mt 5,6), wie auch Jesus gekommen ist, um alle Gerechtigkeit in seiner Person zu erfüllen (Mt 3,15). Selig werden die gepriesen, die "um der Gerechtigkeit willen" verfolgt werden (Mt 5,10). Die Gerechtigkeit der Jünger Jesu soll größer sein als die der Schriftgelehrten und Pharisäer (Mt 5,20). Wie die anschließenden Antithesen (Mt 5,21-48) zeigen, ist damit ein Tun gemeint, das die bekannten Gebote des Dekalogs in einer neuen und tieferen Weise befolgt. Im ganzen ist "Gerechtigkeit" ein umfassender Ausdruck für die von den Christen geforderte Sittlichkeit. Dabei liegt der besondere Nachdruck auf dem Handeln nach dem Vorbild Gottes und Jesu. Nicht Worte oder Begeisterung sind entscheidend, sondern das Tun (Mt 7,21.24-27; 21,28-31).
Das "größere" Maß der Gerechtigkeit, die Jesus hier in seiner Botschaft vom Reich Gottes fordert, ist nicht ein quantitatives Mehr gegenüber den im Alten Testament formulierten Geboten; vielmehr will Jesus, daß wir der neuen Situation gerecht werden, die durch seine Ansage des nahegekommenen Reiches Gottes (vgl. Mk 1,15) gegeben ist: Gott ist nicht nur Ziel und Horizont unseres menschlichen Handelns, sondern er gibt sich in Jesus mitten hinein in unsere Geschichte und in unser Leben, und so kann diesem Gott nur derjenige gerecht werden, der bis in die innerste Faser seines Herzens und bis in die äußerste Konsequenz seines Handelns sich diesem gegenwärtigen, uns in seiner Liebe unmittelbar nahen Gott stellt.
Neben der Gerechtigkeit gehört die Barmherzigkeit zu den Tugenden, die Jesus im Anschluß an die Propheten nachdrücklich betont (in Mt 9,13 und 12,7 zitiert er Hos 6,6). In vielen Gleichnissen spricht er davon, so in der sein Erzählung vom barmherzigen Samariter (Lk 10,30-35), vom verlorenen Schaf und der verlorenen Drachme (Lk 15,1-10), vom verlorenen Sohn (Lk 15,11-32) oder vom unbarmherzigen Gläubiger (Mt 18,23-35).
Jesus selbst hat in vielen Situationen ein Herz für die Armen und Notleidenden gezeigt, indem er "alle Kranken heilte, die zu ihm kamen" (Lk 6,19), wenn es sich ergab sogar am Sabbat (Mk 3,1-6 par.). Er vergab den Sündern (vgl. Lk 7,36-50 par.) und verhieß noch dem Schächer am Kreuz das Paradies (Lk 23,43). Jesus tadelt die Unbarmherzigkeit der Pharisäer, die zwar den anderen schwere Lasten auferlegen, sie selbst aber mit keinem Finger berühren (Lk 11,46).
Am Beispiel Jesu wird deutlich, daß Barmherzigkeit, die aus dem Herzen kommt, jede Art von Überheblichkeit ausschließt. Sie bemitleidet nicht, indem sie von anderen gering denkt, sondern sie fühlt und leidet mit und soll in dem Wissen geübt werden, daß wir alle der Barmherzigkeit Gottes bedürfen (vgl. Mt 18,23-35; 6,12).
Die Barmherzigkeit Jesu zeigt sich insbesondere in seiner Bereitschaft zur Vergebung. Seine Liebe zu den Sündern erregte Aufsehen (vgl. Lk 7,39; 15,2). Die eigentliche Zielrichtung seines gesamten Wirkens war auf das Heil gerichtet, das den Sündern zugesprochen wurde (vgl. Mk 2,1-12). Wir alle müssen zur Vergebung bereit sein, weil wir uns selbst seiner Vergebung verdanken (vgl. Lk 7,36-50; Mt 18,23-35). Er gibt uns das Ziel vor: "Seid barmherzig, wie euer himmlischer Vater barmherzig ist" (Lk 6,36).
Barmherzigkeit wird zur gelebten Barmherzigkeit in jenen "Werken der Barmherzigkeit", von denen Jesus in der großen Gerichtsrede spricht (Mt 25,34-46) und die als "leibliche Werke der Barmherzigkeit" zusammen mit den "geistigen Werken der Barmherzigkeit" in der christlichen Tradition zu Kennzeichen der christlichen Nächstenliebe geworden sind:
- Die Hungrigen speisen, die Durstigen tränken, die Nackten bekleiden, die Fremden beherbergen, die Kranken besuchen, die Gefangenen erlösen, die Toten begraben.
- Die Unwissenden lehren, die Zweifelnden beraten, die Trauernden trösten, die Sünder zurechtweisen, den Beleidigern gern verzeihen, die Lästigen geduldig ertragen, sein für die Lebenden und Verstorbenen beten.
Die Werke der Barmherzigkeit sind nicht so zu verstehen, als ob es hier um Werke ginge, derer wir uns vor Gott rühmen könnten. Erbarmen schenken zu dürfen ist immer Gnade, die den Blick für die anderen öffnet und die innere Kraft zum Tun der Werke verleiht. Diese sind zumeist "harte Arbeit". Ob es sich um Dienste in der dritten Welt, um Krankenpflege, um Sorge für Behinderte oder um vielfache andere Werke handelt: sie kosten diejenigen, die in den Werken der Barmherzigkeit tätig sind, immer auch ein Stück ihres eigenen Lebens und oft auch ihrer Gesundheit. Die Werke der Barmherzigkeit kommen aus einer Gesinnung, in der die Liebe Gottes wirksam wird. An ihnen zeigt sich, daß Liebe und Barmherzigkeit sich äußern müssen und daß schöne Worte nicht genügen (vgl. Mt 21,28-31). Die Werke der Barmherzigkeit sind eine Vergegenwärtigung des göttlichen Erbarmens.
Zu den Ausfaltungen der Liebe gehört neben Gerechtigkeit und Barmherzigkeit die Treue (Mt 23,23). Wir können uns Gott anvertrauen, weil Gott selbst treu ist (Ps 31,6; Dtn 32,4; Gen 15,7f). Er läßt sich in seiner Treue nicht beirren, auch nicht durch die Untreue des Menschen (Hos 11,1; Jes 31,20). Der Gedanke der Treue Gottes zieht sich wie ein roter Faden durch das Alte und Neue Testament. "Der Herr ist treu; er wird euch Kraft geben und euch vor dem Bösen bewahren" (2 Thess 3,3). Ebenso wird die Treue Christi hervorgehoben, der der treue Zeuge ist (Offb 1,5; 3,14; vgl. 19,11). Die Treue soll deshalb auch zum Kennzeichen derer werden, die den Namen "Christen" tragen. Sie sollen von der Treue Christi Zeugnis geben und für andere Menschen Vorbilder der Treue sein.
Treue ist nicht starres und unbewegliches Festhalten an etwas oder an einer Person, sondern der feste Wille, sich für eine Person oder für einen hohen Wert auf Dauer zu entscheiden. Treue ist die Festigkeit der Liebe. Treue gibt der Liebe Gestalt in der Dauer der Zeit. Sie schließt das Wagnis des Vertrauens ein und hält auch bei Enttäuschungen an ihrer Zusage fest. Wer sich auf dieses Wagnis einläßt und sich in eine Zukunft hinein festlegt, die noch offen ist, gibt sein seinem Leben eine feste Ausrichtung. Das Höchste, dem sich menschliche Treue hingeben kann, ist Gott selbst.
Treue bewährt sich in der Zuverlässigkeit. Auch die Beziehung zu Gott lebt von der Treue. Diese erweist sich in Situationen äußerster Herausforderung als Festhalten an Gott bis zum Martyrium. Sie zeigt sich aber auch in vielen Dingen, die unseren Glauben stärken und wachhalten: in Gebet, Andacht und Meditation, besonders aber in der Zuwendung zu den Menschen.
Neben Glaube, Hoffnung und Liebe und deren Ausfächerungen in Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue weist die Heilige Schrift noch auf andere Grundhaltungen wie Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Sanftmut und Selbstbeherrschung hin (Gal 5,22f). Sie werden "Früchte des Geistes" genannt. Solche Aufzählungen von Tugenden sind auch in der antiken Ethik bekannt. Während diese jedoch menschliche Haltungen beschreiben, die aus einem natürlichen Wohlverhalten erwachsen, aus Anständigkeit, Sitte und daraus strömender Freude, erfließen die "Früchte des Geistes" aus dem Wirken des Heiligen Geistes, der den Christen verliehen ist, "denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist" (Röm 5,5). Dadurch wird die natürliche Sittlichkeit nicht abgewertet, denn Paulus schreibt den Philippern: "Was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebenswert, ansprechend ist, was Tugend heißt und liebenswert ist, darauf seid bedacht" (Phil 4,8). In dem Schönen und Beglückenden eines Lebens aus den Grundhaltungen, die wir "Tugenden" nennen, eines Lebens, das auch nichtgläubige Menschen erfahren können, sieht der Christ das Wirken des Heiligen Geistes. Den Menschen werden Gnadengaben (Charismen) geschenkt, unter denen nicht nur außergewöhnliche Gaben zu verstehen sind, sondern auch Fähigkeiten zum Umgang mit anderen, zum Dienen, Trösten und Ermahnen, vor allem zur Liebe (vgl. Röm 12,7-13). Die Liebe umgreift und übersteigt alle Charismen (1 Kor 13). Sie steht auch unter den Tugenden, die der Galaterbrief nennt (5,22), an erster Stelle. Aus ihr erwachsen jene anderen Haltungen, die teils Frucht der Liebe sind wie sein Freude und Friede, teils Ausfaltungen der Liebe wie Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Die christlichen Tugenden spiegeln die ausstrahlende Kraft der Liebe wider. Hieran zeigt sich das Neue, das mit dem christlichen Ethos in die Welt gekommen war. sein
1.5. Kardinaltugenden: Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maßhalten
In der christlichen Tradition spielen neben den beschriebenen biblischen Grundhaltungen die vier Kardinaltugenden eine besondere Rolle. Schon im alttestamentlichen Buch der Weisheit sind sie genannt (vgl. 8,7). Ihre ersten Beschreibungen stammen aus der griechischen Philosophie. Bei Plato haben die Kardinaltugenden einen doppelten Bezugsrahmen; zum einen werden die Tugenden auf die unterschiedlichen Stände des (Stadt)Staates, den Lehr-, Wehr- und Nährstand, zum anderen auf die Schichten des menschlichen Seelenlebens, das heißt auf den vernünftigen, den gemüthaften und den triebbestimmten Bereich bezogen. In der Seele rangiert der vernünftige Teil als lenkende Instanz an erster Stelle, im Staat sollte der Weise (Philosoph) diesen Platz einnehmen. Ihnen ist die Tugend der Klugheit zugeordnet, die den einzelnen Menschen sowie die Staatenlenker bestimmen soll. Sowohl im Zusammenwirken der Seelenkräfte wie auch innerhalb der verschiedenen Aufgaben der Gesellschaft regelt die Gerechtigkeit die Beziehungen des einzelnen zur Gemeinschaft und bewirkt auch eine sinnvolle Harmonie der inneren Kräfte des Menschen. Die Regelung des Bereiches Gemüt und Gefühl, in dem der Mensch nach Plato auch seine Aggressivität wie umgekehrt Ängste erfahren kann, wird von der Tapferkeit geleistet; diese ist zugleich die Tugend des Kämpfers, der den Staat verteidigt. Die unterste Schicht des bewußten seelischen Lebens wird als begehrender Teil bezeichnet; in ihr erlebt der Mensch die Dynamik seiner vitalen Bedürfnisse. Diesem Teil ist die Tugend des Maßhaltens zugeordnet. Die Erfüllung der hier anstehenden Bedürfnisse besorgt der dritte Stand im Staat, der Nährstand.
Zusammen mit den Ideen der Stoa haben diese vier Tugenden Kardinaltugenden in die spätere christliche Tugendlehre Eingang gefunden. Im christlichen Verständnis, besonders bei Augustinus, aber auch bei anderen Kirchenvätern wie Ambrosius und Gregor dem Großen, werden die Kardinaltugenden als Erscheinungsformen der Liebe Gottes gedeutet. Thomas von Aquin entfaltet später sogar seine ganze Ethik als Tugendethik und behandelt nach den theologischen Tugenden (Glaube, Hoffnung, Liebe) die einzelnen Kardinaltugenden. Sie bilden die Grundlage seiner gesamten materialen Ethik.
Klugheit als erste und oberste Kardinaltugend ist nicht mit bloßer Intelligenz gleichzusetzen. Sie besteht vielmehr in der Fähigkeit, vernünftig zu handeln. Ihr kommt ein kompetentes Urteil über ethische Sachverhalte zu. Sie macht den Menschen fähig, von sich selbst abzusehen. Wer die Goldene Regel der Bergpredigt richtig anwenden will, kann das nur, indem er "über den eigenen Schatten springt" und sein Handeln aus einer höheren Perspektive beurteilt. Gerade das aber ist im ethischen Handeln gefordert. Thomas von Aquin beruft sich bei seinen Ausführungen über die Tugend der Klugheit auf ein Wort bei Augustinus: "Die Klugheit ist die Liebe, die das, was uns hilft in unserem Streben nach Gott, von dem, was uns daran hindert, gut unterscheiden kann" (S. th. II II q. 47, art. 1). Dieser Gedanke erinnert an den Apostel Paulus, der den Philippern schreibt: "Und ich bete darum, daß eure Liebe immer noch reicher an Einsicht und Verständnis wird" (1,9). Je mehr jemand in der Grundhaltung der Liebe lebt, um so mehr ist er im praktischen Urteil in der Lage, zu beurteilen, was dieser Liebe entspricht. Dieses gesunde, geistgelenkte Urteil kommt der Tugend der Klugheit zu. Ihre Aufgabe ist es, das Richtige vom Falschen zu unterscheiden, vor allem im ethischen Bereich. Sie ist jene Haltung, die eine Instrumentalisierung der Vernunft für andere Zwecke (zum Beispiel in der Schlauheit von jemand, der nur seine eigenen Interessen verfolgt) verhindert. Sie stellt den objektiven Wirklichkeitsbezug ständig neu her. Wenn die Theologie von einer Gabe des Geistes spricht, die wir biblisch Weisheit nennen, so zielt sie genau auf die Ermöglichung dieser Haltung der Klugheit hin. Klugheit in diesem Sinn ist somit das Ziel jeder Gewissensbildung, die den Menschen zu einem objektiven sittlichen Urteil befähigt.
Die Tugend der Klugheit hat insbesondere darin ihre Bedeutung, daß sie den Menschen befähigt, sich ein Urteil über die Folgen seines Handelns zu bilden. Dazu ist in immer höherem Maße Sach- und Erfahrungswissen erforderlich, das verantwortliche Entscheidungen erst ermöglicht. Wo der Mensch sich solcher Naturkräfte bedient, für die er kein unmittelbares eigenes Gespür hat, reicht unmittelbare ethische Intuition nicht aus. Hier kann verantwortlich nur handeln, wer das nötige Wissen erworben hat und die rechte Unterscheidungsgabe besitzt.
Gerechtigkeit ist, wie Thomas von Aquin formuliert, die feste und beständige Grundhaltung, jedem das Seine zu geben (S. th. II II q. 58, art. 1). Sie ist unter den Kardinaltugenden die sozialethisch bedeutsamste Grundhaltung. Entsprechend den interpersonalen, gesellschaftlich-sozialen und politischen Beziehungen werden drei Arten von Gerechtigkeit unterschieden: Die "austauschende" (kommutative) Gerechtigkeit sichert den Rechtsanspruch von einzelnen gegenüber einzelnen und von Gemeinschaften gegenüber Gemeinschaften bei Rechtsgeschäften; die "zuteilende" (distributive) Gerechtigkeit gewährleistet vom sozialen Ganzen her Rechte der einzelnen; die "gesetzliche" (legale) Gerechtigkeit betont umgekehrt die Rechtsverpflichtung der einzelnen gegenüber Gesellschaft und Staat. Diese Unterscheidung ist insofern hilfreich, als sie die Verflochtenheit der Gerechtigkeit in den unterschiedlichen Beziehungen erkennen läßt.
In der Gegenwart kommt der sozialen Gerechtigkeit besondere Bedeutung zu. Sozialgerecht ist, was das Gemeinwohl verlangt, gleichviel ob schon in Gesetzen formuliert oder nicht. Als solidarische Gemeinschaft muß die Menschheit auf das Wohl aller, besonders der Benachteiligten, gerichtet sein. Der Glaube ist eine Orientierungshilfe in der Wahrnehmung solidarischer Verantwortung: für das Recht der ungeborenen Kinder, für körperlich und psychisch Behinderte, für alte und sterbende Menschen, für gesellschaftliche Außenseiter, für Vertriebene und Asylsuchende, für Ausländer und für eine gerechte politische, soziale und wirtschaftliche Ordnung in der Welt. Durch die Hinordnung auf Gott erlangen alle diese Forderungen eine tiefere Begründung und eine stärkere Kraft. Gott schenkt den Menschen die Fähigkeit zu gerechtem Verhalten und fordert es ein. Aus der Gnade erfließt der sittliche Anruf und Anspruch zum Handeln in Gerechtigkeit (vgl. dazu auch das vierte und siebte Gebot).
Die Tugend der Tapferkeit besteht in der Standhaftigkeit des Zeugnisgebens. Sie gibt die Kraft, Widerstand zu leisten, wo das Gewissen es gebietet, auch auf die Gefahr hin, daß jemand dabei sein Leben riskiert. Höchste Form der Tapferkeit ist das Zeugnisgeben im Martyrium. Jesus selbst verwendet das Wort Tapferkeit nicht, aber lebt sie vor und weiß, daß seine Jünger Kraft brauchen, wenn sie zum Zeugnis gerufen sind. "Wenn man euch vor Gericht stellt, macht euch keine Sorgen, wie und was ihr reden sollt; denn es wird euch in jener Stunde eingegeben, was ihr sagen sollt. Nicht ihr werdet dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden" (Mt 10,19f). Die Haltung der Tapferkeit befähigt den Menschen dazu, zu sich und zu dem zu stehen, was seine Überzeugung ist, auch in Situationen äußerster Gefahr. Tapferkeit ist jene Tugend, in der wir auch gelernt haben sollen, nicht nur mit äußeren Gefahren in rechter Weise umgehen zu können, sondern auch mit Ängsten in uns. So tun, als ob es diese Ängste nicht gäbe, wäre unrealistisch und würde einer Tollkühnheit Vorschub leisten. Eine zu große Schwäche den Ängsten gegenüber würde zur Feigheit führen.
Das Bekenntnis des Christen für den Glauben verlangt, auch gegen den Strom zu schwimmen. Eine wichtige Voraussetzung für diese Haltung ist, daß jemand zutiefst von der Sache, für die er einsteht, überzeugt ist; er muß ihren Wert erfahren haben.
Zugleich muß er darin auch seinen eigenen Selbstwert erlebt haben. Der christliche Glaube ist immer auch Glaube an den Menschen; jemand, der den Glauben an sich selbst verloren hat, kann nicht tapfer sein. Der Glaube an sich selbst erwächst aber aus jener Annahme, die uns Gott in Jesus Christus geschenkt hat.
Die Form, in der heute häufig Tapferkeit gefordert wird, ist Zivilcourage. Sie beinhaltet den Mut, für seine Überzeugungen öffentlich einzutreten. Sie schließt eine gewisse Unabhängigkeit vom Urteil anderer ein. Diese hat Jesus in seiner Kritik an seinen Gegnern immer wieder vorgelebt. Zivilcourage ist heute eine Haltung, die in offenen Gesellschaften mit demokratischer Verfassung von besonderer Bedeutung ist. Hier droht immer die Gefahr, daß der Mensch von Interessen und Interessengruppen vereinnahmt wird. Es gehört großer Mut dazu, gegen die Interessen der Mächtigen die Rechte der Armen und an den Rand der Gesellschaft Gedrängten einzuklagen. Bisweilen wird gerade in diesem Bereich heute auch das Martyrium im strengen Sinne des Wortes abverlangt (vgl. Erzbischof Oscar Arnulfo Romero).
Die vierte Kardinaltugend ist das Maßhalten. In einer Gesellschaft des Konsums gehört viel Selbstbeherrschung dazu, das rechte Maß zu finden. In der Maßhaltung scheint zunächst der Mensch gegen sich selbst und seine eigenen Wünsche zu stehen; in Wirklichkeit geht es aber um die ihm zugute kommende Grenzziehung gegenüber einer schrankenlosen Wunscherfüllung. Die moderne Anthropologie weist viele Gründe für die Notwendigkeit solchen Maßhaltens auf. Es macht gerade die Eigenart des Menschen aus, daß das rechte Maßhalten in der Erfüllung seiner Bedürfnisse nicht mehr wie bei den Tieren "automatisch" erreicht wird, sondern vernunftgemäß gestaltet werden muß. Am Beispiel des Triebtäters wird deutlich, daß Triebe menschlich blind sein können. Es geht aber nicht darum, sie "abzutöten"; es geht vielmehr darum, ihre Dynamik in die verantwortliche Lebensgestaltung des Menschen einzubinden.
Biblisch tritt uns die Notwendigkeit des Bemühens um das rechte Maß bei Paulus entgegen, der zeigt, daß Selbstbeherrschung ohne gezielte Übung nicht gelingen kann (vgl. 1 Kor 9,24-26). Noch tiefer und radikaler holt der evangelische Rat der Armut das ein, was in der Tugend des Maßhaltens angezielt ist. Dieser Rat kann als Hintergrund für den rechten Umgang mit den eigenen Bedürfnissen und Wünschen verstanden werden. Darüber hinaus macht er deutlich, daß das Maßhalten mit sozialer Verantwortung zu tun hat, zum Beispiel im Umgang mit der Umwelt, in der gerechten Verteilung der Konsumchancen in der Welt und in vielen anderen Bereichen, in denen Verzichtleistungen gefordert werden können.
Maßhalten gehört heute zur Überlebenskunst der Menschheit. Es hilft der individuellen Bewältigung der eigenen Wunschwelt und zugleich der Herstellung sozialer Gerechtigkeit.
In alledem, was uns in den Inhalten der theologischen und sittlichen Tugenden begegnet, wird deutlich, warum die Unterweisung über die Tugenden von alters her an wichtiger Stelle in der christlichen Verkündigung steht. Die Gestaltung des christlichen Lebens aus diesen Tugenden gilt als das Höchste, wozu ein Mensch mit der Gnade Gottes fähig ist. Es gab aber und gibt auch viele Verfälschungen im Verständnis der Tugenden. Oft dienten sie dazu, die Menschen zu immer größeren Tugendleistungen anzutreiben. Deshalb geriet in der Reformation die Lehre von den Tugenden in den Verdacht der Verkündigung einer "Werkfrömmigkeit", mit welcher der Mensch sich aus eigener Kraft die Gnade und die Anschauung Gottes verdienen könne. Die Auseinandersetzung um das rechte Verständnis der Tugenden hat dazu geführt, daß zwischen dem katholischen und dem protestantischen Verständnis der Sittlichkeit lange Zeit ein tiefer Graben bestand. In der Gegenwart konnten in vielen ökumenischen Gesprächen solche Mißverständnisse ausgeräumt werden. Dabei spielte besonders das Verständnis von Rechtfertigung und Gnade eine entscheidende Rolle. Auch im philosophisch-ethischen Denken und im allgemeinen ethischen Bewußtsein findet das lange Zeit verpönte Nachdenken über Tugend-Ethik wieder Anerkennung und Wertschätzung. Entscheidend für diese Wiederentdeckung der Tugenden ist, daß sie als personale Haltungsbilder verstanden werden. In den theologischen Tugenden des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe spiegelt sich unsere Einstellung und unser Verhalten zu Gott wider, zu dem wir von Gott ermächtigt und befähigt sind; in den sittlichen Tugenden, besonders in den Kardinaltugenden, faltet sich dieses Verhältnis aus in die Einstellungen zu den Mitmenschen und zur Welt.
Zu den Tugenden, die den Menschen unserer heutigen Welt wahres Menschsein möglich machen, zählen neben den klassischen Kardinaltugenden solche Grundhaltungen wie Aufgeschlossenheit, Zuverlässigkeit, Ehrfurcht, Toleranz, Friedensliebe und Solidarität. Diese dürfen sich nicht im Wohlwollen und in der guten inneren Einstellung erschöpfen, sondern müssen zum Wohltun, zum rechten Handeln führen. Die innere Gesinnung wird erst glaubwürdig, wenn sie sich im konkreten Tun bewährt: in der Gemeinschaft der Glaubenden und in der weltlichen Gesellschaft, im sozialen, politischen, wirtschaftlichen und ökologischen Handeln.
Aus diesen Grundvollzügen und Haltungen soll eine "Zivilisation der Liebe" (Papst Paul VI.) erwachsen, in welcher die Menschheit immer mehr eins werden soll. Oft bleiben Menschen hinter diesen Forderungen zurück und versagen gegenüber sich selbst, den Mitmenschen und Gott. Das führt uns zu der Frage nach Sünde und Schuld, nach Umkehr und Versöhnung, nach Vergebung und Buße.
2. Sünde und Umkehr
2.1. Sündenbewußtsein und Sündenverständnis heute
Sittliches Handeln beruht auf der freien Zustimmung zum sittlichen Anspruch, in welchem letztlich der Wille Gottes für den Menschen zum Ausdruck kommt. Deshalb ist das Wesen der Sittlichkeit zutiefst das Ja zum Willen Gottes. Wo dieses freie Ja verweigert wird, geschieht Sünde. Sünde ist somit nicht nur ein Verstoß gegen Gesetze und Gebote, sondern eine Verweigerung des Anspruchs Gottes, ein Nein zu Gott. In ihr verfehlt der Mensch zugleich die Bestimmung der eigenen Person, die Liebe zu den Mitmenschen und die Verantwortung für die Schöpfung. Sünde spaltet den Menschen und die Menschheit und schafft eine zerrissene Welt, in der das Böse immer wieder neues Böses hervorbringt.
Ein solches Bild der Spaltung mit tiefen Wunden und Verwundungen zeigt sich in vielfältiger Weise: an der inneren Zerrissenheit des Menschen, an der Zerrissenheit seiner Lebensräume in Ehe, Familie und Umwelt, in Beruf und Gesellschaft, in den Beziehungen zwischen den Völkern, in der Spaltung zwischen unserer Kirche und der Ostkirche (vgl. UR 18) und zwischen unserer Kirche und den aus der Reformation hervorgegangenen kirchlichen Gemeinschaften (vgl. UR 22) und in den Auseinandersetzungen in unserer Kirche. "Ihre Wurzel liegt in einer Wunde im Innern des Menschen. Im Licht des Glaubens nennen wir sie Sünde; beginnend mit der Ursünde, die jeder von Geburt an wie ein von den Eltern empfangenes Erbe mit sich trägt, bis hin zur Sünde, die ein jeder begeht, wenn er die eigene Freiheit gegen den Plan Gottes benutzt" (RP 2).
Viele Menschen unserer Zeit haben Schwierigkeiten mit der Rede von Sünde und Schuld. Wohl sind sie sich ihrer Fehler und ihres Versagens bewußt, wenn sie gegen ein Gesetz bzw. eine Vorschrift verstoßen oder andere Menschen verletzen. Auch empfinden sie, daß sie unkorrekt gehandelt haben, wenn sie Regeln oder Normen übertreten. Was aber oft fehlt, ist das Bewußtsein, daß das etwas mit Gott zu tun hat. Ihre Einsicht in Fehler und Versagen dringt nicht in den religiösen Bereich vor, weil ihr Glaube an Gott als den Herrn schwach geworden oder gar nicht vorhanden ist. Zumindest werden Gott und die eigene Lebenserfahrung oftmals nicht mehr in Beziehung zueinander gesetzt. Infolgedessen fehlt auch weithin das Verständnis dafür, daß eine böse Tat nicht nur gegen eine Regel oder eine Vorschrift verstößt, sondern gegen Gott und seine Heiligkeit.
Nach Papst Pius XII. ist "die Sünde des Jahrhunderts der Verlust des Bewußtseins von Sünde" (Radiobotschaft vom 26. 10. 1946: Discorsi et Radiomessaggi VIII, 288). Papst Johannes Paul II. sieht den Grund für das fortschreitende Schwinden und sogar Erlöschen des Sündenbewußtseins in der Krise des Gewissens und im Schwinden des Gottesbewußtseins (RP 18). Wo das moralische Bewußtsein und das Gottesbewußtsein verdunkelt sind, schwindet auch das Bewußtsein für die Sünde. Dies geschieht, wo in einem "Humanismus völlig ohne Gott" (Säkularismus) der Kult der Autonomie, des Machens und Produzierens, des Konsums und des Genusses herrscht. Hier reduziert sich das Bewußtsein für Sünde bestenfalls auf das, was der Selbstverwirklichung schadet oder andere verletzt. Die Beziehung zu Gott kommt hier nicht mehr vor.
Das Bewußtsein für Sünde schwindet auch dort, wo man bestrebt ist, den einzelnen von jeglicher Schuld zu entlasten oder die Verfehlungen des Menschen auf die Gesellschaft, auf die Bedingungen der Umwelt oder charakterliche Vorgegebenheiten abzuwälzen. Manchmal wird die Verantwortung des Menschen als so sehr eingeschränkt betrachtet, daß ihm gar nicht mehr die Fähigkeit zugeschrieben wird, wahre menschliche Akte zu setzen und somit auch zu sündigen.
Ferner schwindet das Gespür für persönliches Versagen und Sünde, wo der Sinn für bleibende bindende Werte aus dem Blick gerät und das Handeln der Beliebigkeit anheimgegeben wird.
Auch im Denken und Leben der Kirche gibt es Erscheinungen, die dazu beitragen, daß das Sündenbewußtsein schwindet oder ein falsches Sündenbewußtsein entwickelt wird. Nicht selten werden übertriebene Einstellungen der Vergangenheit durch neue Übertreibungen ersetzt: Während früher die Neigung bestand, in beinahe allem und jedem Sünde zu sehen, gelangen nicht wenige heute dazu, sie nirgendwo mehr zu sehen; während früher in der Verkündigung die Furcht vor ewiger Strafe überbetont wurde, findet sich heute weithin eine Verkündigung der Liebe Gottes, die jede für Sünde verdiente Strafe ausschließt; während früher ein starkes Bemühen vorherrschte, das irrige Gewissen zu ändern, besteht heute die Tendenz, die Achtung all dessen, was sich als Gewissen ausgibt, so überzubetonen, daß seine Verpflichtung, nach der Wahrheit zu suchen, zu wenig berücksichtigt wird (vgl. RP 18).
Ein Zeichen dafür, daß das Bewußtsein für Sünde als Gespür und wache Aufmerksamkeit für das Böse und für das Versagen vor Gott bei vielen Christen schwächer geworden, verkümmert oder verfälscht ist, wird auch an der Einstellung zum Bußsakrament als Feier der Versöhnung mit Gott und der Vergebung der Sünden deutlich. Zwar sehen manche in der kirchlichen Regelung über die verschiedenen Formen der Bußfeier eine wertvolle Hilfe für eine lebendige Gestaltung der Praxis des Bußsakramentes (vgl. Ordo Paenitentiae von 1974); aber andere nehmen sie zum Anlaß, das Bußsakrament aufzugeben und die Bußandacht als ausreichend zu betrachten. Darin zeigt sich nicht nur eine Krise des Bußsakramentes, sondern auch eine Krise des Sündenbewußtseins und des Sündenverständnisses.
Es ist Aufgabe der Kirche, den Menschen die Botschaft der Versöhnung zu verkünden und der Welt als Geschenk der Versöhnung anzubieten. Versöhnung setzt aber Bekehrung und Vergebung voraus. Beide sind nur möglich, wenn ein waches Bewußtsein für Sünde und ein richtiges Verständnis von Sünde da ist.
2.2. Die biblische Sicht von Sünde
Das Alte Testament betrachtet die Sünde unter verschiedenen Rücksichten. Sünde ist Auflehnung gegen die Ordnung Jahwes (Num 14,9; Dtn 28,15-44), eine Tat aus freiem Willen (Gen 4,7), aus bösem Herzen (Gen 6,5; Ps 51,12), Ungehorsam, Ungerechtigkeit, Gotteshaß, Abfall von Gott, Untreue und Unglaube. Immer geht es in der Sünde darum, daß der Mensch den Bund bricht, den Gott mit ihm geschlossen hat. In der Sünde vergeht er sich gegen die Verpflichtung zur Treue gegen Gott und gegen die Gerechtigkeit gegenüber den Mitmenschen.
Bei Sünden, die mit Überlegung begangen werden, wie etwa Unzucht, falscher Gottesdienst und Anbetung fremder Götter, wird gefordert, daß der Schuldige aus seinem Volk entfernt wird. Das konnte auch eine Verurteilung zum Tod bedeuten (vgl. Num 15,30; Lev 18,26-30; 19,4; 20,1-7; 21,17). Von diesen Sünden wurden andere unterschieden, vor allem solche, die aus Unachtsamkeit begangen werden; sie wurden durch ein Opfer nachgelassen (vgl. Lev 4,2ff; 5,1ff; Num 15,22-29).
Im Neuen Testament wird Sünde als Verfehlung des Heils, der Teilhabe am Reich Gottes, gedeutet. Jesus hat die Sünde als das, was den Menschen von Gott trennt und vom Reich Gottes ausschließt, sehr ernst genommen. Das zeigt sich weniger in einzelnen Aussprüchen als in der Art, wie er die Sündenvergebung als beglückende Botschaft der hereinbrechenden Gottesherrschaft verkündet. Dem Gelähmten, den man vor ihn bringt, damit er ihn heile, sagt er als erstes: "Deine Sünden sind dir vergeben" (Mk 2,5 par.). Sünde ist das schlimmste Unglück, das schwerer wiegt als körperliche Gebrechen. Er ist gekommen, Sünder zu berufen, wie er durch seine Teilnahme am Zöllnergastmahl veranschaulicht (Mk 2,15-17 par.). Die Sünderin, die ihm die Füße salbt und viel Liebe erweist, nimmt er in Schutz und verteidigt sie (Lk 7,36-50). Weil Zöllner und Dirnen auf die Predigt des Täufers Johannes hin umgekehrt sind, werden sie eher ins Gottesreich gelangen als jene, die dem Täufer nicht geglaubt haben (Mt 21,31f). Der demütige und reumütige Zöllner im Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner kehrt als Gerechter nach Hause zurück, der den Zöllner verachtende Pharisäer nicht (Lk 19,9-14).
Im Gleichnis vom verlorenen Sohn wird erkennbar (Lk 15,11-32), was Sünde für Jesus ist: Absage an den Vater, Abkehr von Gott, dem der Mensch doch alles Gute verdankt, Elend in der Fremde fern von Gott. Der Sünder lebt in der Finsternis (vgl. 1 Joh 1,5f), die Sünde führt zum Tod (vgl. Joh 8,24). Mit seinen Heilungen und Dämonenaustreibungen führt Jesus einen Kampf gegen die Macht des Bösen (vgl. Mk 3,23-27). Wer die guten Taten dem Satan zuschreibt, lästert wider den Heiligen Geist - eine Sünde, die in Ewigkeit keine Vergebung findet (Mk 3,28f), "weil sie in ihren verschiedenen Formen eine hartnäckige Weigerung darstellt, sich zur Liebe des barmherzigen Vaters zu bekehren" (RP 17). Das angestaute Böse richtet sich gegen den, der das Heil bringt. Ihn abzulehnen ist schwere Schuld. So ist im Johannesevangelium der Unglaube die eigentliche Sünde (16,9; vgl. 9,41). Es gibt keine Entschuldigung für Menschen, die sich im Haß gegen Jesus und Gott verhärten (15,22-24).
Jesus lehrt, daß alle Menschen vor Gott Sünder sind und der Umkehr bedürfen (vgl. Lk 13,2-5). Auf diesem Hintergrund wird sein Eintreten für die reumütigen Sünder verständlich. Er, der selbst ohne Sünde war (vgl. Joh 8,46; Hebr 4,15; 7,26), will die Menschen von der Last der Sünde befreien.
Für Paulus steht ebenfalls fest, daß alle, ob Juden oder Griechen, unter der Sünde stehen (Röm 3,9-18) und die Herrlichkeit Gottes verloren haben. Nur durch den Glauben an Jesus Christus erlangt der Mensch die Erlösung (Röm 3,23f). Paulus sieht die Sünde als eine furchtbare Macht an, die den Menschen seit dem Sündenfall in den Tod treibt (Röm 5,12). Hier tritt Jesus Christus für uns ein. Er hat uns durch seinen Tod mit Gott versöhnt. So kann Paulus den Korinthern schreiben: "(Gott) hat (Christus), der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes wurden" (2 Kor 5,21) (vgl. KEK 1, 189; 230; 286). Paulus spricht aber nicht nur von der einen Sünde des Ungehorsams und des Unglaubens (Röm 11,32), sondern er nennt auch eine Vielzahl von einzelnen Sünden, so besonders im Lasterkatalog (1 Kor 6,9f) und in der Aufzählung der Sünden der Heiden (Röm 1,21-32). Manche Verfehlungen sind so schwerwiegend, daß sie vom Reich Gottes ausschließen (vgl. 1 Kor 6,9f; Gal 5,19-21). Durch die Taufe, in der wir mit Christus sterben, werden wir von der Sünden- und Todesmacht befreit und erlangen das Leben mit Christus (Röm 6,10-11). Doch muß auch der Christ noch gegen die Verführungen zur Sünde kämpfen (Röm 6,12-14), kann aber diesen Kampf durch den in ihm wohnenden Heiligen Geist bestehen (Gal 5,16-25).
Johannes ist davon überzeugt, daß jeder, der aus Gott gezeugt ist, Sünde nicht tut, weil der Same Gottes, der Heilige Geist, in ihm bleibt (1 Joh 3,9). Und doch kommt es zu Sünden, die den Christen beunruhigen. Es gibt Wege zu ihrer Vergebung: das ehrliche Bekenntnis, das der gute und treue Gott annimmt (1 Joh 1,9); die Zuwendung zu Jesus Christus, der für uns eintritt (1 Joh 2,1f); das fürbittende Gebet der Mitchristen (1 Joh 5,16).
Der erste Johannesbrief unterscheidet zwischen "Sünde zum Tod" und "Sünde nicht zum Tod" (1 Joh 5,16). Sünde zum Tod ist, ähnlich wie "Sünde wider den Heiligen Geist" (Mk 3,28f), die Haltung, die letztlich zum Untergang in den "ewigen Tod" führt, weil sich in ihr der Mensch der Öffnung für Gott und der Versöhnung mit Gott verweigert.
2.3. Das Wesen der persönlichen Sünde.
Das Wesen der persönlichen Sünde liegt in einer freien Stellungnahme. "Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Hochmut und Unvernunft" (Mk 7,21f). Entscheidend ist die falsche innere Einstellung, die sich dann auch in äußeren schlechten Handlungen ausdrückt. Die Sünde richtet sich gegen die eigene Person, gegen die Mitmenschen und gegen Gott (KKK 1849f).
Gegen die eigene Person richtet sich die Sünde, weil sie gegen den Sinn der menschlichen Existenz verstößt und den Menschen von seinem höchsten Ziel, der Gemeinschaft mit Gott, abbringt.
Sünde verstößt von ihrem Wesen her auch gegen den Nächsten. In der Sünde verschließt sich der Mensch gegenüber dem Mitmenschen und handelt gegen das Wohl anderer. Wie die Erfüllung des Gesetzes Ausdruck der Liebe ist (Röm 13,10), so ist die Sünde Ausdruck der Lieblosigkeit.
Da sich der Mensch in der Sünde der Liebe verschließt, wendet er sich darin von Gott ab, der Liebe ist. Das geschieht nicht nur dann, wenn er ausdrücklich an Gott denkt und sich so gegen ihn entscheidet, sondern schon dadurch, daß er Gottes Gebot mißachtet. In der Sünde wird statt des einen wahren Gottes eine endliche Wirklichkeit in den Mittelpunkt gestellt: Macht, Reichtum, Sexualität, Lebensgenuß und vieles mehr.
Der Mensch steht in der Versuchung, seine Schuld vor sich selbst und vor anderen zu verleugnen oder zu verkleinern. Es fällt nicht leicht, die eigene Schuld einzusehen und sie einzugestehen. Der Schuldiggewordene kann es nicht einmal aus eigener Kraft. Wo jemand einsieht, daß er schuldig geworden ist, und sich auch zu dieser Schuld bekennt, geschieht es mit Gottes Gnade.
Sünde kann durch einzelne Taten, Worte und Unterlassungen geschehen. Diese haben zumeist als tiefere Ursache, daß die Verantwortung für eine umfassende Gestaltung des Lebensauftrages vernachlässigt worden ist. Wo die innere Verbundenheit mit Gott schwindet, wirkt sich das auch auf das religiöse Leben aus: auf die Teilnahme am Gottesdienst, auf das Gebetsleben und auf die aktive Teilnahme am Leben der Kirche. In ähnlicher Weise führt ein Nachlassen in der Nächstenliebe dazu, daß Menschenrechte verletzt werden oder andere schwere Verfehlungen gegen Gottes Gebote geschehen. Ehebruch, Tötung eines ungeborenen Kindes, Lüge, Betrug, Übervorteilung anderer oder schwerer Diebstahl sind Anzeichen dafür, daß Treue, Lebensrecht, Wahrhaftigkeit, Achtung der Person und des Eigentums anderer aus dem Blick geschwunden sind.
Oft ist es nur schwer auszumachen, wie weit die eigene Schuld reicht. Der heranwachsende Mensch braucht die Zuwendung anderer, die Liebe von Vater und Mutter, das Bemühen seiner Lehrer und Erzieher, um sittliche Werte erkennen zu können. Er braucht das beratende Wort und das gute Vorbild, um die Sinnhaftigkeit seines Tuns einzusehen. Wo ihm diese Hilfen versagt bleiben oder nicht in genügendem Ausmaß gegeben werden, kann es geschehen, daß er in seinem moralischen Vermögen beeinträchtigt ist. Die Schuld für sein Versagen liegt dann nicht ausschließlich bei ihm selbst, sondern zum Teil auch bei denen, die für seine moralische Erziehung mitverantwortlich waren oder ihm ihre Zuwendung versagt haben. Allerdings darf die Tatsache, daß moralisches Versagen auch sozial bedingt ist, nicht dazu führen, daß alle Schuld immer auf die anderen abgeschoben wird. Jeder ist zunächst einmal für sein Tun selbst verantwortlich.
Die persönliche Verantwortung für das eigene Tun schließt aus, daß es eine Kollektivschuld gibt. Es gibt eine gemeinsame Verantwortung; wird sie nicht hinreichend wahrgenommen, können wir miteinander schuldig werden. Wer zum Beispiel einen Mitmenschen zu einer Sünde verführt oder anleitet, ist für dessen Sünde mitverantwortlich; er trägt möglicherweise sogar die Hauptschuld. Auch eine Gesellschaft, die durch ihre Einstellung und ihr Verhalten bei den einzelnen Mitgliedern der Gesellschaft Fehlhaltungen fördert, wird an deren Fehlhaltungen mitschuldig.
Durch Sünde kann das gesamte gesellschaftliche Milieu verdorben werden. "Wenn aber einmal die objektiven Verhältnisse selbst von den Auswirkungen der Sünde betroffen sind, findet der mit Neigung zum Bösen geborene Mensch wieder neue Antriebe zur Sünde" (GS 25). Somit besteht zwischen persönlicher und sozialer Sünde ein Wechselverhältnis. Die in den Strukturen verfestigte Sünde bzw. die "sündigen Strukturen" können die Personen innerlich so prägen, daß sie in ihnen gewissermaßen eine Barriere gegen das Gute schaffen und so zu persönlichen Sünden geradezu disponieren. Nach dem Katechismus der Katholischen Kirche stellen die "sündigen Strukturen" in einem analogen Sinn eine "soziale Sünde" dar (1869).
Zwar ist eine Situation, eine Institution, eine Struktur oder eine Gesellschaft an sich kein Subjekt moralischer Akte und kann deshalb auch nicht in sich selbst moralisch gut oder schlecht sein, weil dahinter immer sündige Menschen stehen, die erst eine von der Sünde geprägte Struktur schaffen (RP 16), aber die Struktur gewordene Sünde kann die Glieder der Gesellschaft in einen Schuldzusammenhang verstricken, der gleicherweise die persönliche Umkehr wie die Änderung der Strukturen fordert.
Darüber hinaus gibt es eine Verantwortung, aus der eine Gemeinschaft für die Folgen einzustehen hat, die aus bestimmten Handlungen der Gemeinschaft erwachsen sind. So kann es sein, daß ein Volk als ganzes die Folgen eines Krieges zu tragen hat, auch wenn viele keine persönliche Schuld auf sich geladen haben. Hier ist gefordert, daß sich alle in Solidarität bemühen, den aus Unrecht entstandenen Schaden nach Möglichkeit wiedergutzumachen.
Die sittliche Freiheit des einzelnen kann nicht nur durch die Gemeinschaft, in der er lebt, mitgeprägt sein, sondern auch durch seine eigene Vergangenheit. Das Versagen der Vergangenheit beeinträchtigt sein Handeln in der Gegenwart. Echte Umkehr bewirkt Neuorientierung. Aus der Geschichte der Schuld kann so ein Anlaß und Anstoß zu einem Neuanfang werden.
Das geschichtliche Dasein des Menschen bringt es mit sich, daß der Mensch seine innere Entscheidung für oder gegen Gott in immer neuen Handlungen treffen muß. Es gibt nicht nur die Grundentscheidung der Sünde gegen Gott, sondern auch die Sünden in der Mehrzahl, in denen die Grundentscheidung gegen Gott sich immer erneut ausdrückt und verstärkt. Dabei können die einzelnen Verfehlungen von unterschiedlicher Schwere sein.
2.4. Todsünde - läßliche Sünde, schwere Sünde - leichte Sünde
Die Tatsache, daß bereits die Bibel von der einen Sünde und den vielen Sünden sowie von Sünden von größerem und von geringerem Gewicht spricht, hat in der kirchlichen Tradition dazu geführt, daß nach genaueren Unterscheidungen gesucht wurde. Das geschah vor allem in Verbindung mit der Bußpraxis und später mit der Bußform der geheimen und häufigeren Beichte. Dabei kam es zu unterschiedlichen Aufteilungen.
Seit dem 4. Jahrhundert gibt es die Unterscheidung von Todsünde und läßlicher Sünde. Diese wird im 11. Jahrhundert allgemein gebräuchlich. In der Theologie der Scholastik im 12. und 13. Jahrhundert wird Todsünde als Abkehr vom letzten Ziel und als Handlung gegen die Liebe, läßliche Sünde dagegen als Unordnung in den Mitteln zum Ziel bzw. als unvollständiger menschlicher Akt verstanden. Mit der Bestimmung des Konzils von Trient, daß alle Todsünden nach Zahl, Art und artverändernden Umständen zu beichten sind (vgl. DS 1679-1681, 1707), setzte ein besonders intensives Bemühen um die Klärung des Unterschiedes zwischen Todsünde und läßlicher Sünde ein. Dabei kam es zu einer immer größeren Ausweitung des Begriffs und der Zahl von Todsünden. In Theologie und Pastoral wird bis heute an der Zweiteilung in Todsünde und läßliche Sünde festgehalten; doch wird, wie Papst Johannes Paul II. eigens betont, die in der Tradition ebenfalls übliche Unterscheidung in schwere und leichte Sünde mit der Aufteilung in Todsünde und läßliche Sünde praktisch gleichgesetzt (vgl. RP 17).
Die heutige kirchliche Lehrverkündigung nennt in Übereinstimmung mit der ganzen Tradition "denjenigen Akt eine Todsünde, durch den ein Mensch bewußt und frei Gott und sein Gesetz sowie den Bund der Liebe, den dieser ihm anbietet, zurückweist, indem er es vorzieht, sich selbst zuzuwenden oder irgendeiner geschaffenen und endlichen Wirklichkeit, irgendeiner Sache, die im Widerspruch zum göttlichen Willen steht (conversio ad creaturam - Hinwendung zum Geschaffenen)" (RP 17; vgl. KKK 1857).
Für die Schwere der Sünde sind drei Merkmale ausschlaggebend: das Maß der gegebenen und eingesetzten Freiheit, die Klarheit der Erkenntnis und die Wichtigkeit der Sache (vgl. KKK 1857-1861).
Die Freiheit verwirklicht sich immer in einem zeitlichen Prozeß. Der Mensch fällt nicht völlig unvermittelt in schwere Sünde, sondern erst dann, wenn die sittlich schlechte Haltung schon in ihm vorbereitet worden ist. Wo jemand Böses tut, ohne daß eine innere Fehlentwicklung vorausgegangen ist, darf man annehmen, daß für eine solche Sünde äußere Beweggründe entscheidend waren, zum Beispiel Verführung, eine kaum zu ertragende äußere Situation oder auch eine schwer zu beherrschende natürliche Anlage.
Ob jemand etwas wirklich frei getan hat, zeigt sich auch daran, wie weit er sich nach der schlechten Tat mit ihr identifiziert. Wenn er sich nach der Tat sofort von ihr distanziert und sie aufrichtig bereut, ist das ein Hinweis darauf, daß er möglicherweise nicht seine ganze Person in die Tat eingebracht hat oder daß seine Freiheit eingeschränkt war. Wenn er sie dagegen nachher bejaht und bereit ist, auch weiterhin so zu handeln, zeigt sich darin ein voller Einsatz der Freiheit.
Letztlich bleibt unsere Freiheit ein Geheimnis, das nur Gott durchschaut. Außer von Jesus Christus selbst, "der in allem wie wir in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat" (Hebr 4,15; 1 Petr 2,22; Konzil von Konstantinopel, DS 554), und von der seligsten Jungfrau Maria, "die im ersten Augenblick ihrer Empfängnis durch die einzigartige Gnade und Bevorzugung des allmächtigen Gottes . . . von jeglichem Makel der Urschuld unversehrt bewahrt wurde" (DS 2803) und "während ihres ganzen Lebens frei von jeder persönlichen Sünde geblieben" ist (KKK 493; vgl. KEK 1, 178-180), kann von niemand gesagt werden, er sei ohne Sünde (vgl. 1 Kor 4,3f). Aber wir können uns immer von neuem dem Erbarmen Gottes anvertrauen.
Bei der Klarheit der Erkenntnis geht es um das Wissen von der Schwere eines Sachverhaltes oder eines Gebotes. Die Klarheit der Erkenntnis kann unterschiedlich sein. Das hängt von mehreren Faktoren ab: von der Erziehung, von Werteinsichten der Gesellschaft, von der Fähigkeit, einen wichtigen Sachverhalt von einem weniger wichtigen unterscheiden zu können, und von der Bereitschaft, sich um eine klare Erkenntnis des Sachverhalts zu bemühen. Wer ein klares Wissen über die Schwere eines Sachverhaltes oder eines Gebotes besitzt und dennoch die schlechte Tat begeht, macht sich in schwerer Weise schuldig. Er handelt bewußt gegen seine klare Erkenntnis und gegen den Spruch seines Gewissens. Fehlt dagegen die klare Erkenntnis, so liegt bei der schlechten Tat zwar objektiv eine schwere Verfehlung vor, nicht aber subjektiv eine schwere Schuld.
Bei der wichtigen Sache geht es um das größere oder geringere Gewicht eines objektiv negativen Tatbestandes oder Sachverhaltes (materia gravis - materia levis). Das Apostolische Schreiben "Reconciliatio et paenitentia" von Papst Johannes Paul II. (1984) betont, "daß einige Sünden, was ihre Materie betrifft, von innen her schwer und todbringend sind. Das heißt, es gibt Handlungen, die durch sich selbst und in sich, unabhängig von den Umständen, immer schwerwiegend unerlaubt sind wegen ihres objektiven Inhaltes. Wenn solche Handlungen mit hinreichender Bewußtheit und Freiheit begangen werden, stellen sie immer eine schwere Schuld dar" (17). Es kann im Einzelfall auch ein geringfügiger Sachverhalt von großer Bedeutung sein. Es gibt aber Verhaltensweisen, die nahezu immer schweren Schaden anrichten oder schweres Leid zufügen. In ihnen ist die wichtige Sache gegeben, die eine schwere Sünde ausmacht. Oft ist eine wichtige Sache eindeutig festzustellen, etwa Glaubensabfall, Mord oder Ehebruch. In der frühen Kirche erfolgte bei diesen Tatsünden ein Ausschluß aus der Kirchengemeinschaft. Manchmal können aber auch Zweifel daran bestehen, ob ein bestimmter Sachverhalt so bedeutend ist, wie das für eine schwere Sünde vorauszusetzen ist. Solche Zweifel sind nie nur durch den Verweis auf den äußeren Sachverhalt zu lösen, sondern es muß die Frage einbezogen werden, wieweit eine klare Erkenntnis und eine volle Zustimmung vorhanden sind. Schon in der Grundeinstellung kann es tiefgehende Fehler geben. Papst Gregor der Große (+ 604) bezeichnet solche schlechten Grundeinstellungen als Wurzelsünden: Überheblichkeit, Neid, Zorn, Geiz, Unkeuschheit, Unmäßigkeit, Trägheit. Petrus Lombardus (+ 1160) nennt als Hauptsünden: Vermessenheit, Verzweiflung, Ablehnung der erkannten Wahrheit, Neid über die Begnadung anderer, Verstocktheit und Unbußfertigkeit.
Im Unterschied zur schweren Sünde sind bei der leichten Sünde Freiheit oder klare Erkenntnis eingeschränkt oder es liegt ein weniger wichtiger Sachverhalt vor. Der überkommene Sprachgebrauch von läßlicher oder leichter Sünde darf aber nicht dazu führen, die läßlichen oder leichten Sünden für bedeutungslos zu halten.
Mit der Todsünde ist unmittelbar das Verhältnis des Menschen zu Gott und seiner Gnade gemeint: Todsünde bedeutet die entschiedene Ablehnung des Willens Gottes und damit den Verlust der heiligmachenden Gnade. Ob im Einzelfall tatsächlich eine Todsünde vorliegt, ist mit letzter Gewißheit nicht zu entscheiden.
Die Kirche hat den Unterscheidungen zwischen schwerer und leichter bzw. Todsünde und läßlicher Sünde im Zusammenhang mit dem Bußsakrament besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Diese Abgrenzungen können auch Mißverständnisse mit sich bringen und dazu führen, daß leichte Sünden entweder verharmlost oder überschätzt werden und in Gewissensängste treiben. Letztlich ist es Gott, der über uns zu richten hat, und nicht wir selbst: "Denn wenn das Herz uns auch verurteilt, Gott ist größer als unser Herz, und er weiß alles" (1 Joh 3,20). Wir dürfen darauf vertrauen, daß Gott uns in Barmherzigkeit begegnen wird.
Oft tragen zu den Fehlentscheidungen Einflüsse von außen bei: das gesellschaftliche Umfeld, das Vorbild und die Ratschläge anderer Menschen oder die öffentliche Meinung. Doch heben solche Einflüsse nicht die Verantwortung des einzelnen auf. Jeder ist mitverantwortlich dafür, wie weit er sich beeinflussen läßt und wie weit er dem Anspruch des Sittlichen, des Wahren und Guten, letztlich dem Anspruch Gottes folgt oder ihn verfehlt. Doch wie tief jemand auch in Sünde und Schuld gefallen ist, er muß nicht darin bleiben. Gottes Gnade und Liebe ruft immer wieder zu Erneuerung und Umkehr, Vergebung und Buße auf.
3. Geistliche Erneuerung in Gewissenserforschung, Umkehr, Buße und Vergebung.
Eines der bekanntesten Beispiele für eine Umkehr aus der Sünde ist im Neuen Testament das Gleichnis vom verlorenen Sohn, der aus der "Fremde der Sünde" umkehrt und sich auf den Weg zur Heimkehr macht, um bei seinem Vater Annahme und Vergebung zu finden (Lk 15,11-32); man nennt es deshalb auch das Gleichnis vom gütigen Vater.
Von großer Bedeutung für die geistliche Erneuerung ist die Gewissenserforschung. Das Sprichwort sagt: Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Nicht immer ist es leicht, seine eigenen Fehler wahrzunehmen. Zu David wurde Natan geschickt, um ihm ins Gewissen zu reden (2 Sam 12,1-13); und in den Abschiedsreden spricht Jesus von dem Geist, der die Welt der Sünde überführt. Jedes Zugeben einer Schuld beeinträchtigt das Bild, das wir von uns selbst in uns tragen. In der Sünde halten wir den Vorwurf der Schuld nieder; es kann sein, daß er ganz zum Schweigen kommt, wenn wir die Wahrheit unterdrücken (vgl. Röm 1,18); aber nur sie kann uns frei machen (vgl. Joh 8,32). Deshalb ist es wichtig, daß wir uns den Spiegel vorhalten und unser Gewissen prüfen. Die Gewissenserforschung sollte aber nicht nur ein Suchen nach Sünden sein, sondern auch nach Chancen, das Gute zu tun, das Evangelium zu leben. Es tut gut, dem eigenen Leben und Erleben nach-zu-denken, die Spuren der Güte Gottes aufzuspüren, für das Gute zu danken und um die Überwindung des Bösen zu bitten. Nirgends erkennen wir uns besser als in der Begegnung mit Gott.
Unverzichtbarer Bestandteil der Umkehr ist die Reue als Abscheu gegenüber den begangenen Sünden, verbunden mit dem Vorsatz, nicht mehr zu sündigen. In der Reue distanziert sich der Mensch von einer begangenen Tat. Zwar kann er die Tat selbst und oft auch ihre Folgen nicht mehr rückgängig machen, aber er kann in der Reue seinen Willen ändern und die begangene Tat bedauern. Dieses Bedauern ist ein heilsamer Vorgang, bei dem sich der Sünder vom Bösen wegwendet und sich wieder auf das Gute, auf Gott hin ausrichtet, denn jede Reue trägt in sich "den Bauplan eines neuen Herzens" (Max Scheler).
Zur Reue gehört die Einsicht in das Böse des eigenen Handelns. Ohne diese Einsicht ist wahre Reue nicht möglich. Häufig ist Reue ausgelöst durch den Blick auf die Folgen, die das eigene Tun bei einem selbst oder auch bei anderen gehabt hat.
Der Mensch kann sich aber auch der Einsicht in das Böse und damit der Reue und Umkehr entziehen. Der eine versucht, seine Schuld zu verdrängen. Ein anderer versucht, sie zu kompensieren, indem er sich in einem anderen Bereich besonders anstrengt. Ein dritter redet sich ein, er habe gar nicht anders gekonnt. Wieder ein anderer bekennt sich trotzig zu seiner Tat. Ungenügendes Ernstnehmen der eigenen Schuld liegt vor, wenn jemand zwar bedauert, daß er die Tat begangen hat, sich aber nicht bemüht, sich zu bekehren. Bloße Trauer über das Geschehene genügt nicht. Wo jemand zwar darüber traurig ist, daß er sich schuldig gemacht hat, sich aber nicht zur Umkehr aufrafft, kann die Trauer eher lähmend sein als zur Änderung bewegen.
Das griechische Wort für Umkehr: metanoia, zu der Jesus auffordert (Mk 1,15), bedeutet ursprünglich soviel wie nachträglich erkennen, den Sinn ändern, "den Geist umwenden, um ihn auf Gott hinzuwenden" (RP 26). Wo jemand seine Schuld nicht verleugnet und sie nicht verharmlost, sondern eingesteht, daß er schuldig geworden ist, da ist er mit Hilfe der Gnade schon auf dem Weg zur Umwandlung und Sinnesänderung. Er weiß sich schuldig vor Gott und betet mit dem Psalmisten:
- "Gott, sei mir gnädig nach deiner Huld,
- tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen!
- Wasch meine Schuld von mir ab,
- und mach mich rein von meiner Sünde!
- Denn ich erkenne meine bösen Taten,
- meine Sünde steht mir immer vor Augen.
- Gegen dich allein habe ich gesündigt,
- ich habe getan, was dir mißfällt" (Ps 51,3-6)
Im Bußakt der Eucharistiefeier treten wir vor Gott hin, bekennen unsere Schuld und bitten um Erbarmen und Vergebung: "Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben."
Der Anstoß zur Umkehr kommt von Gott, denn sie ist von ihrem Ursprung her Gnade. So heißt es in den Klageliedern des Alten Testamentes:
- "Kehre uns, Herr, zu dir, dann können wir uns zu dir bekehren" (Klgl 5,21).
Gott bewirkt die Erneuerung der Menschen:
- "Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch" (Ez 36,26).
Erst wo der Wille zur Abkehr von der Sünde auch den Willen zur Besserung einschließt, liegt eine wirkliche Bekehrung vor. Hier hat sich der Mensch von der Sünde abgewendet und den Weg zum Guten hin eingeschlagen. Der Ruf zur Bekehrung gehört zur Grundbotschaft Jesu (Mt 4,17; Mk 1,15). Weil der Mensch immer neu in Sünde und Schuld fällt, ist Bekehrung eine ständige Aufgabe.
Wo sich ein Mensch gegenüber einem anderen schuldig gemacht und Schaden angerichtet hat, kann dieser nicht allein durch Reue aus der Welt geschafft werden. Vielmehr muß der Schaden nach Möglichkeit wiedergutgemacht werden. Soweit eine materielle Schädigung vorliegt, ist die Wiedergutmachung vor allem durch Schadenersatz zu leisten.
Durch das Unrecht ist aber immer auch die Person des anderen betroffen, denn durch die Sünde ist die Liebe verletzt worden. Diese kann nur wiederhergestellt werden durch Liebeswerke, durch Bitten um Vergebung und durch Bemühen um Versöhnung. Andernfalls würde das Unrecht, selbst wenn es bereut wird, weiterbestehen und die Liebe erschweren oder unmöglich machen.
Die Vergebung kann allerdings nur dann ihren vollen Sinn erreichen und zur Versöhnung führen, wenn Reue und Bitte um Vergebung vorausgehen (vgl. Lk 17,4). Jemandem vergeben, der sein Unrecht nicht bereut, bewirkt nicht Versöhnung, sondern ist eher geeignet, den anderen in seinem Unrecht zu bestätigen und ihn zu neuem Unrecht zu veranlassen. Dennoch soll der, dem Unrecht geschehen ist, nicht abwarten, bis ihn der andere um Vergebung bittet, sondern er soll seinerseits zeigen, daß er zur Versöhnung bereit ist.
Vergebung und Versöhnung unter den Menschen sind für das menschliche Miteinander unabdingbar. Die Sünde ist aber mehr als eine Verletzung zwischenmenschlicher Beziehungen. Sie betrifft immer Gott selbst. Deshalb kann sie auch nur getilgt werden durch die Vergebung Gottes und durch seine Versöhnung mit den Menschen. Menschen dürfen und sollen einander sagen: "Ich verzeihe dir, ich vergebe dir deine Schuld!" Aber letztlich spricht das Wort der Verzeihung und der Vergebung der Schuld nur Gott (vgl. Mk 2,7). Gottes Vergebung bewirkt nicht, daß unsere Tat ungeschehen gemacht, vergessen oder für halb so schlimm erklärt wird. Vielmehr tilgt Gott unsere Schuld, indem er sich trotz unserer bösen Tat uns zuwendet, uns mit seiner vergebenden Liebe umwandelt und uns zu Menschen macht, die mit ihm versöhnt sind.
Seit ihren Anfängen gibt es in der Kirche zahlreiche und vielfältige Formen der Buße wie etwa in der Eucharistiefeier, in Sühneandachten und Fasten. Doch ist unter den Akten der Buße keiner so bedeutsam wie das Bußsakrament (vgl. dazu ausführlich KEK 1, 363-372). Das Wesen dieses Sakramentes besteht darin, daß Gott, in dessen Auftrag der Spender des Bußsakramentes handelt, in der sakramentalen Lossprechung die Vergebung der Sünden gewährt. Es ist ein wesentliches Element des Glaubens, daß Jesus Christus in seiner Kirche das Bußsakrament gestiftet hat, damit die Gläubigen, die nach der Taufe in Sünde gefallen sind, die Gnade wiedererlangen und mit Gott versöhnt werden. Das Bußsakrament ist der ordentliche Weg, um Vergebung und Nachlaß der schweren Sünden zu erlangen. Es erfordert deshalb vom Beichtenden das aufrichtige und vollständige Bekenntnis dieser Sünden. Die einzelnen Elemente des Bußsakramentes sind: Gewissenserforschung, Reue und Bekehrung (Vorsatz), Sündenbekenntnis, Lossprechung, Genugtuung (Buße).
Entsprechend den Weisungen des Zweiten Vatikanischen Konzils legt die Bußordnung (Ordo Paenitentiae von 1974) drei mögliche Formen für die Feier der Versöhnung vor:
- Feier der Versöhnung für einzelne,
- gemeinschaftliche Feier der Versöhnung mit anschließendem Bekenntnis und Lossprechung der einzelnen,
- gemeinschaftliche Feier der Versöhnung mit allgemeinem Bekenntnis und Generalabsolution.
Die erste Form soll die Möglichkeit bieten, die mehr persönlichen Aspekte auf dem Weg zur Umkehr besser zur Geltung zu bringen. Hier werden die persönliche Entscheidung und das eigene Engagement deutlich unterstrichen und gefördert. Daher haben auch das persönliche Gespräch und eventuell die geistliche Führung ein besonderes Gewicht.
Die zweite Form hebt besonders den Gemeinschaftscharakter der Bußfeier hervor und verdeutlicht besser den kirchlichen Aspekt von Bekehrung und Versöhnung. Sie eignet sich besonders für die verschiedenen Zeiten des Kirchenjahres und bei Ereignissen mit besonderer pastoraler Bedeutung.
Die dritte Form darf nur in schweren Notlagen angewandt werden mit der Verpflichtung zur persönlichen Beichte der schweren Sünden bei nächster sich bietender Gelegenheit. Dem Bischof steht es zu, für seine Diözese den Gebrauch dieser Form zu erwägen. "Niemals darf der ausnahmsweise Gebrauch der dritten Form der Bußfeier zu einer Geringachtung oder gar zur Aufgabe der gewöhnlichen Formen führen. Ebensowenig darf diese Form als Alternative zu den beiden anderen gesehen werden" (RP 33).
Mit diesen drei Formen der Bußfeier sucht die Kirche sowohl den unterschiedlichen Aspekten der Buße und Versöhnung als auch den jeweiligen pastoralen Situationen der Gläubigen gerecht zu werden.
IV. Maßstäbe christlichen Handelns
1. Normen: Einschränkung oder Ermöglichung von Freiheit?
1.1. Normen und ihre Funktion
"Liebe, und dann tu, was du willst!" Dieses Wort des heiligen Augustinus (vgl. Expos. ep. ad Gal. 57 und In ep. Io. tr. 7,8) findet bei vielen Menschen großen Anklang. Alle weiteren Maßstäbe oder Normen scheinen überflüssig zu sein, zumal auch Jesus selbst als oberste Norm die Liebe verkündet hat. Genügt es nicht, auf die Liebe hinzuweisen und dann jedem einzelnen zu überlassen, welche persönlichen Konsequenzen er daraus für sein Leben ziehen will? Was brauchen wir außer der Liebe noch weitere Normen? Sind sie nicht eine Einengung unserer Freiheit und unserer Entfaltungsmöglichkeiten?
Solche und ähnliche Fragen werden heute oft gestellt. Was sind Normen, und welche Bedeutung haben sie für das Leben des Menschen?
Das Wort "Norm" ist eine Übersetzung des lateinischen "norma" und bedeutet eigentlich einen Maßstab, an dem etwas gemessen wird. Ursprünglich gehört das Wort "Norm" nicht zum christlichen Sprachgebrauch. Die Heilige Schrift verwendet eher solche Begriffe wie Gesetz, Weisung oder Gebot. Erst seit dem 19. Jahrhundert ist auch in der Ethik von "Norm" die Rede. In ihr wird "Norm" definiert als Ausdruck der Vernunftordnung, nach der die menschliche Freiheit sich auf das Gute hin ausrichtet. Sie mißt und bestimmt die Akte des freien Willens; sie legt sich dem freien Willen verpflichtend als vernunftgemäße Richtschnur für sein sittliches Handeln auf.
Normen sind somit Maßstäbe, an denen wir unser Verhalten ausrichten und orientieren sollen. Sie begegnen uns als Prinzipien, Verhaltensregeln, Verbote, Gebote, Gesetze und Weisungen.
Im weitesten Sinne sind Normen als Prinzipien bzw. als Verhaltensregeln zu verstehen, die das oberste Moralprinzip "Das Gute ist zu tun, das Böse ist zu meiden" widerspiegeln. So etwa die Goldene Regel: "Was du nicht willst, daß man dir tu, das füg auch keinem andern zu." In der philosophischen Ethik der Stoa lautet das oberste Prinzip: "Jedermann handle jederzeit nach der vernünftigen Natur der Dinge." Immanuel Kant formuliert es so: "Handle so, daß die Maxime deines Willens jederzeit zugleich zum Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung werden kann" (Kategorischer Imperativ oder Verallgemeinerungsprinzip). In der theologischen Ethik oder Moraltheologie ist oberstes Prinzip: "Handle stets nach dem Willen Gottes!" Dieses Prinzip drückt sich aus in der obersten Verhaltensregel des Liebesgebotes als Zusammenfassung und Maßstab aller Einzelgebote.
Davon sind im engeren Sinne solche Normen zu unterscheiden, die einzelne Lebensbereiche betreffen. Sie sind als Gebote, Verbote, Gesetze und Weisungen formuliert. Zu ihnen gehören vor allem die Zehn Gebote, aber auch rechtliche Regeln und Normen gesellschaftlichen Zusammenlebens. Sie sind Anwendungen der allgemeinen Prinzipien, sagen aber noch nichts darüber aus, wie der Mensch in einer konkreten Situation ein Gebot oder ein Verbot zu verwirklichen hat. Das gilt selbst für solche Gebote, die als Verbote formuliert sind und den Anspruch erheben, immer und unter allen Umständen zu gelten.
Im engen Sinne schließlich werden unter Normen jene konkreten Handlungsnormen verstanden, die auf Grund eines sittlichen Urteils angeben, wozu der einzelne in einer konkreten Handlungssituation verpflichtet ist. Die Findung und Begründung solcher Normen setzt Sacheinsicht, sittliche Einsicht, Liebe zur Wahrheit, Urteilsfähigkeit, Klugheit und ein geformtes Gewissen voraus, das bemüht ist, nach der Wahrheit zu suchen und sich an ihr zu orientieren.
1.2. Die Bedeutung sozialer Normen
Soziale Normen haben die Aufgabe, das Leben in der Gesellschaft zu regeln.
So bestimmen etwa die Regeln der Straßenverkehrsordnung, wie wir uns auf öffentlichen Straßen zu verhalten haben, damit der Verkehr reibungslos und ohne Schädigung der Verkehrsteilnehmer ablaufen kann. Die Straßenverkehrsordnung, die in verschiedenen Ländern durchaus unterschiedlich sein kann, enthält Hinweis-, Gebots- und Verbotsregeln. Diese appellieren an unsere Einsicht und an unsere Bereitschaft, ihnen zu folgen. Wer sie übertritt, muß mit Ermahnung oder Bestrafung rechnen. Allerdings ist der Gesetzgeber verpflichtet, nur solche Normen zu erlassen, die sinnvoll und anwendbar sind. Nur so können sie Anspruch auf Geltung erheben, denn nur so schränken sie die Freiheit des Menschen nicht willkürlich ein.
Nicht alle Normen des sozialen Lebens sind durch den Gesetzgeber erlassen. Normen, die Sitte und Brauchtum regeln, sind Ausdruck menschlicher Gesittung in den einzelnen Kulturen. Sie werden von Generation zu Generation als Verhaltensregeln für bestimmte Gelegenheiten und Situationen weitergegeben: als Tischsitten, Höflichkeitsregeln, Hochzeits- und Begräbnisbräuche und vieles mehr. In solchen Sitten und Gebräuchen wird, oftmals über lange Zeit, die Erfahrung eines guten Zusammenlebens vermittelt. Allerdings besteht bei solchen Verhaltensregeln auch die Gefahr, daß sie innerlich ausgehöhlt werden. Heute sind viele Sitten und Bräuche in eine Krise geraten, weil manches Überkommene nicht mehr überzeugt oder nicht verstanden wird. Andererseits bemühen sich aber auch viele Gruppen bewußt um die Pflege überkommenen Brauchtums, weil darin wertvolles Kulturgut weitergegeben wird.
Auch die Mode ist eine Norm, die unser Leben mitbestimmt. Die Mode wechselt häufig. Das Anziehende an ihr ist der Reiz des Neuen. Es kann allerdings auch leicht zu Modediktaten kommen.
Für viele Menschen ist ein ungeschriebener Verhaltenskodex in Gruppen und Zusammenschlüssen von großer Bedeutung, so für Vereine, Berufe oder Verbände. Solche Normen sind hilfreich und wertvoll, dürfen jedoch nicht zum Gruppenzwang werden, der die Freiheit einengt.
1.3. Die Eigenart ethischer Normen
Bei ethischen Normen geht es nicht um Regeln, die so oder auch anders lauten können. Sie sind eindeutig und gelten unbedingt. An ihrer Befolgung entscheidet sich, ob wir als Menschen vor uns selber, vor den Mitmenschen und vor Gott bestehen können. Ihr Anspruch ist unausweichlich.
In der Entscheidung zum Tun dessen, was ethische Normen vorschreiben, entscheidet sich der Mensch für das Gute. Normen, die uns sagen, was wir zu tun oder zu lassen haben, sind mit Markierungen zu vergleichen. Sie helfen uns, den rechten Weg zu gehen, und warnen uns vor Irrwegen.
Ethische Normen sind als Gebote, als Verbote oder als Bedingungssätze formuliert. In ihnen spiegelt sich das Lebenswissen vieler Generationen wider. Als Gebote sind sie Wegzeichen zu einem gelingenden Leben; als Verbote stecken sie den Raum der Freiheit für die Verwirklichung von Werten und Gütern ab. Als Bedingungssätze geben sie die Bedingung an, die erfüllt sein muß, damit ein bestimmtes Ziel erreicht wird (wie etwa: Wenn du in der Gesellschaft Gerechtigkeit erreichen willst, dann wende dich besonders der Sorge für die Armen zu).
Manche meinen, Moral bestehe nur aus Verboten. Wer so denkt, verkennt den Sinn der Verbote, denn diese wollen uns nicht in unserer Freiheit einengen, sondern sie wollen uns auf den Raum des Guten lenken, in welchem wir in verantwortlicher Freiheit unser Leben menschenwürdig gestalten sollen. Niemals sind ethische Normen, ob sie als Gebote, als Verbote oder als Bedingungssätze formuliert sind, Zweck an sich; sie haben nur im Zusammenhang mit dem Menschsein des Menschen Sinn.
Wenn es somit bei den ethischen Normen um verbindliche Orientierungen für ein human gelingendes Leben geht, dann ist ihre Mißachtung sittlich falsch und sittlich schlecht.
Ethische Normen gründen immer in Werten. Als Wert bezeichnen wir das, was für den Menschen in den verschiedenen Lebensbereichen bedeutsam und sinnvoll ist. Der sittliche Wert ist in freiem und verantwortlichem Handeln anzustreben. Das Gelingen des menschlichen Lebens hängt wesentlich davon ab, ob jemand sich in den einzelnen Wertbereichen bewährt und sein Leben so gestaltet, daß es den Grundgesetzen des Menschseins entspricht. Ethische Normen geben in den einzelnen Lebensbereichen den Rahmen an, in welchem der Mensch bleiben muß, um den verpflichtenden Wert zu verwirklichen. So gibt es Normen, die unser Verhalten gegenüber Gott regeln sollen; ferner Normen, die dem Schutz des menschlichen Lebens zuzuordnen sind; andere, die sich auf die rechte Gestaltung der Geschlechtlichkeit beziehen; wieder andere, in denen es um ein menschenwürdiges Leben in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik geht. Hier muß sich bewähren, was uns als Chance und Aufgabe von Gott zugedacht ist. Normen haben somit darin ihren Sinn und Grund, daß sie den Rahmen bestimmen, in welchem wir unser Dasein gestalten sollen und dadurch zur Erfüllung unseres Lebens kommen.
1.4. Ethische und rechtliche Normen
Weil ethische Normen in ethischen Werten gründen, verpflichten sie im Gewissen, sie sind unbedingt zu befolgen. Bei rechtlichen Normen, in denen es um ein geordnetes Zusammenleben in einem Gemeinwesen geht, kommt zur ethischen Dimension noch eine rechtliche hinzu. Ähnlich wie Sätze der Moral sind Sätze des Rechts Aussagen über etwas, das sein soll; auch sie beanspruchen, daß sie befolgt werden. Der rechtliche Charakter der Norm besagt, daß sie einklagbar und erzwingbar ist; ihre Übertretung ist mit Sanktionen und Strafen belegt.
Rechtsordnungen haben die Aufgabe, das Zusammenleben der Menschen in Gesellschaft und Staat zu regeln, und tragen so zum Gemeinwohl bei. Für die Ordnung des Gemeinwohls sind das Staatsvolk und in seinem Auftrag Regierung und Parlament zuständig. Letzteres erläßt Gesetze, die Ordnung und Recht garantieren sollen. Die vom menschlichen Gesetzgeber erlassenen Rechtsnormen sind meistens schriftlich formuliert. Sie sind positive Gesetze im Unterschied zum Naturgesetz, das sich aus der Wesensbestimmung des Menschen selbst ergibt. Am Naturgesetz, das nicht erlassen, sondern vorgefunden wird, sind alle positiven Gesetze auszurichten.
Die komplizierten Verhältnisse des modernen gesellschaftlichen Lebens machen eine große Zahl von Gesetzen notwendig. Diese haben zwar in der Rechtsordnung, deren tragender Grund die Verfassung ist, nicht alle den gleichen Stellenwert, aber grundsätzlich ist davon auszugehen, daß gesetzliche Vorschriften auch einen Anspruch an das Gewissen erheben.
Das Verhältnis zwischen ethischen und rechtlichen Normen kann folgendermaßen bestimmt werden:
- Das Ethos und die in ihm angestrebten Grundhaltungen des Gemeinsinns und der Verantwortung für das Ganze bilden die Grundlage für das Gelingen des Zusammenlebens in einem Gemeinwesen. Ohne Bejahung und Verwirklichung ethischer Werte kann eine Rechtsordnung nicht auf Dauer funktionieren.
- Der Bereich ethischer Verpflichtung ist umfassender als der, der in staatlichen Gesetzen umschrieben ist. Nicht alles, was ethisch verpflichtend ist, muß staatlich-rechtlich eingefordert werden. Allerdings kann sich mit dem Wachsen des Ethos in der Gesellschaft auch das Rechtsbewußtsein weiterentwickeln. Das zeigt sich heute etwa in der Umweltproblematik. Sie ist so stark im ethischen Bewußtsein verankert, daß der Gesetzgeber sich verpflichtet sieht, entsprechende Rechtsnormen zu erlassen, die ein bestimmtes Umweltverhalten einfordern und Verstöße mit Strafen belegen. Umgekehrt muß nicht alles, was ethisch zu verurteilen ist, rechtlich geahndet werden. Der Gesetzgeber kann in manchen Bereichen auf eine strafrechtliche Verfolgung verzichten. Das darf aber keine Konsequenzen für die ethische Bewertung haben. Daraus, daß zum Beispiel Ehebruch nicht unter rechtlicher Strafandrohung steht, ergibt sich nicht, daß Ehebruch erlaubt ist. Ebensowenig kann die Tötung des Kindes im Mutterleib, die als Tötung menschlichen Lebens sittlich schlecht ist und rechtlich mißbilligt wird, aber unter bestimmten Voraussetzungen vom Staat nicht strafrechtlich verfolgt wird, als rechtlich und sittlich erlaubt angesehen werden.
- Veränderungen in den Rechtsnormen wirken sich auf das ethische Bewußtsein und auf das ethische Verhalten aus, im Guten wie im Bösen. Daraus ergibt sich, daß die Rechtsordnung eine ethische Wertorientierung braucht und daß umgekehrt das Ethos der Stütze durch die Rechtsordnung bedarf. Es ist die Aufgabe jedes einzelnen und aller verantwortlichen Kräfte in der Gesellschaft, dafür zu sorgen, daß die fundamentalen Werte wachgehalten werden, wie es Aufgabe des Gesetzgebers ist, dafür zu sorgen, daß die in den Werten gründenden Rechte geschützt werden.
2. Normen als Gebot Gottes und als Gebot der Vernunft
2.1. Gott als tragender Grund des Ethos
Die Einsicht, daß Normen verbindliche Orientierungen sind, hat dazu geführt, daß alle Völker und Kulturen eine sittliche Ordnung anerkennen, die für alle Mitglieder der Gesellschaft verpflichtend ist. Worin ist der letzte Grund der sittlichen Ordnung und ihrer Normen zu sehen?
Die Geschichte des alttestamentlichen Gottesvolkes zeigt uns, daß Quelle und letzter Grund der sittlichen Ordnung und ihrer Gebote Gott selbst ist. Er hat sein Volk befreit und erwählt und ihm im Sinaibund sein Gesetz gegeben. Die Thora, die Weisung Gottes, ist Heilsgabe Gottes. An den Zehn Geboten soll sich das Gottesvolk auf seinem Weg mit Gott orientieren. Im Anspruch der Gebote begegnet es Gott. Das ist die Grundstruktur allen gläubig-sittlichen Handelns. Weil Gott den Menschen erschaffen und ihm die Grundforderung des Sittengesetzes als verbindliches Gesetz eingeschrieben hat und weil er dem Volk im Bund seine Weisung gegeben hat, kann es gläubig-sittliches Handeln nur als Handeln vor Gott geben (vgl. dazu VS 35-53).
Im Neuen Bund hat das Ja Gottes zu den Menschen in Jesus Christus greifbare Gestalt angenommen (vgl. 2 Kor 1,19f). Jesus lebt und verkündet ein Ethos, das den Menschen in neuer und tieferer Weise zu Gott und damit zu sich selbst kommen läßt. Er hebt die Gebote nicht auf, sondern stellt sie in einen neuen Zusammenhang von Erlösung und Befreiung. Die Erlösung, die er schenkt, ist die Befreiung von den Mächten des Bösen und von der Macht des Todes. Wer sich an ihn, an sein Wort und an seine Weisung hält, trägt zum Heil der Menschen und zu seinem eigenen Heil bei.
Nach christlichem Glauben hat somit das Ethos seinen letzten tragenden Grund in Gott selbst. In jedem Gebot und in jeder sittlichen Tat geht es um den Menschen und um seinen Weg mit Gott. Mitte des Ethos ist die Liebe. Wo das Verhalten des Menschen nicht von der Liebe getragen ist, da ist es nichts, mögen die äußeren Werke auch noch so bedeutend sein (vgl. 1 Kor 13).
Das gesamte christliche Ethos hat im Glauben, der in der Liebe wirksam wird, seinen Einheitsgrund und seine Mitte.
2.2. Sittliche Einsicht aus dem Glauben und aus der Vernunft
Der Glaube vermittelt uns die wesentlichen Einsichten über Gott als tragenden Grund des Sittlichen und über Gottes Weisung zur Gestaltung des religiös-sittlichen Lebens. Die sittlichen Weisungen der Offenbarung wollen aber eine Moral nicht nur für Glaubende sein, sondern sie richten sich ihrer Substanz nach an alle Menschen. Sie müssen daher auch der menschlichen Einsicht grundsätzlich zugänglich sein. Wie verhalten sich sittliche Einsicht aus dem Glauben und sittliche Einsicht aus der Vernunft zueinander?
Glauben bedeutet, einen Weg gehen. Im Glauben antworten wir auf die Selbstoffenbarung Gottes. In diese Antwort geht der Mensch mit seinem ganzen Leben ein. Im Glauben gewinnt der Mensch eine neue Sicht der Welt. Sein eigenes Menschsein geht ihm tiefer auf.
Im Glauben wissen wir, daß wir als Abbild Gottes erschaffen sind, ihm ähnlich. Das bedeutet, daß der Mensch als Bild Gottes die Herrschaft Gottes in der Welt repräsentiert. Diese Herrschaft ist keine Willkürherrschaft, sondern will den Geschöpfen wohl; sie ist auf die Bewahrung und Gestaltung der Schöpfung gerichtet. Die Aufforderung, über die Erde zu herrschen, besagt, daß der Mensch auch für die Erhaltung der Schöpfung mitverantwortlich ist. Er soll so mit ihr umgehen, wie es der Fürsorge entspricht, die Gott seiner Schöpfung angedeihen lassen will.
Als Abbild Gottes, als Vernunft- und Freiheitswesen ist der Mensch befähigt und berufen, für die Welt Verantwortung zu übernehmen.
Die Fähigkeit des Menschen, mit seiner Vernunft die Wirklichkeit zu erkennen und sie zu gestalten, ist nicht ungetrübt geblieben. Die Sünde schwächt die Wahrnehmung der Wirklichkeit und die Bereitschaft, sie so zu gestalten, wie es Gottes Weisheit und Willen entspricht. Trotzdem behält der Mensch grundsätzlich die Fähigkeit, das Gute zu erkennen und es mit Gottes Hilfe auch zu tun. "Obwohl die Gebote des Dekalogs schon der Vernunft einsichtig sind, wurden sie geoffenbart. Um zu einer vollständigen und sicheren Erkenntnis der Forderungen des natürlichen Gesetzes zu gelangen, bedurfte die sündige Menschheit dieser Offenbarung" (KKK 2071). Gott zeigt ihm sein Gebot als Wegweisung zum Leben. Es soll ihm eine Hilfe sein, so zu leben, wie es seiner Würde und dem Willen Gottes entspricht.
Nach kirchlicher Lehre wird das ewige Gesetz, das in Gottes Weisheit begründet ist und jedes Wesen auf sein Endziel hinordnet, sowohl durch die übernatürliche Offenbarung (so heißt es "göttliches Gesetz") als auch durch die natürliche Vernunft des Menschen (dann heißt es "Naturgesetz") erkannt (vgl. KKK 2071; VS 72).
In der kirchlichen Lehre über das Gesetz wird deutlich, daß die verschiedenen Ausdrucksformen, in denen von "sittlichem oder moralischem Gesetz" die Rede ist, alle aufeinander abgestimmt sind: "das ewige Gesetz, der göttliche Ursprung aller Gesetze; das natürliche Sittengesetz; das geoffenbarte Gesetz, das aus dem alten Gesetz und dem neuen Gesetz des Evangeliums besteht; schließlich die staatlichen und kirchlichen Gesetze" (KKK 1952).
Wie sehr dieses in der Offenbarung vermittelte Ethos ein zutiefst humanes Ethos ist, dessen Einsicht und Verpflichtung allen Menschen offensteht, deutet der Apostel Paulus im Brief an die Römer an. Menschen, die nicht um das geoffenbarte Gesetz Gottes wissen, aber "von Natur aus" tun, was im Gesetz gefordert ist, handeln entsprechend dem Gesetz ihrer Natur, das sie "im Herzen", das heißt in ihrem Gewissen als Gesetz Gottes wahrnehmen können.
- "Wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, von Natur aus das tun, was im Gesetz gefordert ist, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. Sie zeigen damit, daß ihnen die Forderung des Gesetzes ins Herz geschrieben ist" (Röm 2,14f).
Menschen, die nicht von der Glaubensbotschaft erreicht werden und das Gute tun, zeigen damit, daß sie das Gesetz oder die Norm ihres Handelns in ihrem Gewissen erfahren, daß sie sich selbst Aufgabe sind: Sie sind dazu berufen, ihr Leben entsprechend dem "Gesetz ihrer Natur" zu gestalten.
2.3. Die Natur des Menschen als Quelle und Maßstab sittlichen Handelns
Was bedeutet es für den Menschen, daß er befähigt und verpflichtet ist, nach dem "Gesetz seiner Natur" zu handeln?
In der Naturwissenschaft sprechen wir von Naturgesetzen bei Vorgängen, die nach festen Gesetzmäßigkeiten immer in der gleichen Weise ablaufen. In gewissem Umfang treffen solche Gesetzmäßigkeiten auch beim Menschen zu, denn in seiner Leiblichkeit unterliegt der Mensch in bezug auf bestimmte Vollzüge wie die Naturdinge den Gesetzen der Natur. Der Mensch ist jedoch mehr als nur nach physiologischen und biologischen Gesetzen ablaufende Natur. Seine Natur ist "Natur der menschlichen Person" als Einheit von Seele und Leib. Auf sie bezieht sich das sittliche Naturgesetz als Vernunftordnung, gemäß welcher der Mensch vom Schöpfer dazu berufen ist, sein Leben und seine Handlungen zu lenken und zu regeln (vgl. VS 50). Es ist somit sittliche Aufgabe des Menschen, nach dem Gesetz seiner Vernunftordnung zu handeln und sich dabei vom Maßstab der Natur der menschlichen Person leiten zu lassen. So ist das Gesetz der "Natur der menschlichen Person" zugleich Quelle und Maßstab des sittlichen Handelns. Das Gesetz, das ihm von Gott eingegeben ist, nach dem er zu leben hat und nach dem sein Leben gelingen kann, entdeckt er in sich selbst. Dieses Naturgesetz bringt die Würde der menschlichen Person zum Ausdruck; es ist Grundlage für ihre fundamentalen Rechte und Pflichten; es ist in seinen Geboten universal, und seine Autorität erstreckt sich auf alle Menschen (vgl. VS 51).
Bei der sittlichen Gestaltung seines Lebens muß der Mensch beachten, daß es Wertausrichtungen und Zielgüter gibt, die seinem Handeln in seiner Natur vorgegeben sind und zu denen er sich natürlicherweise hingezogen fühlt. Diese Neigungen haben ihre Grundlage in der leib-geistigen Verfassung des Menschen: das natürliche Streben nach Selbsterhaltung, Fortpflanzung und Fürsorge, die Neigung, das Wahre zu erkennen, das Gute zu tun und in Gemeinschaft zu leben. Solche naturgegebenen Neigungen darf der Mensch bei der Findung und Begründung sittlicher Normen nicht mißachten, er darf aber in ihnen keine unmittelbaren Handlungsnormen sehen. "Tatsächlich gewinnen die natürlichen Neigungen nur insofern sittliche Bedeutung, als sie sich auf die menschliche Person und ihre authentische Verwirklichung beziehen, die andererseits immer und nur im Rahmen der menschlichen Natur zustande kommen kann" (VS 50). Deshalb muß der Mensch versuchen, in ihnen die humanen Möglichkeiten ihrer Gestaltung zu entdecken und im Leben zu verwirklichen.
Solche humanen Möglichkeiten finden sich auch im Verhältnis zu den Mitmenschen, zur Schöpfung und zu den Institutionen und Strukturen des technischen, wirtschaftlichen und politischen Lebens. In allen diesen Bereichen und Bezügen müssen wir uns darum bemühen, daß unser Verhalten mit der Sinnausrichtung unseres Menschseins übereinstimmt. Je besser uns dies gelingt, um so mehr werden wir unserem Menschsein gerecht.
In dieser Einsicht der Vernunft und in diesem Bemühen sind die Christen verbunden mit allen Menschen guten Willens, die eine immer größere Humanisierung der Welt zu erreichen suchen. Verständnisbrücke ist dabei die Vernunft. Was in der Vernunfteinsicht als verpflichtende Norm erkannt wird, erhebt den Anspruch, unbedingt befolgt zu werden. Dieser Anspruch gilt für den Nichtglaubenden gleichermaßen wie für den Glaubenden. Die als verpflichtend erkannte Norm bindet den Menschen im Gewissen.
Das in der Vernunfteinsicht erkannte natürliche Sittengesetz, daß das Gute zu tun und das Böse zu meiden ist, kann von allen Menschen als festes Fundament erkannt werden, auf welchem ein Gebäude von moralischen Regeln aufgebaut ist, welche die sittlichen Entscheidungen leiten sollen. Auch diese Regeln können als Anwendungen des natürlichen Sittengesetzes grundsätzlich von allen Menschen erkannt werden. Da jedoch die Gebote des natürlichen Gesetzes nicht von allen Menschen klar und unmittelbar wahrgenommen werden, sind dem sündigen Menschen in seiner jetzigen Verfaßtheit Gnade und Offenbarung notwendig, damit sie "von allen ohne Schwierigkeit, mit sicherer Gewißheit und ohne Beimischung eines Irrtums erkannt werden" können (DS 3876; KKK 1960).
"Das sittliche Naturgesetz verschafft dem offenbarten Gesetz und der Gnade eine Grundlage, die von Gott gelegt und dem Wirken des Heiligen Geistes angemessen ist" (KKK 1960). Das "alte Gesetz" (das Gesetz des Alten Bundes) ist ein unvollkommenes Gesetz; das "neue Gesetz" (das Gesetz des Evangeliums) ist die vollendete irdische Gestalt des natürlichen und geoffenbarten göttlichen Gesetzes (vgl. KKK 1965). Es ist das Gesetz der Liebe.
2.4. Unbedingter Geltungsanspruch und geschichtliche Gestalt von Normen
Warum erheben sittliche Normen den Anspruch, unbedingt befolgt zu werden? Der Mensch ist von Gott zum Menschsein berufen. Da es in ethischen Normen immer um das Menschsein des Menschen geht, ist all das als unabdingbare Forderung anzusehen, was mit Sicherheit zur Erfüllung des Menschseins notwendig ist. Deshalb haben zum Beispiel die Forderungen nach Gerechtigkeit und Liebe unbedingte Geltung. Sie gelten für alle Menschen, da sie in einem unverzichtbaren Zusammenhang mit der Verwirklichung des Menschseins stehen. Die Unbedingtheit, das heißt, die absolute Geltung ethischer Normen erwächst letztlich daraus, daß sie aus der Gutheit Gottes hervorgehen, als dessen Abbild der Mensch geschaffen ist und in dem er seine Vollendung findet.
Dieser unbedingte Geltungsanspruch ethischer Normen stellt uns aber auch vor die Frage, ob Weisungen einer früheren Zeit noch verpflichtende Orientierungen für den heutigen Menschen sein können bzw. ob sie in ihrer Formulierung ausnahmslos für jede Situation zutreffen. Normen bedürfen immer der Auslegung und der richtigen Anwendung. Dabei stellt sich manchmal heraus, daß einzelne Regelungen früherer Zeiten (zum Beispiel solche, die den Stand der Sklaven betrafen) heute keine Geltung mehr haben können.
Es kommt auch vor, daß Normen unter sich ändernden Umständen nicht mehr den Wert schützen helfen, für dessen Verwirklichung sie ursprünglich formuliert worden sind. Hier kann ein Wandel der Verhältnisse auch zum Wandel oder gar zum Wegfall einer früher geltenden Norm führen. So konnte in bestimmten natural-wirtschaftlichen Systemen das Zinsnehmen zu Mißbrauch und Erpressung führen, während es in anderen Wirtschaftssystemen durchaus gerecht ist, nämlich immer dann, wenn geliehenes Geld "fruchtbar" wird und Zinsen abwirft.
Der unbedingte Geltungsanspruch von Normen schließt nicht aus, daß Güter, die durch eine Norm geschützt werden sollen, miteinander in Konkurrenz geraten. Bei der sittlichen Urteilsbildung muß dann bedacht werden, welchem Gut im einzelnen der Vorrang zu geben ist.
Auch die Art und Weise, wie der Mensch in verschiedenen Lebensbereichen gesehen wird, kann sich wandeln. So gibt es zwischen der Sicht der menschlichen Sexualität zur Zeit des heiligen Augustinus oder des Thomas von Aquin und der Sicht des Zweiten Vatikanischen Konzils große Übereinstimmungen, aber es gibt auch deutliche Unterschiede. Letztere spiegeln die Erweiterung medizinischer und anthropologischer Erkenntnisse, aber auch kulturelle Erfahrungen wider, die auf die Bewertung der Sexualität und der Ehe großen Einfluß gewonnen haben. Eine Humanisierung der menschlichen Sexualität und der ehelichen Gemeinschaft, wie sie das Zweite Vatikanische Konzil aufzeigt, hätten Augustinus oder Thomas von Aquin und sogar das kirchliche Rechtsbuch von 1917 so noch nicht sehen können. Daran wird deutlich, daß das Ethos in unterschiedlichen geschichtlichen Stadien eine unterschiedliche Gestalt gewinnt, in der Bewährtes bewahrt wird und Neues sich bewährt.
Wie sehr es auch zu Wandlungen im Ethos und in Normen kommt, die Gebote Gottes selbst beziehen sich auf so fundamentale Werte, daß unser Menschsein gefährdet ist, wenn wir uns nicht an sie halten. Ihre Auslegung ist in der Geschichte wechselvoll und manchmal auch dunkel gewesen. Indem sich die Kirche aber immer an sie zurückgebunden wußte, konnte sie sich nie von ihnen abwenden.
Wir leben heute in einer Zeit großer Umbrüche des Empfindens, Denkens und Wertens. In der Vielfalt der Meinungen, Anschauungen und Überzeugungen ist es nicht immer einfach, das herauszufinden, was vor Gott sittlich gut und richtig ist. Hier müssen wir uns auf die Quellen des Glaubens und auf die sittlichen Überzeugungen des ganzen Gottesvolkes besinnen. Wo ein erweitertes Verständnis und eine vertiefte Auslegung von bisher geltenden Normen notwendig ist, muß immer der Wert beachtet werden, der geschützt werden soll (vgl. dazu VS 53). Ein Beispiel dafür gibt uns das Zweite Vatikanische Konzil in der Frage der Religions- und Gewissensfreiheit. Nach der früheren Auffassung wurde dem subjektiv Irrenden zu wenig Rechnung getragen. Hier hat die Neuorientierung nicht den Sinn gehabt, bleibende Moralprinzipien aufzuweichen, sie hat vielmehr in einer fälligen Neuinterpretation den Anspruch des Evangeliums deutlicher vernehmbar gemacht und seine Verbindlichkeit in grundlegenden Menschenrechtsnormen klargestellt
3. Menschenrechte als Maßstab für ein menschenwürdiges Leben
3.1. Was sind Menschenrechte?
Menschenrechte spielen in Gesellschaft und Staat sowie in internationalen Beziehungen eine große Rolle. Nicht nur weltliche Organisationen, sondern auch Religionsgemeinschaften, christliche Kirchen und kirchliche Gemeinschaften geben Erklärungen zu den Menschenrechten ab und fordern ihre Einhaltung und Durchsetzung. Was sind Menschenrechte? Träger von Rechten im eigentlichen Sinne ist der Mensch, weil er Person ist. Er hat die Fähigkeit und das Recht, sich selbst zu bestimmen; er ist der Herr über sein Tun.
Da der Mensch in einem sozialen Zusammenhang lebt, betrifft sein Tun immer auch andere Menschen und deren Rechte. An den Rechten anderer hat das Recht des einzelnen seine Grenze (vgl. PT 9).
Nicht jedes Recht ist als Menschenrecht zu bezeichnen. Mit Menschenrechten sind solche Rechte gemeint, deren Gewährleistung für eine menschenwürdige Existenz fundamentale Bedeutung hat. Sie hängen unmittelbar mit dem Menschsein zusammen. Deshalb sind sie unveräußerlich und unantastbar.
Menschenrechte werden nicht erworben, sondern sie sind dem Menschen mit seinem Menschsein gegeben. Das heißt: Sie werden ihm nicht von der Gesellschaft zuerkannt oder gewährt, er besitzt sie vielmehr als vorgesellschaftliche und vorstaatliche Rechte. Sie sind unveräußerlich und unantastbar. So besitzt der einzelne sein Recht auf Leben nicht dadurch, daß es ihm von der Gesellschaft zuerkannt wird, sondern dadurch, daß er Mensch ist. Daraus ergibt sich die sittliche und rechtliche Forderung nach unbedingtem Respekt vor jedem einzelnen Menschen durch jeden anderen Menschen, durch alle gesellschaftlichen Gruppen und durch die Träger der staatlichen Gewalt.
3.2. Die Entwicklung der Menschenrechtsidee in Gesellschaft und Kirche
Erste Anfänge einer politischen Entwicklung der Menschenrechtsidee finden sich bereits in der heidnischen Antike. Im griechischen Stadtstaat sollten alle Bürger an den Staatsgeschäften teilhaben; da den Sklaven das Bürgerrecht vorenthalten wurde, waren sie aber von einer entsprechenden Teilhabemöglichkeit an politischen Entscheidungen ausgeschlossen. Daher existierte noch keine Rechtsgleichheit für alle Einwohner des Gemeinwesens. Auch das fortentwickelte römische Recht stößt noch nicht zur Idee der Menschenrechte durch. Ähnliches gilt auch für das gesamte Mittelalter. In der alteuropäischen Gesellschaft gab es zwar einen Kampf der Stände um Rechte und Freiheiten einzelner Stände (Standesrechte), nicht aber um persönliche Freiheitsrechte. Das trifft auch noch bis weit in die Neuzeit hinein zu.
Die zweite Epoche der politischen Entwicklung der Menschenrechte setzt ein mit der Auflösung der religiös-politischen Einheit und in den Konfessionskriegen des 16. und 17. Jahrhunderts. Das führte dazu, daß Religionsfreiheit zum Grundrecht im Staat wurde. In Abwehr der ständestaatlichen Ordnung und des absolutistischen Staates werden Freiheit und Rechtsgleichheit eingefordert und durchgesetzt. Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung von 1776 stellt fest, es sei eine aus sich selbst offenkundige Wahrheit, daß alle Menschen gleich geschaffen und vom Schöpfer mit unveräußerlichen Rechten ausgestattet seien. Die Theorie der Menschenrechte und die aus ihr abgeleiteten konkreten politisch-praktischen Schlußfolgerungen führten im Gefolge der Französischen Revolution von 1789 zu weltgeschichtlicher Auswirkung. Seit Ende des Ersten Weltkrieges wurden die Menschenrechte in vielen Verfassungen und Grundrechtskatalogen zu festen Bestandteilen des staatlichen Lebens.
Angesichts der Greueltaten des Nationalsozialismus sowie der Schrecken des Zweiten Weltkrieges setzte sich nach Kriegsende die Forderung nach einer Verankerung des menschenrechtlichen Anliegens auch auf internationaler Ebene durch. Der "Charta der Vereinten Nationen" (1945) folgten die "Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen" (1948) und die beiden Menschenrechtspakte (1966) "über bürgerliche und politische Rechte" sowie "über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte". In der Gegenwart werden diese Rechte immer weiter ausgefaltet und in völkerrechtlich verbindlichen Verträgen zum Schutz der Menschenrechte zusammengefaßt.
In der katholischen Kirche vollzog sich in der Stellung zu den Menschenrechten ein Wandel. Es gab, wie der Päpstliche Rat "Iustitia et Pax" im Dokument "Die Kirche und die Menschenrechte" (S. 8) feststellt, "Zeiten in der Geschichte der Kirche, in denen die Menschenrechte in Wort und Tat nicht mit genügender Klarheit oder Energie gefördert oder verteidigt wurden". Die Kirche gibt zu, daß ihre Haltung "in den letzten zwei Jahrhunderten gegenüber den Menschenrechten nur zu oft durch Zögern, Einsprüche und Vorbehalte gekennzeichnet war. Gelegentlich kam es auf katholischer Seite sogar zu heftigen Reaktionen gegen jegliche Erklärung der Menschenrechte im Lichte des Liberalismus und des Laizismus . . . Das führte manchmal sogar zu offener Feindschaft und Verurteilung" (ebd.), so bei Papst Pius VI., Pius VII., Gregor XVI. und Pius IX.
Eine erste Wende in der Haltung der Kirche begann unter Papst Leo XIII. Eine wachsende Annäherung (Pius XI., Pius XII.) führte zur Anerkennung und Verteidigung der Menschenrechte in der Enzyklika "Pacem in terris" von Papst Johannes XXIII., im Zweiten Vatikanischen Konzil (GS, DH), ferner in den beiden Bischofssynoden von 1971 und 1974 und im Dokument des Päpstlichen Rates "Iustitia et Pax" "Die Kirche und die Menschenrechte" (1975), das die unteilbare Beziehung zwischen Menschenrechten und Menschenpflichten betont.
3.3. Die Begründung der Menschenrechte
In der Gegenwart gibt es Meinungsunterschiede darüber, was zu den Menschenrechten gehört und wie sie zu begründen sind. Nach verbreiteter Auffassung zählen die in der UNO-Erklärung (1948) und in den beiden Menschenrechtspakten (1966) aufgezählten Rechte zu den Menschenrechten. Ein umfassender Katalog dürfte sich aber kaum aufstellen lassen.
Die Begründung der Menschenrechte innerhalb der katholischen Soziallehre nimmt ihren Ausgangspunkt bei der personalen Würde jedes einzelnen. In der Enzyklika "Pacem in terris" heißt es (9f):
- "Jedem menschlichen Zusammenleben, das gut geordnet und fruchtbar sein soll, muß das Prinzip zugrunde liegen, daß jeder Mensch seinem Wesen nach Person ist. Er hat eine Natur, die mit Vernunft und Willensfreiheit ausgestattet ist; er hat daher aus sich Rechte und Pflichten, die unmittelbar und gleichzeitig aus seiner Natur hervorgehen. Wie sie allgemein gültig und unverletzlich sind, können sie auch in keiner Weise veräußert werden."
Mit der Begründung der Menschenrechte in der Personwürde des Menschen erkennt die Kirche jene Bestrebungen und Überlegungen an, die in der geistigen Welt des Humanismus, des rationalistischen Naturrechts und der Aufklärung zum neuzeitlichen Verständnis des Rechts auf Freiheit und Gleichheit geführt haben. Besondere Bedeutung kommt in dieser Entwicklung der "Wende zum Subjekt" zu. Danach gründet die Verbindlichkeit der Menschenrechte im Wesen des Menschen als Subjekt. Der Mensch hat das Recht, als eigenständiges Subjekt mit Eigenwert in einer gemeinsamen Welt mit anderen Menschen zusammenzuleben, frei von jeder Gewalt, frei in seinen Gedanken und Reden, frei in seinen religiösen und politischen Überzeugungen. Der Grund dieses Rechts ist die unantastbare Würde der Person. Aus der Personwürde des Menschen ergeben sich die Prinzipien der Freiheit, der Gleichheit und der Selbständigkeit. Diese bilden die Grundlage für abgeleitete Menschenrechte.
In seinem Dokument "Die Kirche und die Menschenrechte" bietet der Päpstliche Rat "Iustitia et Pax" eine ähnliche Begründung der Menschenrechte, indem er die menschliche Person als Grund, Träger und Ziel aller sozialen Institutionen herausstellt und daraus Freiheitsrechte sowie bürgerliche, politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Rechte ableitet (37f).
Über das philosophische Verständnis der Menschenrechte hinaus bietet der Glaube eine tiefere Begründung der Menschenrechte. Die unbedingte und unantastbare Würde des Menschen, ihre Unbedingtheit und Unantastbarkeit haben ihren letzten Grund in Gott selbst und in der Menschwerdung des ewigen Wortes.
Als Gottes Ebenbild ist jeder Mensch, unabhängig von seiner rassischen oder religiösen Zugehörigkeit, "in seiner Würde wunderbar erschaffen". In Jesus Christus, der als Sohn Gottes Mensch geworden ist, hat Gott den Menschen "noch wunderbarer erneuert". Das Geheimnis der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus wirft neues Licht auf den Menschen und seine Würde. "Tatsächlich klärt sich nur im Geheimnis des fleischgewordenen Wortes das Geheimnis des Menschen wahrhaft auf . . . Christus, der neue Adam, macht eben in der Offenbarung des Geheimnisses des Vaters und seiner Liebe dem Menschen den Menschen voll kund und erschließt ihm seine höchste Berufung" (GS 22). In diesem Sinne erklärt die Enzyklika "Pacem in terris": "Wenn wir die Würde der menschlichen Person aus den Offenbarungswahrheiten betrachten, müssen wir sie noch viel höher einschätzen. Denn die Menschen sind ja durch das Blut Jesu Christi erlöst, durch die göttliche Gnade Söhne und Freunde Gottes geworden und zu Erben der ewigen Herrlichkeit berufen" (10).
In dieser Berufung sind die Menschen in eine Freiheitsgeschichte hineingenommen, in der die Sorge um den Schutz und die Verteidigung der Menschenrechte zum Dienst der Liebe, der Gerechtigkeit und der Versöhnung wird. Wenn auch die Vollendung des Menschen und der Welt noch aussteht und von Gott her zu erwarten ist, so schwächt die Hoffnung auf die Erfüllung doch den Einsatz für die Menschenrechte nicht ab, sondern verleiht ihm ein tieferes Motiv und eine neue Anregung (vgl. GS 39).
In dieser umfassenden theologischen Sicht werden die Menschenrechte in einer spezifisch christlichen Interpretation auf ihren eigentlichen Ursprung zurückgeführt. Aufgabe der Kirche ist es, alle Menschen zur vollen Teilnahme am Christusgeheimnis zu führen, von einer ganzheitlichen Sicht des Menschen her die Grundwerte der Freiheit, des Friedens und der Gerechtigkeit in Solidarität zu fördern und so auch auf politischem Gebiet eine wahrhaft prophetische Sendung auszuüben. Deshalb hat sie im sozialen Bereich für Gerechtigkeit einzutreten und überall, wo Ungerechtigkeit herrscht, die Menschenrechte einzuklagen. Je mehr sie in sich selbst die Grundwerte und Grundrechte achtet und eine Kirche mit einem menschlichen Antlitz ist, um so mehr wird ihr Zeugnis für die Verwirklichung der Menschenrechte in der Gesellschaft glaubwürdig.
3.4. Heutige Aufgliederung der Menschenrechte
Ein Blick in die Kataloge der Menschenrechte zeigt, daß die in ihnen aufgeführten Inhalte immer konkreter und ausführlicher geworden sind. Das Recht auf Freiheit und Selbstbestimmung schlägt sich in vielen einzelnen Rechten nieder. Ebenso sind die sozialen Rechte immer mehr ausgeweitet worden. In dieser Richtung wirkte auch die Kirche. So hat sie zum Beispiel eine "Charta der Familienrechte" entwickelt, die im Jahre 1983 allen Personen, Institutionen und Autoritäten übergeben wurde, die mit der Sendung der Familie in der heutigen Welt befaßt sind.
Die Ausweitung des Begriffsinhalts der Menschenrechte soll das Bewußtsein der Menschen für die jeweils anstehenden Aufgaben in den einzelnen Bereichen stärken. Man unterscheidet heute in der Regel drei "Generationen" von Menschenrechten. Über die rein individuellen Freiheitsrechte sowie die sozialen, ökonomischen und kulturellen Rechte hinaus sollen Solidaritätsrechte die Weltverantwortung der Menschen betonen. Zu den Freiheitsrechten gehören etwa das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, auf freie Entfaltung der Persönlichkeit; auf Religions-, Glaubens- und Gewissensfreiheit; Meinungs- und Pressefreiheit; Freiheit der Kunst und der Wissenschaft; Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit; Freiheit der Berufswahl; Recht auf persönliches Eigentum; Recht auf Heimat; Asylrecht; Petitionsrecht, Anspruch auf rechtliches Gehör. Zu den sozialen, ökonomischen und kulturellen Rechten gehören etwa das Recht auf freies Unternehmertum, Mitbestimmung, gerechten Lohn, Erholung, Bildung, Teilnahme am kulturellen Leben, Altersversorgung, Wohnraum. Mit den Solidaritätsrechten sind vor allem diese Rechte gemeint: das Recht auf Frieden, auf Kommunikation, auf kulturelle Verschiedenheit und Eigenständigkeit, auf eine ökologisch verträgliche Umwelt, auf Teilhabe am gemeinsamen Erbe der Menschheit, auf Entwicklung und auf Selbstbestimmung der Völker. In diesen Rechten spiegelt sich ein wachsendes Bewußtsein von Solidarität mit den Menschen in aller Welt und ein tiefes Verlangen nach Gerechtigkeit wider.
Die bedrückende Erfahrung der Armut in der Welt, die Ungleichheit zwischen den reichen und armen Völkern, die fehlenden Entwicklungschancen in wirtschaftlich unterentwickelten Regionen und das wirtschaftliche Gefälle in und zwischen den Staaten lassen viele Menschen unserer Zeit nicht gleichgültig. Gerechtigkeit als leitendes Prinzip von Rechten aller Menschen und Völker macht nicht nur neue Einstellungen und Grundhaltungen erforderlich, sondern auch eine Umstrukturierung von Institutionen und eine bessere Weltwirtschaftsordnung. All dies schlägt sich in der kirchlichen Verkündigung auch im Begriff der Entwicklung nieder, wie ihn die neueren Sozialenzykliken herausgestellt haben (vgl. PP, LE, SRS). Der Weg führt von einem vorrangig wirtschaftlichen zu einem umfassenden Verständnis, das in die Forderung nach weltweiter Solidarität mündet.
Auch die Vereinten Nationen haben das Recht auf Entwicklung als ein unveräußerliches Menschenrecht bezeichnet (1981) und Entwicklung als "Entfaltung der menschlichen Person in Einklang mit der Gemeinschaft" umschrieben. Dieses "Recht auf Entwicklung" ist ein Solidaritätsrecht, das aus dem Prinzip der internationalen Solidarität hervorgeht. Diese schließt eine dynamische Verwirklichung von Gerechtigkeit in der Welt ein, fordert die Beseitigung der "strukturellen Ungerechtigkeit" und den Aufbau internationaler Sozial- und Wirtschaftsbeziehungen, die sich an den Menschenrechten ausrichten.
Die Menschenwürde als tragendes Fundament und die Menschenrechte als leitende Prinzipien des Handelns bilden somit nicht nur für den einzelnen, sondern auch für die Gesellschaft und ihre Institutionen die Basis und die Maßstäbe, an denen sich das sittliche Verhalten zu orientieren hat. Dieses ist heute auf die Bewältigung unzähliger Probleme gerichtet, zu deren Lösung Gerechtigkeit und Liebe gleichermaßen gefordert sind. Der von der Liebe geleitete Wille, jedem sein Recht zukommen zu lassen, muß sich über das Wohl-wollen in das Wohl-tun umsetzen. Es ist unsere Aufgabe, nach dem zu suchen, was jeweils gut und richtig ist und wie es verwirklicht werden kann. Dazu sind wir mit unserer vom Glauben und von der Liebe geleiteten Vernunft immer neu auf dem Weg.
4. Die Weisung des kirchlichen Lehramtes als Maßstab christlichen Handelns
Kann das Lehramt - und können die von ihm verkündeten Weisungen - Maßstab und Norm des religiös-sittlichen Handelns sein? Es geht hier um die Frage nach der Vollmacht des Lehramtes, "die Botschaft zum Glauben und zur Anwendung auf das sittliche Leben" zu verkündigen und sie "im Licht des Heiligen Geistes" zu erklären (LG 25), sowie um die Art und Weise der Zustimmung der Gläubigen zu lehramtlichen Aussagen.
Die Einstellung der Menschen zum kirchlichen Lehramt ist heute sehr unterschiedlich. Nicht wenige vertrauen dem Lehramt und können seinen Aussagen zustimmen. Andere dagegen stehen ihm selbst oder einigen der von ihm vorgetragenen Lehren kritisch, in manchen Fällen auch ablehnend gegenüber. Zuweilen drückt sich diese Ablehnung in der Auffassung aus, daß das, was das Lehramt sage, grundsätzlich nicht Norm und Maßstab für das religiöse und sittliche Verhalten sein könne, vielmehr sei einzige Norm des Verhaltens der Grad der jeweils gewonnenen persönlichen Einsicht.
Die Spannung zwischen dem Anspruch der kirchlichen Autorität, in Sachen des Glaubens und der Sittlichkeit verbindliche Aussagen zu machen, und dem Anspruch von Christen, über ihr Leben aus dem Glauben nach eigenem, verantwortlich gefällten Gewissensurteil zu entscheiden, verursacht gegenwärtig in Kirche und Öffentlichkeit Unruhe und Unsicherheit. Welche Autorität kommt dem Lehramt der Kirche zu?
4.1. Die Autorität des Lehramtes in Glaubensfragen
Die kirchliche Autorität leitet sich vom Apostelamt her. Diesem liegt, wie schon am Namen erkennbar ist, eine Sendung zugrunde. Die Apostel und ihre Nachfolger üben ihre Autorität nicht in eigenem Namen aus. Ihre Autorität ist vielmehr die Autorität von Gesandten, die im Namen des Sendenden eine Botschaft zu überbringen haben. Der eigentliche Autoritätsträger in der Kirche ist und bleibt Jesus Christus. Durch seinen Geist ist er in seiner Kirche gegenwärtig.
Die Botschaft, die die Kirche weiterzugeben hat, ist Glaubensbotschaft. Daher erstreckt sich auch die Zuständigkeit des kirchlichen Amtes in erster Linie auf Fragen des Glaubens. Seine ureigene Aufgabe ist die Weitergabe und die Wahrung des Glaubens (vgl. LG 25).
Schon in der Frühzeit der Kirche wurde deutlich, daß in den Gemeinden eine Autorität notwendig war, auf die sich die Glaubenden verlassen konnten. In den Gemeinden des Neuen Testamentes trat diese Autorität nicht nur dadurch in Erscheinung, daß sie den Glauben mit Vollmacht bezeugte, sondern auch dadurch, daß sie Mißverständnisse aufklärte und Fehlentwicklungen abwehrte. Mit der Aufgabe, den Glauben zu bezeugen, war unvermeidlich die Aufgabe verbunden, Wahres von Falschem abzugrenzen.
An der Art und Weise, wie von den Ursprungszeiten des Christentums an die kirchliche Autorität ihr Amt ausübt, läßt sich die doppelte Aufgabenstellung der kirchlichen Autorität erkennen: Von ihrer prophetischen Aufgabe her muß sie zu jeder Zeit der Geschichte die Botschaft des Glaubens, wie sie in der Offenbarung enthalten ist, weitergeben. Dafür, daß diese Aufgabe vollkommen gelingt, gibt es keine Garantie; denn die Boten sind als Menschen begrenzt ebenso wie die Adressaten der Botschaft.
Zum anderen hat die kirchliche Autorität die Aufgabe, Abgrenzungen vorzunehmen, um eine Verfälschung des Evangeliums zu verhindern. Bei dieser Aufgabe geht es um die Wahrung der Identität der Kirche, der ein Bleiben in der Wahrheit bis ans Ende der Zeiten verheißen worden ist (Mt 28,20). Der Beistand des Heiligen Geistes garantiert für die Kirche das Bleiben in der Wahrheit (vgl. Joh 16,7-14).
In diesem Rahmen hat dann das Charisma der Unfehlbarkeit seinen eigentlichen theologischen Ort. Die Kirche besitzt nicht die Garantie der bestmöglichen Aussage des Glaubens in der jeweiligen Zeit, in die sie hineinspricht; aber sie besitzt die Garantie der Unfehlbarkeit, wenn es letztverbindlich um die Wahrung des Glaubensgutes und um die Abgrenzung gegenüber Verfälschungen geht. Glaubenssätze, die letztverbindlich vom kirchlichen Lehramt verkündet werden, sind nicht deshalb wahr, weil das Lehramt sie sagt, sondern sie sind wahr, weil ihr Inhalt gültig ist. Das Lehramt sagt verbindlich, daß ihr Inhalt wahr ist. Darin gründet die Autorität des kirchlichen
4.2. Die Autorität des Lehramtes in sittlichen Fragen
Gott offenbart nicht eine neutrale Wahrheit, die bloß mit dem Verstand zu fassen wäre, sondern seine Wahrheit ist die Wahrheit des ganzen Gottes und des ganzen Menschen. So richtet sich auch seine Botschaft an den ganzen Menschen. Gläubige Annahme dessen, was Gott uns von sich selbst mitteilt, geschieht in vollem Maße nur, indem der Mensch auch mit seiner inneren Einstellung und seinem äußeren Handeln dieser Wahrheit entspricht. Würde er von solcher Konsequenz absehen, dann würde er nicht einmal ganz und zuverlässig verstehen, was Gott ihm hier als Wahrheit offenbaren will. Der Glaube kann somit nicht glaubwürdig bezeugt werden ohne ein entsprechend glaubwürdiges Leben. Er muß im Leben der Christen sichtbar und spürbar werden. Jesus ruft von Anfang an zur Umkehr und zum Glauben auf (vgl. Mk 1,14f). Das neue Leben und die neue Sicht der Welt im Licht des Glaubens sind zwei Seiten ein und derselben Münze.
Im Leben aller Gläubigen soll Jesu Leben weiterwirken, sein Eintreten für die Schwachen, seine Barmherzigkeit mit den Sündern, seine Bereitschaft zum Dienen bis zur letzten Hingabe. In der Gemeinschaft der Kirche soll erfahrbar werden, was durch Jesus in die Welt hineingekommen ist. Das betrifft das Verhalten aller; dem Leitungsamt aber kommt es zu, den Anspruch des Evangeliums in der Gemeinschaft der Gläubigen bewußt zu halten. Zugleich macht es in prophetischem Zeugnis vor dem Forum der Gesellschaft deutlich, welche Konsequenzen der Humanität sich daraus ergeben. Das Eintreten der lateinamerikanischen Bischöfe für die Armen ihres Kontinents ist ein Beispiel der Ausübung dieses Amtes. Es versteht sich von selbst, daß solcher Autorität die Loyalität der Gläubigen entsprechen muß, damit sie zum Wohl der Menschen wirksam werden kann.
Es kann jedoch auch sein, daß das Verhalten einzelner Gläubiger dem Zeugnis für das Evangelium nicht entspricht. Hier kommt es dem Hirtenamt zu, zu ermahnen, aufzurichten, auf den richtigen Weg zu helfen (vgl. Röm 12,1f). Wenn das Verhalten einzelner aber gegen Gottes Willen gerichtet bleibt oder an falschen Vorstellungen festhält, kann es in der Gemeinde Verwirrung stiften und Schaden anrichten. Der Apostel Paulus hat in Korinth einen Christen, der die Gemeinde durch sein Verhalten schwer belastete, sogar aus der kirchlichen Gemeinschaft ausgeschlossen (vgl. 1 Kor 5,1-5).
Weil dem Lehramt der Kirche die Anwaltschaft für die ganze Botschaft des Evangeliums notwendig mitgegeben ist und es die Konsequenzen des Glaubens für das sittliche Leben deutlich machen muß, betrifft seine Zuständigkeit nicht nur den Glauben selbst, sondern auch die Grundsätze des Lebens aus dem Glauben. Die Zuständigkeit erstreckt sich auf Entscheidungen im Bereich des moralischen Lebens, die einen so direkten Bezug zur Wahrheit des Evangeliums aufweisen, daß sich an ihnen Annahme oder Zurückweisung der biblischen Botschaft ablesen läßt (vgl. LG 25,1; vgl. zum Folgenden KKK 2032-2040).
4.3. Gestufte Verbindlichkeit
Für das richtige Verständnis des kirchlichen Lehramtes, für die abgestufte Weise, in welcher es seinen autoritativen Anspruch geltend macht, und für die in unterschiedlicher Weise geforderte Zustimmung zu lehramtlichen Aussagen in Fragen des Glaubens und der Sittlichkeit sind folgende Unterscheidungen zu beachten:
- außerordentliches und ordentliches Lehramt,
- unfehlbarer und nicht-unfehlbarer Spruch des Lehramtes,
- Glaubenswahrheiten (Wortoffenbarung) und Vernunftwahrheiten (Schöpfungsoffenbarung),
- Glaubenszustimmung und religiöse Zustimmung des Willens und Verstandes.
Entsprechend diesen Unterscheidungen bestehen hinsichtlich der Lehrverkündigung der Kirche und der Zustimmungsverpflichtung der Gläubigen folgende Abstufungen:
- Wenn das außerordentliche Lehramt unfehlbar und feierlich erklärt, eine Lehre über Glaube und Sittlichkeit sei in der Offenbarung enthalten, ist Glaubenszustimmung gefordert. Das ist der Fall, wenn die Bischöfe mit ihrem sichtbaren Haupt vereint in einem kollegialen Akt, wie es bei ökumenischen Konzilen der Fall ist, eine solche Festlegung verkünden oder wenn der Papst in Erfüllung seiner Sendung als oberster Hirte und Lehrer aller Christen eine geoffenbarte Lehre ex cathedra, das heißt in einer für die Gesamtkirche endgültigen Entscheidung vorträgt.
- Wenn das ordentliche und universale Lehramt in seiner Unterweisung eine Glaubenslehre als von Gott geoffenbart zu glauben vorlegt, ist ebenfalls Glaubenszustimmung gefordert.
Wenn das Lehramt "definitiv" (endgültig) Wahrheiten über Glaube und Sittlichkeit (fides et mores) vorlegt, die, wenn auch nicht von Gott ausdrücklich geoffenbart, jedoch eng und zuinnerst mit der Offenbarung verbunden sind und dazu dienen, das geoffenbarte Glaubensgut unverfälscht zu bewahren, müssen diese Wahrheiten, da die Wortoffenbarung die Schöpfungsoffenbarung definitiv erhellt, "fest angenommen und beibehalten" werden.
- Wenn das kirchliche Lehramt Aussagen macht, in denen es beabsichtigt, authentisch, aber nicht definitiv Wahrheiten über Glaube und Sittlichkeit vorzulegen, ist - je nach dem jeweiligen Verbindlichkeitsgrad - religiöse Zustimmung des Willens und Verstandes zu gewähren. Das trifft für Lehraussagen zu, die vorgelegt werden, um zu einem tieferen Verständnis der Offenbarung beizutragen oder ihren Inhalt zu verdeutlichen, und es trifft für Lehraussagen zu, die vorgelegt werden, um die Übereinstimmung einer Lehre mit den Glaubenswahrheiten zu betonen oder um vor Auffassungen zu warnen, die mit diesen Wahrheiten nicht vereinbar sind.
Die hier aufgezeigten Möglichkeiten lassen erkennen, daß die kirchliche Lehrverkündigung eine Einheit in Vielfalt darstellt und daß ihre Autorität eine dienende ist, die der Wahrheit verpflichtet ist. Sie steht immer unter dem Anspruch, sich der Wahrheit zu stellen, die durch Glaube und Vernunft vermittelt wird. Die Kirche kann nicht aus eigenem Ermessen heraus Gebote und Verbote aufstellen, sondern nur festzustellen suchen, was im Licht des Glaubens und der Vernunft zur Gestaltung des Lebens als Weisung und Orientierung zu beachten ist.
Die Kirche wendet sich in ihren Stellungnahmen zu Fragen des moralischen Lebens stets an eine aus freiem Willen und persönlichem Entscheid hörbereite Vernunft. Sie kann Wahrheiten verkünden, die im Glauben anzunehmen sind. Ihnen gebührt Glaubenszustimmung. Aber in vielen Bereichen hat sie oftmals keine endgültige Antwort. Gerade im Bereich des Sittlichen ist die Kirche selbst mitsamt ihrem Lehramt immer auch eine suchende (vgl. GS 16). Das hängt auch damit zusammen, daß die Lebenszusammenhänge, in denen der einzelne steht, vielfach verflochten sind. In diesen Fällen könnte die Befolgung einfacher Verhaltensregeln unter dem einen Gesichtspunkt ratsam erscheinen, unter einem anderen Gesichtspunkt jedoch ernsthafte moralische Probleme ungelöst lassen oder schwer zu ertragende Härten mit sich bringen. Auch die wären vom einzelnen jeweils im Gewissen mit zu verantworten. Wenn die Kirche dennoch solche nicht-definitiven Aussagen macht, so gebührt ihnen nicht eine Glaubenszustimmung, sondern eine religiöse Zustimmung des Willens und Verstandes. Diese besteht darin, daß der Glaubende bei entsprechenden Lehraussagen das Lehramt selbst anerkennt und den von ihm vorgetragenen Urteilen aufrichtig anhängt, und zwar entsprechend der vom Lehramt kundgetanen Auffassung und Absicht (vgl. LG 25). Diese wiederum läßt sich an der Art der Dokumente, an dem Nachdruck, mit welchem eine Äußerung als Lehre vorgetragen wird, und an der Ausdrucksweise erkennen.
Eine solche religiöse Zustimmung des Willens und Verstandes schließt ein kritisches Weiterdenken und Mitdenken mit der Kirche ausdrücklich ein. In der Bemühung um die sittliche Wahrheit und um die Begründung konkreter Normen ist die Kirche nicht immer frei von Irrtum und Mängeln gewesen. Es wäre jedoch falsch, daraus den Schluß zu ziehen, das Lehramt würde sich bei seinen Aussagen gewöhnlich täuschen. Deshalb dürfen Urteile über sittliche Fragen, die in den Kompetenzbereich des Lehramtes fallen, bis zum Beweis des Gegenteils die Vermutung für sich beanspruchen, daß sie zutreffen. Dennoch können Christen trotz aufrichtiger Bemühung, bestimmte Lehraussagen anzunehmen, ernsthafte Schwierigkeiten haben, ihre Zweifel auszuräumen.
"Wer glaubt, der privaten Meinung sein zu dürfen, die bessere künftige Einsicht der Kirche schon jetzt zu haben, der muß sich vor Gott und seinem Gewissen in nüchtern selbstkritischer Einschätzung fragen, ob er die nötige Weite und Tiefe theologischer Fachkenntnis habe, um in seiner privaten Theorie und Praxis von der augenblicklichen Lehre des kirchlichen Amtes abweichen zu dürfen. Ein solcher Fall ist grundsätzlich denkbar. Aber subjektive Überheblichkeit und voreilige Besserwisserei werden sich vor Gottes Gericht zu verantworten haben" (Schreiben der Deutschen Bischöfe an alle, die von der Kirche mit der Glaubensverkündigung beauftragt sind [1967] 19).
"Bei ihrer Aufgabe, die christliche Moral zu lehren und anzuwenden, benötigt die Kirche den Eifer der Seelsorger, das Wissen der Theologen und den Beitrag aller Christen und Menschen guten Willens. Der Glaube und das gelebte Evangelium schenken jedem eine Lebenserfahrung ,in Christus', die ihn erhellt und befähigt, die göttlichen und menschlichen Wirklichkeiten dem Geist Gottes entsprechend zu beurteilen. So kann der Heilige Geist sich ganz einfacher Menschen bedienen, um Gelehrte und höchste Würdenträger zu erleuchten" (KKK 2038).
Wo Schwierigkeiten bestehen, sollten sie, wo immer dies möglich erscheint, nicht nur dem Bereich der persönlichen Gewissensentscheidung überlassen bleiben, sondern ihre Lösung sollte in einem ehrlichen Dialog angestrebt werden, der vom Geist brüderlicher Liebe geprägt ist. Hierbei sollte versucht werden, einig in dem zu sein, was wesentlich für den Glauben und das christliche Leben ist, nach der altbewährten Regel: Im Zweifel Freiheit, im Wesentlichen Einheit, in allem Liebe (vgl. RP 9; VS 109-117).
V. Das Gewissen
1. Die Frage nach dem Gewissen
Der Ursprung des sittlichen Anspruches liegt in Gott. Er wurzelt in dem Wissen, daß Gott jeden Menschen bejaht, ihn zur Freiheit beruft und ihn in seinen Bund einbeziehen will. Wie wird der sittliche Anspruch vom einzelnen wahrgenommen? Wie kann er erkennen, was von ihm in Familie, Beruf, Politik, kurz in allen seinen Lebensbereichen gefordert ist? Wie findet er zur richtigen Entscheidung? Um diese Fragen beantworten zu können, müssen wir uns auf das Gewissen besinnen.
Das Wort "Gewissen" ist eine Nachbildung des griechischen "syneidesis" und des lateinischen "conscientia". Alle drei Begriffe beinhalten ein "Mit-Wissen". Im Gewissen hat der Mensch ein Mitwissen um sich selbst. Er weiß im Gewissen um sein Menschsein im sittlichen Sinne, das heißt, er spürt einen Anspruch, der für sein Handeln verpflichtend ist.
Offenkundig sind die meisten Menschen davon überzeugt, daß das Gewissen zum Menschsein gehört. Doch was ist das Gewissen? Es ist leichter zu sagen, wie sich das Gewissen äußert, als sein Wesen zu beschreiben. Ein Mensch nimmt den Anruf des Gewissens in sich wahr und beruft sich darauf. Er sagt: Ich kann diese oder jene Handlung nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Und er erklärt: Mein Gewissen gebietet mir, dieses oder jenes zu tun oder zu unterlassen.
Wir erleben auch, daß Entscheidungen, für die man sich auf das Gewissen beruft, ganz unterschiedlich, häufig sogar entgegengesetzt sind. Die einen meinen, etwas mit ihrem Gewissen vereinbaren zu können, was andere aus Gewissensgründen ablehnen. Den einen läßt das Gewissen vor oder nach bestimmten Entscheidungen keine Ruhe, andere "machen" sich in vielen Situationen erst gar kein "Gewissen". Die einen führen guten Gewissens Kriege, töten Menschen und zerstören die Umwelt, andere dagegen nehmen für ihre Gewissensüberzeugung Nachteile, Verfolgung, Einkerkerung oder gar den Tod auf sich. Bei manchen hat sich das Gewissen niemals voll entwickelt, ist falsch orientiert, verkümmert oder wieder verlorengegangen, weil notwendige Voraussetzungen gefehlt haben. Es mögen ihnen falsche Leitbilder vermittelt worden sein, oder sie haben der Eigenliebe oder dem Erfolg den Vorzug vor dem sittlich Guten gegeben.
Das Gewissen ist eine komplexe Erscheinung. Es stellen sich für die Deutung dieses Phänomens viele Fragen. Ist das Gewissen eine von Gott geschenkte Befähigung, die uns angeboren ist? Ist es gar das Echo der Stimme Gottes (John Henry Newman) in uns? Oder ist das Gewissen eine durch Erziehung und Umwelt erworbene Funktion, die nur die jeweiligen Werte und Normen der Eltern, der Gesellschaft und der Umwelt widerspiegelt? Was sagen uns darüber Bibel und christliche Tradition? Wie verstehen die heutigen Erfahrungswissenschaften das Gewissen? Was lehrt die Kirche heute über das Gewissen?
2. Die Deutung des Gewissens in der Heiligen Schrift
2.1. Das Gewissen als Ort der Begegnung des Menschen mit Gott nach dem Alten Testament
Nach alttestamentlicher Vorstellung ist die Regung des Gewissens von Gott eingegeben. Er hat das menschliche Herz so geschaffen, daß es auf Schuld reagiert. Einmal wird von König David erzählt: "Dann aber schlug David das Gewissen, weil er das Volk gezählt hatte, und er sagte zum Herrn: Ich habe schwer gesündigt . . ." (2 Sam 24,10; vgl. 1 Sam 24,6).
- Die Gewissensregung tritt nicht nur nach der schlechten Tat auf, sie meldet sich auch vor der Tat. In der Erzählung von Kain und Abel heißt es:
"Der Herr schaute auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und sein Opfer schaute er nicht. Da überlief es Kain ganz heiß, und sein Blick senkte sich. Der Herr sprach zu Kain: Warum überläuft es dich heiß, und warum senkt sich dein Blick? Nicht wahr, wenn du recht tust, darfst du aufblicken; wenn du nicht recht tust, lauert an der Tür die Sünde als Dämon. Auf dich hat er es abgesehen, doch du werde Herr über ihn!" (Gen 4,4b-7).
Im Glauben des alttestamentlichen Gottesvolkes wird die Gewissenserfahrung von vornherein in Beziehung zu Gott gesehen. Hinter dem mahnenden, warnenden oder verurteilenden Gewissensspruch wird die Stimme Gottes wahrnehmbar. In ihr wird der Mensch persönlich angesprochen.
Diese personale Sicht hängt in der Geschichte des Alten Testamentes mit dem Glauben an den persönlichen Gott zusammen. Im Angesicht dessen, der "Herz und Nieren" (Jer 11,20 u. ö.) prüft, nimmt der Mensch sich selbst in neuer Weise wahr und erkennt zugleich, daß Gottes Erbarmen die Sünde verzeiht. Daher kann er vertrauensvoll beten:
- "Herr, du hast mich erforscht, und du kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir. Von fern erkennst du meine Gedanken. Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt; du bist vertraut mit all meinen Wegen. Noch liegt mir das Wort nicht auf der Zunge - du, Herr, kennst es bereits. Du umschließt mich von allen Seiten und legst deine Hand auf mich" (Ps 139,1-5).
Indem der Mensch die geheimsten Regungen und Gedanken seines Herzens auf Gott hin öffnet, erschließen sich ihm die Tiefen des eigenen Inneren.
Das Gewissen stellt einen Menschen nicht nur Gott gegenüber, sondern zeigt ihm auch seine Verantwortung für die Mitmenschen. Bedrängend macht es ihm kund, wie schwer eine böse Tat wiegt. Kains Verzweiflung nach dem Mord an seinem Bruder Abel ist deshalb so erschütternd, weil ihm bewußt wurde, daß er unwiderruflich etwas Böses getan hat, das katastrophale Folgen zeigt.
David wird durch den Propheten Natan auf sein Unrecht aufmerksam gemacht, daß er Urija angetan hat (2 Sam 12,7-12; vgl. Ps 51 "Miserere"). Er erkennt sein Tun als böse und begreift, daß er damit zugleich vor Gott schuldig geworden ist. Er sagt: "Ich habe gegen den Herrn gesündigt" (2 Sam 12,13).
Ähnlich versucht Josef von Ägypten, der Frau des Potifar, die ihn zur Sünde verführen will, die Schwere der Schuld deutlich zu machen, die er auf sich laden würde, wenn er das Vertrauen seines Herrn mißbrauchen würde. Darin läge zugleich auch eine Schuld vor Gott: "Er (dein Mann) ist in diesem Hause nicht größer als ich, und er hat mir nichts vorenthalten als nur dich, denn du bist seine Frau. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht begehen und gegen Gott sündigen?" (Gen 39,9).
Was mit Gewissen gemeint ist, bezeichnet das Alte Testament vorzugsweise mit dem Wort "Herz". Das Herz ist die Mitte des Menschen. Aus ihm gehen neben der Vernunfterkenntnis auch die Entschlüsse hervor. Die bösen und die guten Gedanken wohnen im Herzen. Hier spricht der Mensch zu sich selbst; hier steht er sich selbst gegenüber und urteilt über sein Wollen und Tun. Der Gebrauch des Wortes "Herz" für Gewissen macht deutlich, daß im Gewissen auch erfahren wird, welche Werte sittlich verbindlich sind. Sie wirken nur, wenn sie ganzheitlich in unserem Inneren verankert sind. Darum ist es wichtig, daß sie verinnerlicht werden. Auch davon weiß der alttestamentliche Glaube:
- "Der Mund des Gerechten bewegt Worte der Weisheit, und seine Zunge redet, was recht ist. Er hat die Weisung seines Gottes in seinem Herzen, seine Schritte wanken nicht" (Ps 37,30f).
Das Herz des Menschen läßt sich von der Weisung Gottes formen, wenn er sein Wort im Inneren wirken läßt. So wird Gottes Anrede zum innersten Eigentum des Menschen und zur wirksamen Richtschnur für sein Leben (vgl. Sir 37,13f).
Aus allen diesen Aussagen des Alten Testamentes zum Gewissen ergeben sich folgende Gesichtspunkte:
- In der Gewissenserfahrung begegnet der unbedingte Anspruch des Sittlichen. Das zeigt sich in den Gewissensregungen vor oder nach der Tat.
- Die Gewissenserfahrung macht die individuelle Verantwortung des Menschen vor den prüfenden und erbarmenden "Augen Gottes" deutlich.
- Die mitmenschliche und religiöse Seite der sittlichen Erfahrung wird durch die Gottesbegegnung, die sich in ihr vollzieht, geläutert.
' Das "Herz" des Menschen als Ort der sittlichen Erfahrung ist offen für die Formung durch Wertmaßstäbe. Das glaubend-liebende Herz nimmt den Anruf der Liebe Gottes auf und läßt sich von seiner Weisung leiten (vgl. Ps 119; 105).
2.2. Gewissen und Gotteserfahrung im Neuen Testament
Jesus knüpft in seinen Aussagen über das Gewissen an die Vorstellungen des Alten Testamentes an. Auch für ihn ist das Herz der Ort der Gewissenserfahrung. Er kennt die Abgründe des menschlichen Herzens, aus dem die bösen Gedanken kommen (vgl. Mk 7,21f), und er weiß um das reine, ungeteilte Herz, in dem der Mensch sich ganz Gott übergibt (vgl. Mt 5,8). Er ruft das Liebesgebot in Erinnerung und spricht in ähnlicher Weise von der Gewissensbildung, wie sie im Alten Testament begegnet:
- "Auf guten Boden ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort mit gutem und aufrichtigem Herzen hören, daran festhalten und durch ihre Ausdauer Frucht bringen" (Lk 8,15).
Der Mensch muß nach Jesu Weisung ein offenes Herz für das Wort Gottes haben, günstige Voraussetzungen dafür schaffen, es aufzunehmen, und sich von ihm formen lassen. Er muß das Wort hören, daran festhalten und aus dieser Grundhaltung heraus Entscheidungen treffen.
Nach Jesu Lehre hat jedes ethische Handeln einen Bezug zu Gott. "Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten" (Mt 6,4.18). Der Vater Jesu Christi bleibt dem Menschen nahe, und seine Nähe schafft Heil. Die Bergpredigt warnt den Menschen vor der Gefahr, sich aus Gottes Nähe zu entfernen und Lohn bei den Menschen zu suchen.
Weiterhin ist das Gewissen auf die neue Wirklichkeit des Reiches Gottes bezogen, die uns in Jesus Christus selbst begegnet. Er mahnt die Menschen, wachsam zu sein und die Spuren dieses Gottesreiches in der Situation, im "kairos", wahrzunehmen. Der Wille Gottes äußert sich in den Weisungen des Gottesgebotes und in den konkreten Situationen. Entscheidend ist dabei, die "Zeichen der Zeit" richtig zu deuten.
Für den Glaubenden ist Jesus Christus selbst Grund und Ziel des religiös-sittlichen Lebens. Das von ihm verkündete Ethos und die Botschaft vom Heil sind von seiner Person nicht zu trennen. Auf Jesus Christus ist unser Leben ausgerichtet. Zu ihm sollen wir uns im Glauben und im Leben aus dem Glauben bekennen. "Wer sich nun vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater bekennen" (Mt 10,32).
Erst bei Paulus kommt das Wort "syneidesis" vor, das in etwa dem deutschen Wort "Gewissen" entspricht.
Die wichtigsten Aussagen über das Gewissen finden sich bei Paulus im Brief an die Römer. In den ersten beiden Kapiteln zeigt der Apostel, der in diesem Zusammenhang die Sündenlosigkeit Jesu Christi (Hebr 4,15; 1 Petr 2,22) und der seligsten Jungfrau Maria (vgl. S. 85) nicht eigens hervorzuheben braucht, daß alle Menschen (Juden wie Heiden) der Sünde unterworfen sind und der Erlösung bedürfen. Aber wie steht es mit denen, die nicht an den Gott der Bibel glauben und das in der Heiligen Schrift verkündete Gebot Gottes nicht kennen? Sind sie nicht von der Erfüllung des Gesetzes entschuldigt? Haben sie überhaupt die Möglichkeit, Gottes Willen zu erkennen? Paulus sagt dazu:
- "Wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, von Natur aus das tun, was im Gesetz gefordert ist, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. Sie zeigen damit, daß ihnen die Forderung des Gesetzes ins Herz geschrieben ist; ihr Gewissen legt Zeugnis davon ab, ihre Gedanken klagen sich gegenseitig an und verteidigen sich - an jenem Tag, an dem Gott, wie ich es in meinem Evangelium verkündige, das, was im Menschen verborgen ist, durch Jesus Christus richten wird" (Röm 2,14-16).
In diesen Aussagen bietet Paulus wichtige Einsichten zum Verständnis des Gewissens:
Erstens: Wenn Menschen, die das in der Heiligen Schrift enthaltene Gesetz nicht kennen, wie selbstverständlich das tun, was im Gesetz enthalten ist, dann zeigt sich darin, daß sie sich selbst Gesetz sind. Das bedeutet: In seinem Gewissen steht sich der Mensch selbst gegenüber und gewinnt die Einsicht, daß er für sich selbst verantwortlich ist. Er ist sich somit selbst aufgegeben. Dieser Anspruch ist nicht als autonome Selbstgesetzgebung zu verstehen, sondern als Selbstbestimmung, die im Menschsein selbst ihre verbindliche Richtschnur hat. Die Erfahrung dieser Forderung, für sein Menschsein verantwortlich zu sein, geschieht in der Gewissensanlage.
Zweitens: Menschen, die das Gesetz nicht kennen, aber tun, was im Gesetz gefordert ist, zeigen damit an, daß ihnen das Gesetz ins Herz geschrieben ist.
Hier begegnet uns "Herz" - wie im Alten Testament - wiederum im Sinne von Mitte der menschlichen Existenz, die der Sitz von Erkenntnis, Gefühl und Entscheidung ist. Der Begriff "ins Herz geschrieben" weist indirekt darauf hin, daß Gott dem Menschen die Fähigkeit eingepflanzt hat, spontan Gutes und Böses zu unterscheiden. Im Herzen wird offenbar, was Gott vom Handeln des Menschen erwartet. Es sollen die Werte verwirklicht werden, die das Gewissen erkennt und die die emotionale Mitte eines Menschen prägen. In diesem Sinn sprechen wir von einem geformten Wertgewissen.
Drittens: In konkreten Situationen regt sich das Gewissen in unterschiedlicher Weise. Der "ins Herz geschriebene" sittliche Anspruch wird hier konkret laut. Das Gewissen gibt seine Forderung kund, indem es anklagt oder verteidigt. Das ist wie ein ständiges Gerichtsverfahren, in dem das Gewissen in einer bestimmten Situation ein Urteil fällt. Es bewertet ein konkretes Wollen oder ein bestimmtes Verhalten im Licht jenes Gesetzes, das "ins Herz geschrieben" ist. Wir sprechen hier von einem Situationsgewissen.
Viertens: Die endgültige Offenbarung dessen, was der Mensch in seinem Gewissen erkannt und entschieden hat, geschieht erst im Gericht durch Jesus Christus. Von dieser Ausrichtung her bekommt jede Entscheidung für oder gegen den Spruch des Gewissens ihre letzte und tiefste Bedeutung: Es geht in der Wahrnehmung und Erfüllung des ethischen Anspruchs um das Heil des Menschen.
In diesen Aussagen über das Gewissen sind folgende Elemente enthalten:
- Das Gewissen gehört zum Menschsein; alle Menschen können darin Gut und Böse erkennen.
- Im Gewissen erkennt der Mensch die wesentlichen Grundforderungen seiner Existenz. Der Glaubende weiß sich im Gewissen vor sich selbst und vor Gott verantwortlich.
- Im einzelnen Gewissensspruch wird das als werthaft Erkannte auf die konkrete Situation angewandt.
- Die Befolgung oder Ablehnung des Gewissensspruchs hat Bedeutung für das Heil oder Unheil des Menschen.
- Kern und Mitte der biblischen Deutung des Gewissens ist der Bezug des Gewissens zu Gott. In der Stimme des Gewissens, die zum Tun des Guten und zum Meiden des Bösen aufruft, schafft Gott sich Gehör. Er ruft uns dazu auf, daß wir auf seine Stimme hören, uns auf ihn ausrichten und so in Übereinstimmung mit seinem Willen leben. Das geschieht mit der Kraft des Heiligen Geistes (vgl. Röm 9,1), der zur Erkenntnis des Guten hinlenkt.
Paulus erkennt auch Schwächen und Grenzen der Gewissenserkenntnis. Der Mensch kann sich in seinen sittlichen Einsichten täuschen und darum in seinem sittlichen Urteil irren.
Ein lehrreiches Beispiel bietet Paulus in der Frage des Götzenopferfleisches (1 Kor 8,1-12; 10,25-30): Darf ein Christ von dem Fleisch, das auf dem Markt meistens vom nahegelegenen Tempel angeboten wurde, essen oder nicht? An sich haben die Christen, die das ohne Bedenken taten (die "Starken"), recht, weil es für einen Christen keine Götzen gibt. Aber damals hielten es manche Christen (die "Schwachen") aus ihrer bisherigen Einstellung für verboten. Sie haben eine irrige Erkenntnis; wenn sie dennoch Götzenopferfleisch essen, "beflecken" sie ihr Gewissen und sündigen. Man muß - das ergibt sich hier - auch dem irrigen Gewissen folgen, und zwar unbedingt. Paulus hat noch weiteres im Sinn: Wenn die "Starken" durch ihr Verhalten die "Schwachen" dazu verleiten, vom Götzenopferfleisch zu essen, sollen sie darauf verzichten. "Wenn ihr euch auf diese Weise gegen eure Brüder versündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, versündigt ihr euch gegen Christus" (1 Kor 8,12).
Stets sind wir demnach verpflichtet, dem Spruch des Gewissens zu folgen, auch wenn dieses irrt. Das Gewissen ist die letzte maßgebliche Norm der persönlichen Sittlichkeit in der Situation des Handelns. Es gibt keine wichtigere Instanz, die uns unser Stehen vor Gott so bewußt hält und nach seinem Willen suchen läßt, als das Gewissen. Gewiß muß sich jeder Christ bemühen, zu einem dem Glauben entsprechenden Gewissensurteil zu kommen; aber es gibt Situationen, in denen ihm eine weitere Überprüfung nicht möglich ist; eine Änderung seines Gewissensurteils kann dann nicht vollzogen werden. Wenn ihn sein Glaube zu einer bestimmten Handlung drängt, muß er ihm folgen.
Denn "alles, was nicht aus dem Glauben geschieht, ist Sünde" (Röm 14,23; vgl. VS 60).
Neben der Möglichkeit des Irrtums kennt Paulus noch eine Grenze der Gewissenserkenntnis:
"Ich urteile . . . nicht über mich selbst. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewußt, doch bin ich dadurch noch nicht gerecht gesprochen; der Herr ist es, der mich zur Rechenschaft zieht. Richtet also nicht vor der Zeit; wartet, bis der Herr kommt, der das im Dunkeln Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen aufdecken wird. Dann wird jeder sein Lob von Gott erhalten" (1 Kor 4,3-5).
Mit dieser Mahnung richtet sich der Apostel gegen jede menschliche Selbstsicherheit. Vor Gott kann es keine letzte Selbstzufriedenheit geben. Der Mensch kann sich nicht selbst das Abschlußzeugnis seines Lebens ausstellen und sich im Gewissen den vollkommenen Freispruch geben. Er bleibt auf den Freispruch Gottes angewiesen. Niemand soll den Versuch unternehmen, sich von jeglicher Schuld freizusprechen; er soll sich vielmehr ganz der Barmherzigkeit Gottes anvertrauen.
3. Die christliche Lehre vom Gewissen heute
3.1. Die Würde des Gewissens
Die Kirche nimmt in ihrer Lehre vom Gewissen die wesentlichen Gehalte der großen Tradition auf, die in besonderer Weise Thomas von Aquin entfaltet hat, und bezieht zugleich die Erkenntnisse der heutigen Zeit in ihre theologischen, pastoralen und pädagogischen Bemühungen ein.
In der Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute bietet das Zweite Vatikanische Konzil eine Lehre vom Gewissen, in der biblische und traditionelle Elemente mit neueren theologischen Einsichten über Wesen und Bedeutung des Gewissens zusammengefaßt werden.
Ausgangspunkt dieser Lehre ist das Menschsein des Menschen, seine Würde und seine Berufung. Berufung wird zu einem Schlüsselwort der konziliaren Lehre vom Menschen: Jeder ist zum Menschsein berufen; er ist sich selbst aufgegeben, unabhängig davon, ob er hinter seinem Leben eine berufende Instanz bewußt anerkennt oder nicht. Berufung zum Menschsein besagt, daß der Mensch immer auf einen Weg gerufen ist, um sein Leben und seine Beziehung zu Gott und zu den Mitmenschen immer besser und reifer werden zu lassen. Das macht seine Würde als Person aus. Der Mensch ist kein bloßes Naturwesen, das durch biologische und physikalische Gesetze gelenkt wird, sondern er ist ein freies Wesen, das als Ebenbild Gottes in seiner Freiheit angesprochen und angerufen ist. Der Ort, an dem diese Berufung als ethischer Anspruch erfahren wird, ist das Gewissen.
- "Im Innern seines Gewissens entdeckt der Mensch ein Gesetz, das er sich nicht selbst gibt, sondern dem er gehorchen muß und dessen Stimme ihn immer zur Liebe und zum Tun des Guten und zur Unterlassung des Bösen anruft und, wo nötig, in den Ohren des Herzens tönt: Tu dies, meide jenes. Denn der Mensch hat ein Gesetz, das von Gott seinem Herzen eingeschrieben ist, dem zu gehorchen eben seine Würde ist und gemäß dem er gerichtet wird" (GS 16).
Hier spricht das Konzil von der Erfahrung des sittlichen Anspruchs, der sich als unbedingter Anspruch, als Gesetz, in der Stimme des Gewissens äußert. Es ist eine Stimme voll Unnachgiebigkeit. Das sich in dieser Stimme äußernde Sollen betrifft die innerste Mitte des Menschen. Es ruft den Menschen dadurch zur Selbstverwirklichung auf, daß es ihn auffordert, das Gute zu tun und dadurch gut zu sein. Gut und Böse sind nicht in das Belieben des Menschen gestellt. Der Anruf zum Guten ist ein unabdingbarer Anspruch. Er engt aber nicht ein und entfremdet den Menschen nicht von sich selbst, sondern lenkt ihn vielmehr auf die Verwirklichung des Menschseins hin.
In der Erfahrung dieses Anspruches steht der Mensch vor Gott. Im Leben nach dem Gewissen oder gegen das Gewissen entscheidet der Mensch end-gültig über sein Heil oder sein Unheil.
Die alte und stets neue Frage, was das Gewissen ist, beantwortet das Konzil mit einer Umschreibung, in der besonders der personale und religiös-dialogische Charakter des Gewissens betont wird:
- "Das Gewissen ist die verborgenste Mitte und das Heiligtum im Menschen, wo er allein ist mit Gott, dessen Stimme in diesem seinem Innersten zu hören ist" (ebd.).
Diese Umschreibung des Gewissens als "verborgenste Mitte im Menschen" entspricht dem, was die biblisch-christliche Tradition mit dem Wort "Herz" oder "Mitte der menschlichen Person" und die Mystik mit "Seelengrund" meinte. Hier öffnet sich der Mensch dem Willen Gottes und sucht, ihn zu verstehen. Hier ereignet sich das Gespräch mit Gott, darin auch das Ja oder das Nein zu ihm. Die Entscheidung, zu der uns das Gewissen aufruft, müssen wir fällen. Wohl kann ein Mensch mancherlei Hilfe und Beratung erfahren. Doch nur Gott kann bei der Freiheitsentscheidung zugegen sein. Deshalb wird das Gewissen "das Heiligtum" im Menschen genannt. Es hat daher zutiefst eine religiöse Bestimmtheit.
Der Glaubende erfährt im Gewissen Gottes Zusage, Verheißung und Anruf. Gott öffnet ihm die "Ohren des Herzens" und verheißt ihm, daß er im Vertrauen auf Gott seine Freiheit und sein Leben wagen kann, indem er dem Anruf zum Leben der Liebe folgt. Die Liebe ist Inhalt und Maßstab des Gewissens, sie ist sein eigentliches Gesetz. Das Konzil drückt das mit den Worten aus:
- "Im Gewissen erkennt man in wunderbarer Weise jenes Gesetz, das in der Liebe zu Gott und dem Nächsten seine Erfüllung hat" (ebd.).
Die ethische Erfahrung im Gewissen des Menschen ist nirgendwo intensiver als dort, wo der Mensch Verantwortung für andere übernimmt. Kern aller Gewissensorientierung ist darum das Doppelgebot der Liebe (vgl. Mt 22,37-40). Dieser Hauptinhalt gibt dem Gewissen eine grundlegende Wertorientierung und läßt den Menschen auch wahrnehmen, was dieser Liebe entspricht. Diese Liebe soll, wie der heilige Paulus sagt, "reicher werden an Einsicht und Verständnis, damit ihr beurteilen könnt, worauf es ankommt. Dann werdet ihr rein und ohne Tadel sein für den Tag Christi, reich an der Frucht der Gerechtigkeit, die Jesus Christus gibt, zur Ehre und zum Lob Gottes" (Phil 1,9-11).
Erst in der endzeitlichen Vollendung ist der Gleichklang der menschlichen Liebe mit der göttlichen Liebe erreicht. In der Zeit unseres irdischen Lebens sind wir immer auf der Suche nach dem Gelingen unserer Liebe. Zwar wissen wir, daß wir gut sein und das Gute tun sollen, aber wir wissen nicht schon immer von vornherein, was in vielen Lebenssituationen das wahrhaft Gute ist. Nicht selten geschieht es, daß wir trotz aller Bemühungen nicht die volle und ganze Wahrheit herausfinden, weil unsere Erkenntnis und Einsicht nicht ausreicht und weil wir nicht alle Aspekte der jeweiligen Handlungssituation durchschauen. Aber wir können unser Handeln auch nicht immer aufschieben, bis wir alles ganz genau wissen und beurteilen können. Die Situation verlangt, daß wir uns entscheiden und entsprechend unserer Entscheidung handeln. Wenn wir redlich nach der Wahrheit suchen und uns entsprechend unserer Einsicht und Erkenntnis entscheiden, wahren wir die Treue zum Gewissen. Das gilt für Glaubende wie für Nichtglaubende.
- "Durch die Treue zum Gewissen sind die Christen mit den übrigen Menschen verbunden im Suchen nach der Wahrheit und zur wahrheitsgemäßen Lösung all der vielen moralischen Probleme, die im Leben der Einzelnen wie im gesellschaftlichen Zusammenleben entstehen" (GS 16).
Die Kirche, die sich als pilgerndes Gottesvolk erfährt, hat nicht Antworten auf alle Fragen, die in der geschichtlichen Situation auftreten. Deshalb muß es ein gemeinsames Suchen nach Wahrheit und nach humanen Lösungen geben. Christen sind nicht immer die ersten, die in bestimmten Zeitsituationen wahrnehmen, was zu tun oder zu lassen ist. Treue zum Gewissen im Suchen nach der Wahrheit gibt es überall. Gottes Geist ist in vielen Menschen auf vielfache Weise wirksam. Seine Impulse aufzunehmen bleibt Aufgabe der Kirche.
Es entspricht der Würde jedes einzelnen Gewissens, daß der Mensch in einem beständigen Wachstumsprozeß nach dem sucht, was der sinnvollen Gestaltung der Wirklichkeit dient. Das "rechte" Gewissen, das heißt das aus der Grundausrichtung auf das Gute geleitete Gewissen, sucht sich bei der Bemühung um humane Lösungen nach der sittlich verbindlichen Wahrheit zu richten.
- "Je mehr also das rechte Gewissen sich durchsetzt, desto mehr lassen die Personen und Gruppen von der blinden Willkür ab und suchen sich nach den objektiven Normen der Sittlichkeit zu richten" (ebd.).
Zweifach fordert das Gewissen also den Menschen: Er soll ja sagen zum sittlichen Anspruch des Gewissens, und er soll von daher sich bemühen, redlich nach dem zu suchen, was in einer konkreten Situation zu tun ist.
In seiner Verpflichtung, sich zu dem zu entscheiden, was er hier und jetzt als persönlich verbindlich erkannt hat, kann der Mensch nicht irren. "Es ist die Verpflichtung, das zu tun, was der Mensch durch einen Gewissensakt als ein Gutes erkennt, das ihm hier und jetzt aufgegeben ist" (VS 59). Einen Irrtum kann es allerdings darüber geben, ob das, was einer als hier und jetzt verpflichtend erkannt hat, der Gesamtwirklichkeit entspricht. Da das Gewissen in der konkreten Situation oft nicht in der Lage ist, sein Urteil immer neu zu überprüfen, ist es richtig, dem jeweiligen Gewissensspruch zu folgen, selbst wenn in der Erkenntnis ein Irrtum vorliegt. Auch der im Gewissen Irrende steht vor Gott. Mehr als das redliche Suchen nach Wahrheit und Einsicht und mehr als ein gewissenhaftes Urteil über das, was hier und jetzt als persönlich verbindlich eingesehen wird, kann nicht erreicht werden. Daher behält auch das unüberwindbar irrende Gewissen seine Würde:
- "Nicht selten jedoch geschieht es, daß das Gewissen aus unüberwindlicher Unkenntnis irrt, ohne daß es dadurch seine Würde verliert. Das kann man aber nicht sagen, wenn der Mensch sich zuwenig darum müht, nach dem Wahren und Guten zu suchen, und das Gewissen durch Gewöhnung an die Sünde allmählich fast blind wird" (ebd.).
Der eigentliche Grund dafür, daß auch das unüberwindbar irrende Gewissen seine Würde nicht verliert, ist darin zu sehen, daß es, "auch wenn es uns tatsächlich in einer von der objektiven sittlichen Ordnung abweichenden Weise anleitet, dennoch nicht aufhört, im Namen jener Wahrheit vom Guten zu reden, zu deren aufrichtiger Suche der Mensch aufgerufen ist" (VS 62).
Die Lehre der Kirche über das Gewissen ermutigt zum Leben nach dem Gewissen. Im Gewissen steht der Mensch vor Gott.
Jeder muß auf seinem Weg mit Gott nach dem suchen, was vor Gott wahr und gut ist. Die Möglichkeit, daß er dabei falsche Wege gehen und unübersehbaren Schaden anrichten kann, soll ihn mahnen, der Grundentscheidung zum Guten treu zu bleiben und sich ständig um die Bildung seines Gewissens zu mühen.
3.2. Die Wirkweise des persönlichen Gewissens
Die Aussagen des Konzils (GS 16) lassen erkennen, daß das Gewissen keine statische Größe ist. Es kann nur richtig reagieren, indem es sich beständig entfaltet. Das Gewissen jedes Menschen hat seine eigene Geschichte; es durchläuft einen Prozeß, den der Mensch nur zum Teil selbst bestimmen kann; er ist zugleich von den Rahmenbedingungen abhängig, unter denen er aufwächst.
Erstverantwortung für die Gewissensbildung von Kindern haben die Eltern. Später sind Miterzieher einbezogen, die heute allerdings schon recht früh die Wertungen mitbestimmen, welche das Gewissen der Kinder formen.
Wie entwickelt sich im einzelnen Menschen die Fähigkeit, in seinem Leben den Ruf Gottes wahrzunehmen? Die erste Bedingung dafür, daß ein Mensch sich im Leben annimmt und darin Gottes Ruf wahrnimmt, ist, daß er sich selbst angenommen und geliebt weiß.
Die Psychologie zeigt uns, wie sich die Fundamente der Werterfahrung eines Menschen schrittweise entwickeln. Für die Bereitschaft des Erwachsenen, überhaupt Verantwortung zu übernehmen, ist die Vermittlung eines Urvertrauens eine der wichtigsten Voraussetzungen, für die in den ersten zwei Lebensjahren gesorgt werden muß; es bildet sich in der Annahme des Kindes durch die Eltern, besonders der Mutter.
In der ersten Phase einer anfänglichen Verselbständigung des Kindes, das zu gehen gelernt hat und einmal auf "eigenen Füßen stehen" soll, wird dann die Voraussetzung dafür geschaffen, daß es später als erwachsener Mensch zu sich stehen kann; überzogene Strenge kann das Kind in dieser Phase verunsichern; es können sich Ängste entwickeln, die sich später als zwanghafte Gewissensreaktionen zeigen. Da der Mensch nicht zu sich stehen kann, wird er sich immer ängstlich an Normgerüste halten, um Halt zu gewinnen. Es kommt deswegen darauf an, dem Kind soweit wie möglich Mut zu eigenen Schritten zu geben.
Eine weitere Phase ist für die Inhalte entscheidend, die die Gewissensreaktion im einzelnen lenken. Aber noch ist es die Autorität der Eltern, sind es ihre Normen und Wertungen, die das Kind fraglos zu den eigenen macht. Kinder sind hier in den Wertungen ganz abhängig von ihren Eltern; aber sie machen jetzt ihre ersten Erfahrungen von Schuld im Sinne von Normübertretungen. Es ist zu beobachten, daß Fünfjährige sich durchaus quälen können im Bewußtsein, zum Beispiel etwas kaputtgemacht zu haben. Um so mehr sollten solchen frühen Schulderfahrungen Vergebungserfahrungen entsprechen. Es ist wichtig, daß sich die Kinder trotz dieser oder jener Normübertretung im Grunde angenommen wissen.
In den ersten Jahren der Schulzeit wird das Wissen um die sittlichen Regeln weiter geschult; das Kind lernt, diese immer mehr auf die Wirklichkeit seines eigenen Lebens anzuwenden. Eine entscheidende Phase zur Heranbildung des mündigen Gewissens eines Erwachsenen beginnt in der Pubertät und setzt sich in der Adoleszenz fort. Beide Phasen sind wie zwei Seiten eines einzigen Prozesses, in dem der Jugendliche von seinen Eltern und den bisherigen Autoritäten Abstand gewinnen muß; immer mehr wird ihm deutlich, daß er selbst sein Leben leben muß, daß ihm die Verantwortung dafür niemand abnimmt. Durch Krisen hindurch muß er seine eigene Identität finden. Er kann nicht mehr einfach durch die Eltern und die Institutionen seiner Kindheit seine Wertmaßstäbe bilden lassen. Er muß selbst zu ihnen stehen können. Aber er kann sie nicht selber schaffen; deswegen sucht er in der Ablösung von den Eltern neue Leitbilder und bildet vor allem an ihnen seine eigenen Wertvorstellungen aus. In dieser Phase pflegt der Einfluß der jugendlichen Bezugsgruppe sehr groß zu sein, in der der einzelne sich bewegt. Immer mehr wird der Mensch mitverantwortlich für die Bildung seines eigenen Gewissens.
So sehr eine ethische Entscheidung eines einzelnen Menschen nur ihn selbst betreffen mag, so bleibt diese doch eingebunden in den Wertungshorizont von Tradition und Glaubensgemeinschaft. Der verantwortlich Handelnde soll sagen können: Jeder andere an meiner Stelle und unter meinen Voraussetzungen müßte ebenso handeln. Dem entspricht, daß der Mensch in wichtigen Fragen ethischer Entscheidung nach Vergewisserung Umschau hält. Im Suchen nach Ver-gewisserung begegnet er tatsächlich einem Konsens über unverzichtbare Grundwerte. Darüber hinaus trifft er Menschen, deren Handeln ihn überzeugt und die sich in ethischen Fragen als kompetent ausweisen. Ihre Urteile sind für das eigene Handeln mitzubedenken. Denn um Sicherheit und Eindeutigkeit im sittlichen Urteil zu gewinnen, sind wir auf Kommunikation angewiesen. In ihr begegnen uns sittliche Erfahrungen und Gegenerfahrungen. In ihr werden wir vertraut mit sittlichen Einstellungen und Urteilen, die sich menschlich bewährt haben. Ethische Erfahrung lehrt uns zu fragen: Was würde der oder jener, den ich schätze und von dessen Lauterkeit ich überzeugt bin, sagen, wenn er mich so oder so handeln sähe? Aus solchen Erfahrungen läßt sich einsichtig machen, daß ethische Grundanschauungen und Gewissensbildung eine soziale Dimension haben. Denn in dem Maße, in dem ein Mensch sein ethisches Handeln mit seinem Glauben verbunden weiß, wird er nach einer gemeinsamen Überzeugung gerade bei denen suchen, die aus ihrem Glauben heraus das menschliche Verhalten beurteilen.
In der Gemeinschaft der Kirche begegnet ein Christ, der für sein Gewissen nach Orientierung sucht, auch den Äußerungen des kirchlichen Lehramtes. Sie sind ein sittlicher Anspruch an das Gewissen. Die lehramtliche Weisung zielt nicht auf eine Knechtung des Gewissens, sondern auf die Klärung der Erkenntnis des sittlich Richtigen. Darin dient das kirchliche Lehramt dem Gewissen des einzelnen. Dieser Dienst ist schwierig, aber er ist sinnvoll und unverzichtbar. Das Lehramt kann in der Verkündigung der sittlichen Botschaft nicht in jedem Einzelfall Orientierungen mit letztgültiger Verbindlichkeit vorlegen, aber es kann die Gläubigen auch nicht ohne jede sittliche Orientierung und Weisung allein lassen. Manchmal sieht es sich verpflichtet, sich zu äußern, auch wenn diese konkrete Äußerung weder alle denkbaren Aspekte erfaßt noch eine definitive Entscheidung sein will. Lehräußerungen zu moralischen Fragen haben unterschiedliche Grade der Verbindlichkeit. Diese stufen sich nach einer Rangordnung ethischer Fragen. Grundsätzliche Lehräußerungen wie zum Beispiel zur Einheit der Ehe und zur Unauflöslichkeit der sakramentalen Ehe haben einen anderen Rang als Äußerungen etwa zur konkreten Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens. Das Gewissen des Christen wird die Hilfen der Kirche für konkrete Lebensfragen in rechter Gesinnung beachten, doch kann ihm niemand die persönliche Gewissensentscheidung abnehmen.
Die Unübersehbarkeit der modernen Welt läßt es immer weniger zu, daß jede Einzelheit des zu verantwortenden Verhaltens bereits normativ allgemeingültig geregelt werden kann. Auch werden Normen zumeist in einer so abstrakten Formulierung geboten, daß sie die Vielfalt und Unübersehbarkeit der Handlungssituationen nicht erfassen. Dadurch kann das Gewissen in Spannung zu vorgegebenen positiven Normen geraten.
Die christliche Ethik sucht die Spannung zwischen positivem Gesetz und Gewissen mit Hilfe der Epikie zu lösen. Die Tradition versteht unter Epikie (griechisch: epieikeia, lateinisch: aequitas = Billigkeit) das rechte Verhalten des Menschen, das im Umgang mit positiven Gesetzesnormen nach dem Prinzip der Zumutbarkeit, der Angemessenheit und der Billigkeit vorgeht. Nach Thomas von Aquin ist die Epikie "gleichsam eine höhere Regel für die menschlichen Akte" (S. th. II II q. 120, art. 2). Es kann sein, daß in einer konkreten Situation der Sinn einer Norm sich nicht erfüllt, wenn man sie dem Wortlaut nach einhält. In der Epikie erfaßt der Mensch den in der Norm zu schützenden Wert und handelt im Einzelfall gegen den Buchstaben des Gesetzes, um dessen Geist gerecht zu werden. Epikie ist eine sittliche Haltung, die in der Gewissensfreiheit gründet. Epikie setzt Verantwortung für die Norm wie für die eigene Person, ein wirkliches Wertempfinden und Klugheit voraus. Es geht in der Epikie weder um Willkür und Laxheit noch um den Versuch, geltende Normen zu umgehen, sondern es geht um Mündigkeit im Tun dessen, was das Gewissen für sich als das Bessere und Anspruchsvollere erkennt.
Von dieser Sicht her entspricht die Antwort auf die Frage nach dem Gewicht des Gewissens als "letzte maßgebliche Norm der persönlichen Sittlichkeit" (VS 60) der des Apostels Paulus (vgl. S. 124-127): In einer Situation, in welcher der einzelne in einer Spannung zwischen Norm und Gewissen handeln muß, ist seine Gewissenserkenntnis und sein Gewissensurteil für ihn die letzte Norm seines Handelns. Da aber seine Gewissenseinsicht keinen Anspruch auf Unfehlbarkeit hat, muß er bereit sein, sich immer neu zu prüfen. Für seine persönliche Gewissensbildung ist entscheidend, daß er innere Barrieren gegen die sittlichen Forderungen abbaut und eine wachsende Einsicht in den Wert des Wahren und Guten gewinnt.
4. Gewissenserziehung und Gewissensbildung
4.1. Das mündige Gewissen als Ziel der Gewissenserziehung und Gewissensbildung
Wir sind nicht nur vor unserem Gewissen verantwortlich, sondern auch für unser Gewissen. Wir müssen es bilden, damit es ein "mündiges Gewissen" ist. Das Wort vom "mündigen Gewissen" ist heute weitverbreitet, doch verstehen viele Menschen darunter ganz Unterschiedliches. Mancher meint, er sei mündig, wenn er das tut, was den persönlichen Wünschen und Bedürfnissen entspricht. Ein anderer glaubt, Mündigkeit bestehe darin, daß er sich von jeder "Bevormundung" durch Autoritäten, Gesetze und Normen löse und sich frei selbstverwirkliche. Diese und ähnliche Vorstellungen von Mündigkeit haben mit wirklicher Mündigkeit nichts zu tun. Wer sich individualistisch auf die Erfüllung seiner Wünsche und Begierden konzentriert, macht sich von seinen Wünschen und Begierden abhängig; und wer sich auf Kosten anderer selbstverwirklichen will, handelt nicht mündig, sondern verantwortungslos. Mündigkeit ist nicht Beliebigkeit und Rücksichtslosigkeit, sondern angesichts der sittlichen Forderung frei übernommene Verantwortlichkeit. Sie ist mit der Bereitschaft verbunden, wirklichkeitsgerecht zu handeln. Ein mündiges Gewissen ist ein sittlich reifes Gewissen, das sich bewährt in der Verwirklichung sittlicher Überzeugungen, in der verantwortlichen Annahme von Werten und in der sach- und situationsgerechten Bewältigung von Konflikten.
Hierzu ist der Mensch immer auf dem Wege. Das mündige Gewissen ist nie mit sich fertig; es muß beständig reifen.
In der heutigen Welt werden wir von allen Seiten mit einer Fülle von Wörtern, Meinungen, Behauptungen und Überzeugungen konfrontiert. Unterschiedliche Weltanschauungen, Ideologien und Lebensstile drängen sich uns auf, suchen uns zu beeinflussen und für sich zu gewinnen. Um diesem breiten Ansturm begegnen zu können, ist vor allem die Wachsamkeit des Gewissens nötig. Welchem Wort leihen wir unser Ohr? Von welcher Meinung lassen wir uns beeinflussen? Welcher Lebensstil zieht uns an? Wachsamkeit des Gewissens meint in alledem für den Glaubenden in erster Linie, daß er Ohr und Herz öffnet für das Wort Gottes. Das wache Gewissen hört auf die Worte, die Jesus sagt, und schaut auf ihn selbst, auf sein Leben für die Menschen und mit den Menschen, auf seinen Ruf zur Nachfolge und auf seine Weisung. Ein waches Gewissen bewertet alles im Licht des Evangeliums und sucht zu unterscheiden, ob und wie in menschlichen Worten und Überzeugungen, Urteilen und Lebensstilen Elemente enthalten sind, die den Menschen der Wahrheit über sich selbst näher bringen, die "Zivilisation der Liebe" (PP 76) fördern und so dem Geist des Evangeliums entsprechen.
Das Neue Testament verbindet mit der Wachsamkeit des Gewissens das Gebet: "Wachet und betet" (Mk 14,38 par.; Lk 21,36). Im Gebet öffnen wir uns für Gott, hören auf sein Wort und gewinnen im Gespräch mit ihm die Bereitschaft, auf seinen Willen einzugehen. So werden wir in der Wachsamkeit des Gewissens gewahr, daß jede Zeit unseres Lebens und jede Situation, bis in den Alltag hinein, eine Zeit der Gnade (Kairos) ist. Wachen Gewissens sollen wir auch offen sein für neue Ziele, für bessere Einsichten und für die Bereitschaft, überholte Standpunkte aufzugeben.
Zur Wachsamkeit gehört innere Freiheit. Dies besagt gerade nicht, daß ein Mensch bindungslos ist, sondern daß er sich durch nichts und niemand manipulieren läßt. Hierin erweist das Gewissen seine Selbständigkeit. Diese ist nicht immer leicht zu verwirklichen. Unabhängig und selbständig Wertentscheidungen durchzuhalten erfordert Mut und innere Kraft, besonders dann, wenn mit Widerstand oder gar Bestrafung und Verfolgung zu rechnen ist.
Ein besonderes Kennzeichen des mündigen Gewissens ist seine Empfindsamkeit für Gut und Böse. Menschen mit einem empfindsamen Gewissen haben ein besonderes Gespür dafür, daß sie kostbare Schätze in zerbrechlichen Gefäßen tragen. Das empfindsame Gewissen reagiert auf jede Abweichung von der Grundausrichtung und auf jedes Fehlverhalten. Wir begegnen einer solchen Sensibilität bei Menschen, die sich in die Situationen von Armen, Kranken und Unterdrückten hineinfühlen und sich gegen Ungerechtigkeit, Unfrieden und Zerstörung der Schöpfung einsetzen. Solche Empfindsamkeit ist Zeichen eines mündigen Gewissens und hat nichts zu tun mit jener Überempfindlichkeit des skrupulösen Gewissens, das zwanghaft seiner Überängstlichkeit ausgeliefert ist.
Die Sensibilität als emotionales Element des Gewissens soll immer verbunden sein mit der Klugheit als dem intellektuellen Element des Gewissens. Klugheit darf nicht verwechselt werden mit jener Schlauheit und Berechnung, die bestrebt ist, immer und überall ungeschoren davonzukommen, und nur auf den eigenen Vorteil bedacht ist. Klugheit ist vielmehr jene Tugend, die dazu befähigt, die verschiedenen Situationen zu durchleuchten und sie daraufhin zu beurteilen, ob und wie in ihnen sittlich verantwortbares Handeln zu verwirklichen ist. In der christlichen Ethik gilt die Klugheit als bevorzugte sittliche Tugend. Sie ist durchformt von der Liebe zu Gott und dem Nächsten. Diese ruft das Gewissen auf, die "Torheit des Kreuzes" anzunehmen und die berechnende "Weisheit der Weisen vergessen und die Klugheit der Klugen verschwinden" zu lassen (1 Kor 1,19). Das von Glaube und Liebe geprägte Gewissen läßt sich von der Grundentscheidung zum Guten leiten und bewertet das eigene Wollen und Tun im Licht dieser Entscheidung. Voraussetzung für die kluge Urteilsfindung in der konkreten Situation ist nicht nur das Wissen um verpflichtende Weisungen, sondern auch die Einsicht in die Werte, die in der Weisung enthalten sind, und ein gewisses Maß an Sachwissen und Erfahrung. Alle diese Momente zusammengenommen ermöglichen es dem Menschen, in kluger Abwägung ein Urteil darüber zu fällen, was in der konkreten Situation im Gewissen verpflichtend ist. Das kluge Gewissen urteilt nicht allein mit dem Verstand, sondern vor allem mit dem "Herzen", mit der ganzen Person.
4.2. Wege zur Gewissenserziehung und Gewissensbildung
In den Wissenschaften, die sich mit Gewissenserziehung und Gewissensbildung befassen, besteht heute Einigkeit darüber, daß das Gewissen sich weder allein aus sich selbst heraus entwickelt, noch daß es allein durch äußere Beeinflussung gebildet und geformt wird. Entwicklung und Erziehung des Gewissens geschehen durch Innen- wie durch Außensteuerung. Beide Momente sind aufeinander bezogen und ergänzen einander. Jeder einzelne bildet und formt sein Gewissen, aber das Gewissen bedarf auch der Weckung und Orientierung durch andere, durch Werte und durch Normen. Darum ist antiautoritäre Erziehung ein Irrweg. Wenn der Mensch zu mündiger Gewissensverantwortung kommen soll, dürfen die Erzieher nicht nur, sie müssen erziehen.
Gewissenserziehung und Gewissensbildung müssen den Entwicklungsphasen des Gewissens (vgl. S. 132f) entsprechen. Folgende Erziehungsgrundsätze ergeben sich:
Gewissenserziehung muß im frühkindlichen Alter beginnen. Sie besteht zunächst in der Annahme des Kindes; in ihr wird jenes Urvertrauen vermittelt, das jeder gesunden Gewissensentwicklung zugrunde liegen muß.
- Gewissenserziehung im Kindesalter muß so beschaffen sein, daß das Kind in einem allmählichen Prozeß das Gespür für gut und böse, richtig und falsch entwickeln kann. Das geschieht am besten dadurch, daß es Freude am Guten gewinnt. So wird es zur Einsicht in Wert und Bedeutung von sittlichen Ansprüchen geführt und zu Selbstbesinnung und Selbstbindung angeregt. Hier ist der Beitrag der Eltern von entscheidender Bedeutung; die Art ihres Wertens und Handelns überträgt sich auf das Kind. Das gemeinsame Gebet und die Gewissenserforschung mit dem Kind sind dabei eine wichtige Hilfe.
- Gewissenserziehung im Jugendalter muß Erziehung zur Übernahme von Eigenverantwortung sein. Der Jugendliche darf weder zu sehr eingeengt noch bei Fehlverhalten alleingelassen werden. Forderungen müssen sein, dürfen aber nicht überfordern; sie müssen einsehbar sein und beim Jugendlichen zur Überzeugung führen können, daß es sinnvoll ist, sie sich zu eigen zu machen und nach ihnen zu leben.
- Gewissenserziehung muß dazu befähigen, daß ein Mensch lebenslang sein Gewissen bildet. Darum muß Gewissenserziehung auch Lehre, Unterricht und Argumentation über Werte, Normen und Gebote enthalten, aber sie darf nicht nur Wissensvermittlung sein, denn das Gewissen betrifft nicht nur den Intellekt; Gewissenserziehung muß auch Appelle und Impulse an Willen und Gefühl enthalten. Sie darf aber nicht nur emotionale Anregung sein, denn das Gewissen gehört nicht nur dem willentlichen und emotionalen Bereich an. Gewissenserziehung muß die ganze Person umfassen, denn das Gewissen betrifft die "Mitte der Person" und reicht bis in die Tiefe ihrer Existenz.
Gewissenserziehung muß in die Glaubenserziehung eingebettet sein, denn in ihr wird die Erfahrung von Geborgenheit zur Geborgenheit in Gott, die Erfahrung des sittlichen Anspruchs zur freien Bindung an das Gute, die Erfahrung von Geboten zur Erfahrung des Anrufes Gottes an die Freiheit des Menschen.
- Gewissenserziehung, Gewissensbildung und Leben nach dem Gewissen sind in der säkularisierten pluralistischen Gesellschaft der Gegenwart sicher schwieriger geworden, aber sie haben heute auch große Chancen. Entscheidende Voraussetzung für die Gewissenserziehung bei Kindern und die Gewissensbildung von Jugendlichen ist das mündige Gewissen der Erwachsenen. Nur wer sich im und vom eigenen Gewissen betroffen weiß und beständig zu Einkehr und Umkehr bereit ist, kann das Betroffensein des Menschen im Gewissen vermitteln. Was nottut, ist die regelmäßige Gewissenserforschung, in der sich das Gewissen dem Versagen wie dem Anspruch zum Gutsein in der jeweiligen Situation stellt und zu verantwortlicher Lebensgestaltung bereit ist. In jeder neuen Entscheidung wird das Gewissen geformt. Für den Glaubenden ist jede Gewissensentscheidung zugleich eine Glaubensentscheidung. Das Wort des Apostels Paulus "Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde" (Röm 14,23), weist darauf hin, daß Glaube und Gewissen zusammengehören. Der Glaubende soll seine Überzeugung des Glaubens im gewissenhaften Handeln realisieren. In solchem Handeln wird er mit sich selbst identisch, wenn es "aus ganzem Herzen" geschieht.
Wer bereit ist, diesen Weg des Gewissens zu gehen, wird bewußt auch zu seinen eigenen Grenzen stehen können und stets nach besseren Wegen seiner Gewissensverantwortung suchen: in Gebet und Meditation, im Gespräch mit Mitmenschen, im geistlichen Gespräch und im Bußsakrament, im Mitdenken und Mithandeln in der Gemeinde, in Kirche und Gesellschaft.
5. Gewissensfreiheit
Die Rede von der Gewissensfreiheit hat es nicht immer gegeben. Bittere Erfahrungen der Geschichte haben zur Forderung nach Gewissens- und Religionsfreiheit geführt. In den nach der Reformationszeit geführten Kriegen hatte es sich als unmöglich erwiesen - ja geradezu als tödliche Bedrohung für das Zusammenleben der Menschen -, Meinungsunterschiede in religiösen und sittlichen Fragen durch Gewalt aufheben zu wollen. Im Zeitalter des Absolutismus hatten die Fürsten noch einmal die Vollmacht erhalten, den Glauben ihrer Bürger zu bestimmen (Cuius regio eius religio). Das konnte aber den Gang der Geschichte nicht aufhalten. Im Zusammenhang mit der geistesgeschichtlichen Bewegung der Aufklärung, mit einer neuen Wertung der Vernunft und der Freiheit des Menschen kam es zur Formulierung von Menschenrechten, die den einzelnen vor unangemessenen Übergriffen des Staates schützen sollten. Der für die Würde des Menschen zentrale Bereich des Gewissens wurde durch die Forderung der Gewissensfreiheit geschützt.
Da die Forderung nach Gewährleistung der Menschenrechte, insbesondere der Gewissensfreiheit und der Religionsfreiheit, anfänglich auch unter antikirchlichen Vorzeichen erhoben wurde, haben mehrere Päpste des 19. Jahrhunderts den Gedanken der Gewissensfreiheit verworfen (Gregor XVI. und Pius IX.). Im weiteren geschichtlichen Entwicklungsgang wurde in der Kirche aber mehr und mehr erkannt, daß in ihrem eigenen Erbe grundlegende Momente eines Toleranzethos gegeben sind. Toleranz meint die Haltung eines Menschen, der andere respektiert, obwohl sie andere Meinungen und Überzeugungen vertreten. Im ersten Brief an die Gemeinde in Korinth begründet der Apostel Paulus die Haltung der Toleranz an einem Beispiel. Er fordert die Gemeindeglieder mit einem starken Gewissen auf, Rücksicht zu nehmen auf andere, die ein schwaches Gewissen haben (vgl. 1 Kor 8).
Die heutige ethische und rechtliche Begründung der Gewissensfreiheit geht von einem Verständnis der Gewissensentscheidung aus, über das bei den Menschen ganz allgemein Übereinstimmung erzielt werden kann. Danach ist eine Gewissensentscheidung jede ernste sittliche, das heißt an den Kategorien von Gut und Böse orientierte Entscheidung, die der einzelne in einer bestimmten Lage als für sich bindend und unbedingt verpflichtend innerlich erfährt, so daß er gegen sie nicht ohne ernste Gewissensnot handeln könnte. Nun sind solche Gewissensentscheidungen zwar "einsame" Entscheidungen, aber es sind immer Entscheidungen, die in einem sozialen Zusammenhang stehen. Daraus ergibt sich die Frage, wie in der modernen Gesellschaft, in der es unterschiedliche Überzeugungen in Fragen des Glaubens und der Sittlichkeit gibt, jedem einzelnen Menschen in der Gesellschaft ein Raum gewährt wird, der es ihm erlaubt, nach seinem Gewissen zu leben, denn das allein entspricht der Würde der Person. Moderne demokratische Verfassungen haben deshalb die Gewährleistung der "Freiheit des Gewissens" in den Katalog der vom Staat zu gewährleistenden Grundrechte aufgenommen (Art. 4 Abs. 1 GG der Bundesrepublik Deutschland). Die Respektierung der "Freiheit des Gewissens" liegt in der Konsequenz einer rechtsstaatlichen Grundordnung, die auf der Würde und Unantastbarkeit der Person aufbaut. Das gleiche gilt auch für die Glaubens- und Bekenntnisfreiheit.
Das Zweite Vatikanische Konzil, das die Gewissensfreiheit in engem Zusammenhang mit der Religionsfreiheit sieht, geht in seiner "Erklärung über die Religionsfreiheit" vom 7. 12. 1965 ebenfalls von der Würde der menschlichen Person aus. Diese "kommt den Menschen unserer Zeit immer mehr zum Bewußtsein, und es wächst die Zahl derer, die den Anspruch erheben, daß die Menschen bei ihrem Tun ihr eigenes Urteil und eine verantwortliche Freiheit besitzen und davon Gebrauch machen sollen, nicht unter Zwang, sondern vom Bewußtsein der Pflicht geleitet" (DH 1). Der entscheidende Text zur religiösen Freiheit lautet:
- Diese Freiheit besteht darin, daß alle Menschen frei sein müssen von jedem Zwang sowohl von seiten Einzelner wie gesellschaftlicher Gruppen, wie jeglicher menschlicher Gewalt, so daß in religiösen Dingen niemand gezwungen wird, gegen sein Gewissen zu handeln, noch daran gehindert wird, privat und öffentlich, als einzelner oder in Verbindung mit anderen - innerhalb der gebührenden Grenzen - nach seinem Gewissen zu handeln" (DH 2).
Diese Bestimmung der Gewissensfreiheit enthält zwei wichtige Momente, die für deren Ausübung von Bedeutung sind. Zum einen besagt Freiheit des Gewissens, daß niemand gezwungen werden darf, gegen sein Gewissen zu handeln. Zum anderen weist das Konzil darauf hin, daß dem einzelnen die Ausübung der Freiheit des Gewissens nur "innerhalb der gebührenden Grenzen" zusteht.
Die Forderung nach Freiheit des Gewissens von jedem Zwang bezieht sich auf die Gewissensbildung und Gewissensentscheidung. Eine Beeinflussung oder gar ein schwerer Zwang von außen könnte zum Beispiel durch Drogen, "Gehirnwäsche" oder andere Praktiken geschehen. Eine Bedrohung der eigenverantwortlichen Gewissensbildung und eine Beeinflussung der Gewissensentscheidung können heute durch vielerlei Zwänge gegeben sein: durch Gruppen, durch gesellschaftliche Moden, durch Propaganda oder ähnliches. Von innen her kann die Gewissensfreiheit gefährdet werden, wenn die Berufung auf das Gewissen zum Vorwand wird, grundlegenden Verpflichtungen aus dem Weg zu gehen. Hier wird die Forderung nach Gewissensfreiheit zum Deckmantel für Willkür. Einer solchen Gefährdung sind wir vielfach ausgesetzt, zumal wir dazu neigen, unangenehmen Verpflichtungen aus dem Weg zu gehen. Wer sich auf sein Gewissen beruft, hat ehrlich zu prüfen, ob es wirklich die Stimme des Gewissens ist oder ob es sich um geheime Wünsche, bloße Bedenken gegenüber einer Verpflichtung oder einfach nur um Entrüstung handelt. Oft ist es sehr schwer, das bis ins Tiefste zu beurteilen.
Weitaus schwieriger ist die Frage nach der Ausübung der Freiheit des Gewissens "innerhalb der gebührenden Grenzen" zu lösen. Welches sind solche "gebührende" Grenzen der Gewissensfreiheit? Erlaubt die Würde und Unantastbarkeit der Person überhaupt irgendwelche Begrenzungen der Freiheit? Eine Antwort auf diese Fragen ist nur möglich, wenn wir bedenken, daß Freiheit und Gewissensfreiheit nicht individualistisch zu verstehen sind. Freiheit ist nicht nur "meine" Freiheit, sondern sie ist immer auch die Freiheit der "anderen". Ich habe innerhalb der sittlichen und der rechtlichen Ordnung nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten, an die ich in meiner Freiheit und in meinem Gewissen gebunden bin. Deshalb hat die Ausübung der Gewissensfreiheit eine Grenze am fundamentalen Bestand gemeinsamer sittlicher Grundwerte, an der Verfassungsordnung und an fremden Gemein- und Individualgütern. Die Berufung auf die Gewissensfreiheit darf niemals dazu führen, daß man in die Rechte anderer eingreift oder gar anderen Schaden zufügt.
Die Ordnungen des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates zielen nicht auf eine Einschränkung der sittlichen Freiheitsentscheidung, sondern auf deren Schutz und Sicherung. Sie stecken zugleich den Rahmen ihrer Ermöglichung ab. Eindeutig gemeinschaftszerstörende Handlungen haben mit dem Recht auf Gewissensfreiheit nichts zu tun. Für Terrorismus, Mord, Abtreibung, Raub und Diebstahl, Kindesmißhandlung, Vergewaltigung, Folterung und Rauschgifthandel kann es keine Berufung auf die Gewissensfreiheit geben. Anders ist es jedoch bei Gewissensüberzeugungen, die zwar konkrete Rechtsordnungen berühren, aber die Grundordnung des Gemeinwesens und die Loyalität ihm gegenüber nicht gefährden oder gar zerstören. Deshalb garantieren freiheitlich-demokratische Rechtsstaaten im Zusammenhang mit dem Recht auf Gewissensfreiheit zum Beispiel das Recht auf Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen. Um der Gewissensnot auszuweichen, in die der einzelne gerät, hält die Rechtsordnung vieler Staaten als Alternative den "Ersatzdienst" (Zivildienst) bereit. Die Rechtsordnung kann somit die Unterlassung von Handlungen gestatten, die das Gewissen verbietet (Wehrdienst), nicht aber jedes aktive Tun, welches das Gewissen gebietet (Euthanasie, Gewaltverbrechen, Terrorakte).
Manche Staaten verlangen von Wehrdienstverweigerern eine "Gewissensüberprüfung" durch ein Gremium. Ob die Möglichkeit, eine persönliche Gewissensüberzeugung zu überprüfen, überhaupt besteht, ist schon für den einzelnen selbst bei seiner eigenen Gewissensüberzeugung nur äußerst schwer zu klären. Weitaus schwieriger dürfte es für ein Gremium sein, das die Aufgabe hat, die Gewissensüberzeugung eines anderen zu überprüfen.
In einem letzten Sinn entzieht sich das Gewissen einer solchen Überprüfung. Allenfalls können Kriterien aufgestellt werden, nach denen die Glaubwürdigkeit des Betreffenden, nicht aber dessen persönliche Gewissensüberzeugung beurteilt wird.
Bei rechtlichen Regelungen über die Ausübung der sittlichen Entscheidungsfreiheit ist darauf zu achten, daß sie die Gewissensfreiheit nicht einschränken, sondern ermöglichen und einen breiten Raum für Eigeninitiativen offenhalten. Von der Ausübung der Gewissensfreiheit kann in Gesellschaft und Kirche eine erneuernde Kraft ausgehen und ein tieferes Gespür für mehr Menschlichkeit entwickelt werden. Große Impulse zur Änderung des Bewußtseins gehen in der Weltgeschichte wie in der Kirchengeschichte häufig von einzelnen Personen oder von kleinen Gruppen und Gemeinschaften aus, die sich vom Anruf ihres persönlichen Gewissens leiten lassen.
Für den Glaubenden ist der Anruf des Gewissens immer ein Anruf Gottes an die Freiheit des nach dem Bilde Gottes geschaffenen Menschen. In verantworteter Freiheit sollen wir bemüht sein, unsere Glaubensüberzeugung im Leben aus dem Glauben zu verwirklichen. Die sittliche Botschaft der Kirche weist uns dabei auf die Rahmenbedingungen hin, die uns von Gott für den Weg mit Gott und den Mitmenschen vorgegeben und aufgegeben sind: auf die Zehn Gebote als Orientierungen für ein humanes Gelingen unseres Lebens. Um diese Orientierungen, die uns in der "Mitte der Person", im Gewissen, zur gewissenhaften Antwort aufrufen, geht es im folgenden zweiten Teil.
Zweiter Teil: Die Gebote Gottes
Die Zehn Gebote
- Ich bin Jahwe, dein Gott,
- der dich aus Ägypten geführt hat,
- aus dem Sklavenhaus.
- (Ex 20,2; Dtn 5,6)
- Du sollst keine anderen Götter
- neben mir haben:
- Du sollst den Namen Gottes
- nicht verunehren
- Gedenke, daß du den Sabbat heiligst
- Du sollst Vater und Mutter ehren
- Du sollst nicht töten
- Du sollst nicht ehebrechen
- Du sollst nicht stehlen
- Du sollst kein falsches Zeugnis geben
- wider deinen Nächsten
- Du sollst nicht begehren
- deines Nächsten Frau
- Du sollst nicht begehren
- deines Nächsten Hab und Gut
Im katholischen Gebet- und Gesangbuch "Gotteslob" (Nr. 61) findet sich eine Abweichung von dieser Zählung. Das sechste und neunte sowie das siebte und zehnte Gebot bilden jeweils ein einziges Gebot. In gleicher Weise geht auch der Katholische Erwachsenen-Katechismus Zweiter Band vor, so daß sich acht Abschnitte über die Gebote ergeben. Der Erwachsenen-Katechismus weicht darüber hinaus von der traditionell-kirchlichen Formulierung des Vorspruchs ab, als er an ihre Stelle das biblische Vorwort setzt und vor jedes einzelne Gebot den anrufenden Vorspruch stellt: "Ich bin dein Gott, der dir Leben und Zukunft schenkt." Nach dem Gebotstext folgt jeweils ein erläuternder "Merksatz".
Das Hauptgebot der Liebe
- "Du sollst den Herrn, deinen Gott,
- lieben mit ganzem Herzen
- und ganzer Seele,
- mit all deinen Gedanken
- und all deiner Kraft.
- Als zweites kommt hinzu:
- Du sollst deinen Nächsten
- lieben wie dich selbst.
- Kein anderes Gebot ist größer
- als diese beiden."
- (Mk 12,30f)
Einführung: Die Gebote Gottes als Wegweisung zum Leben
Wir können die Bedeutung der Zehn Gebote nur verstehen, wenn wir die Geschichte Gottes mit seinem Volk bedenken. Sie wird von Gott selbst eröffnet, der seinen Namen offenbart. Der Gottesname Jahwe bedeutet: Ich-bin-da (Ex 3,14); Ich bin bei euch; Ich werde immer bei euch sein! "Ich nehme euch als mein Volk an und werde euer Gott sein" (Ex 6,7; Lev 26,12).
Diesem Gott, der immer als Gott der getreuen Zuwendung zum Menschen und zur Welt da sein wird, kann Israel vertrauen; denn er stellt sich dem Volk als ein Gott vor, der befreit und aus der Unterdrückung in Ägypten errettet:
- "Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus" (Ex 20,2; Dtn 5,6).
Gott ruft dieses Volk mit ungeteilter Bundesliebe in seine Nähe; er umwirbt es und geht ihm auch dann noch nach, wenn es den Bund mit Gott bricht und ihm untreu wird:
- "Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir so lange die Treue bewahrt" (Jer 31,3).
Gott verheißt dem Gottesvolk im Bundesschluß nicht nur seine Treue, sondern stellt ihm in der Urkunde des Bundes auch die "Zehn Worte" (Dekalog) vor Augen. Ihr Sinn ist es, die Ordnung des Bundes zu bewahren. Sie sollen dem Gottesvolk die Wege weisen, die ins endgültige Heil führen (vgl. Ex 20,1-17; Dtn 5,6-21), sind also zugleich Worte der Zuwendung und der Ermutigung. Es geht in ihnen nicht darum, die Freiheit einzuengen, sondern zu verdeutlichen, wie die freie Annahme und Beantwortung der Liebe Gottes das Verhalten der Menschen zum Guten verändert.
In alten Kirchen finden wir - häufig in der Nähe der Kanzel - die Zehn Worte auf zwei Tafeln dargestellt. Die erste Tafel enthält die Gebote, die sich auf das Verhältnis des Menschen zu Gott beziehen (I-III); auf der zweiten Tafel stehen jene Gebote, die das Verhältnis des Menschen zur menschlichen Gemeinschaft betreffen (IV-X). Die Künstler greifen dabei auf die biblische Erzählung zurück, nach der Mose den Dekalog von Gott auf zwei Tafeln erhielt (vgl. Ex 32,15; Dtn 5,22 u. ö.).
Die Zehn Gebote, schon vom Alten Testament selbst als "Zehn Worte" bezeichnet (vgl. Ex 34,28; Dtn 4,13; 5,22), werden zweimal überliefert. Sie stehen im Buch Exodus, Kapitel 20, und im Buch Deuteronomium, Kapitel 5.
Die biblischen Autoren haben dem Dekalog einen ausgezeichneten Ort zugewiesen: In Ex 20 eröffnet er die Erzählung von der Offenbarung Gottes am Sinai, in Dtn 5 wird er als eine Art zusammenfassende Vorwegnahme vor die anderen Gebote und Rechtssatzungen gestellt, die Israel für das Leben im Gelobten Land gegeben werden. Auch sagen die biblischen Autoren nur vom Dekalog, nicht aber von den anderen Geboten und Gesetzen, daß sie der Herr selbst ohne Vermittlung eines Menschen zu Israel geredet (vgl. Dtn 5,4) und daß er selbst sie auf die beiden Tafeln geschrieben hat (vgl. Ex 32,15f u. ö.). Die Bibel selbst sieht also in den Zehn Geboten eine Art Kurzformel der gläubigen Existenz vor Gott, und so konnte der Dekalog in der christlichen Tradition die Grundlage der ethischen Unterweisung werden.
Viele halten heute eine Orientierung des christlichen Lebens an den Zehn Geboten nicht mehr für möglich oder äußern Bedenken dagegen und sagen: Die Gebote sind Gotteswort in der menschlichen Sprache einer bestimmten Kultur; sie sind in ganz andere Zeit- und Lebensverhältnisse hinein verkündet worden und sprechen viele Probleme unseres heutigen Lebens gar nicht an. Kommt ihnen eine über die damalige Zeit und über die frühere semitische Gesellschaft hinausgehende ethische Verbindlichkeit überhaupt noch zu? Auch wendet man ein: Ist eine Moral, die sich an den Zehn Geboten orientiert, nicht eine Gebots- und Verbotsmoral, die in unzulässiger Weise die Freiheit beschränkt, zu der uns Jesus Christus befreit hat?
Damals wie heute geht es in den Geboten um die Sicherung eines Freiheitsraumes, der menschliches Leben ermöglicht; die Gebote schützen Werte und Güter des Menschen, wann und wo immer er lebt; in ihren Forderungen spiegeln sich sittliche Erkenntnisse des Gottesvolkes wider, in welchen fundamentale Werte des menschlichen Lebens und Zusammenlebens Eingang gefunden haben, die immer gültig sind. Indem das gläubige Gottesvolk sie annimmt und befolgt, bekundet es seine Bereitschaft, sein Dasein ganz der Führung Gottes anzuvertrauen. Wenn gegenwärtig manche dieser Grundwerte und die ihnen entsprechenden Orientierungen in der Gesellschaft ihre verpflichtende Kraft zu verlieren drohen oder sie gar schon eingebüßt haben, ist die Freiheit des Menschen in Gefahr; und es ist um so dringlicher, ihre Wahrheit und ihren unaufgebbaren Anspruch in neuer Weise ins Bewußtsein zu rufen.
Der bleibende Grund, auf dem die Zehn Gebote auch heute zu sehen sind, ist die Offenbarung Gottes: "Ich-bin-da" (Ex 3,14); Ich bin für euch da! Ich bin bei euch! Dieses Wort steht vor und über allen Orientierungen in Geboten und Verboten. Es begründet, warum es für den Menschen segensvoll ist, sich an Gottes Weisungen zu halten; denn in diesem Wort offenbart sich Gott als Gott des Lebens, der uns durch die Geschichte unseres Lebens begleitet. Sein Wort ist bleibende Zusage und Verpflichtung.
In Jesus Christus wird endgültig offenbar, daß Gott uns liebt und Leben und Zukunft schenkt. Er ruft uns in der Nachfolge in die Liebe, die Jesus als höchstes und wichtigstes Gebot verkündet, in die Gottes- und Nächstenliebe:
- "Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden" (Mk 12,30f).
Das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe hebt die Zehn Worte des Alten Bundes nicht auf, sondern bringt sie zur Vollendung.
Nach dem heiligen Paulus ist die Nächstenliebe die Zusammenfassung der Gebote: "Wer den andern liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote: Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, und alle anderen Gebote sind in dem einen Satz zusammengefaßt: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst" (Röm 13,9).
Die Kirche verkündet durch die Jahrhunderte in den Zehn Geboten und im Gebot der Gottes- und Nächstenliebe ihr "sittliches Credo". Mit ihr und in ihr verstehen wir die Gebote nicht als Einengung unserer Freiheit, sondern als Wegweisung Gottes für ein Leben der Liebe zu Gott und den Menschen. Damals wie heute gilt:
- "Dieses Gebot, auf das ich dich heute verpflichte, geht nicht über deine Kraft und ist nicht fern von dir. Es ist nicht im Himmel, so daß du sagen müßtest: Wer steigt für uns in den Himmel hinauf, holt es herunter und verkündet es uns, damit wir es halten können? Es ist auch nicht jenseits des Meeres, so daß du sagen müßtest: Wer fährt für uns über das Meer, holt es herüber und verkündet es uns, damit wir es halten können? Nein, das Wort ist ganz nah bei dir, es ist in deinem Mund und in deinem Herzen, du kannst es halten" (Dtn 30,11-14).
I. Erstes Gebot: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben
Ich bin dein Gott, der dir Leben und Zukunft schenkt
Du sollst keine anderen Götter neben mir haben
(Erstes Gebot)
Gott will, daß wir ihm allein vertrauen und uns nicht an Mächte binden, die uns von ihm trennen.
1. Der Ruf zur Bindung an den einen Gott
1.1. Der Wortlaut des Gebotes
Der Text des Gebotes lautet im Buch Exodus:
"Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgend etwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen und dich nicht verpflichten, ihnen zu dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Bei denen, die mir feind sind, verfolge ich die Schuld der Väter an den Söhnen, an der dritten und vierten Generation; bei denen, die mich lieben und meine Gebote achten, erweise ich Tausenden meine Huld" (20,3-6).
Im Buch Deuteronomium ist der Text bis auf eine kleine Änderung gleichlautend mit dem Gebot im Buch Exodus. Anstelle von "Du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgend etwas am Himmel . . ." (20,4) heißt es im Deuteronomium: "Du sollst dir kein Gottesbild machen, das irgend etwas darstellt am Himmel . . ." (5,8).
1.2. Sinn und Bedeutung des Gebotes
Das erste Gebot ruft den Menschen auf, neben Gott keine anderen Götter zu haben. Dieser Anspruch setzt die Selbstmitteilung Gottes voraus, von der das Wort spricht, das über dem ganzen Dekalog steht: "Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus" (Dtn 5,6). Weil Gott sich als der eine und einzige Retter erwiesen hat, kann er dem Volk sagen: "Du sollst keine anderen Götter neben mir haben" (Dtn 5,7; Ex 20,3).
Dieses Wort, das in Erinnerung ruft: Ich habe dich aus Ägypten geführt, dem Sklavenhaus, ist bei jedem einzelnen der Gebote hinzuzudenken. Dadurch wird deutlich, daß das Handeln Israels nach den Geboten den Charakter der Antwort hat. Zuerst hat Gott befreiend gehandelt; nun ist das Volk aufgerufen, als ein von Gott befreites zu leben. Die Sprache des Gebotes ist eigentlich "futurisch" zu lesen: Ich habe euch befreit, deshalb werdet ihr die Gebote halten!
Eine Erläuterung dieses Wortes bietet im Alten Testament der Prophet Hosea, der dem Volk das Wort Jahwes in Erinnerung ruft: "Ich aber, ich bin der Herr, dein Gott, seit der Zeit in Ägypten; du sollst keinen anderen Gott kennen als mich. Es gibt keinen anderen Retter außer mir" (Hos 13,4). Hosea erinnert an die Zeit der Unterdrückung in Ägypten. Hier war Gott der einzige, der Rettung und Befreiung brachte "aus dem Sklavenhaus". Er hat sich dieses Volk als Eigentum erwählt, er hat mit ihm einen Bund geschlossen und ihm für alle Zeiten seine Treue verheißen. Ihm, dem einzigen Retter und Befreier, kann und soll sich das Volk anvertrauen und keinen anderen Gott kennen als ihn allein.
Das Gotteswort des ersten Gebotes ist nicht ein Anspruch, wie ihn die furchterregenden Götter der Umwelt oder weltliche Herrscher erheben. Sie zwingen oftmals die Menschen unter ihr Joch, um über sie verfügen zu können. Der Anspruch des ersten Gebotes dagegen ist ein Anspruch, der aus der Liebe Gottes stammt (vgl. KKK 2061). Gott hat im Mitgehen mit dem Volk seine Liebe erwiesen. Darum kann und darf das Volk niemand als Gott anerkennen als den einzigen Gott, der sich den Menschen in Liebe zugesagt hat. Gott fordert diese ausschließliche Zustimmung; er weiß, daß wir nur in ihm unsere tiefste Sehnsucht nach Leben und Sinn erfüllt finden. Wer um diese Liebe weiß, wer an sie glaubt und ihr vertraut, bindet sich an keine Götter: "Gott allein genügt" (Theresia von Jesus). Darum heißt das erste Gebot eigentlich: Du wirst keine anderen Götter neben mir haben! Das bedeutet: Im Rahmen des Bundes mit mir wirst du keine anderen Götter anerkennen; du brauchst es gar nicht, denn du wirst immer wieder erfahren: Ich, Jahwe, allein genüge. Der Mensch ist auf Gott hin geschaffen. In dem einmaligen Verhältnis, das Gott zu jedem einzelnen Menschen hat, spricht er ihn mit "Du" an und ruft ihn zu sich. Er entscheidet sich für den Menschen und erwartet die entsprechende Entscheidung vom Menschen. So ist das erste Gebot das Grundgebot, das alle anderen Weisungen des Dekalogs trägt.
Der Gott der Bibel ist ein "eifernder" Gott (Dtn 5,9), denn er liebt den Menschen. Seine Liebe wirbt darum, daß der Mensch sich ganz dem einen und einzigen Gott ausliefert. Gott geht dem Volk immer wieder nach, wenn es zu fremden Göttern abfällt und so in sein Verderben läuft. Alle von Menschen erdachten oder von Menschenhand gemachten Götter können keinerlei sinnvolle Bedeutung für den Menschen haben:
- "Unser Gott ist im Himmel;
- alles, was ihm gefällt, das vollbringt er.
- Die Götzen der Völker sind nur Silber und Gold,
- ein Machwerk von Menschenhand . . .
- Die sie gemacht haben, sollen ihrem Machwerk gleichen,
- alle, die den Götzen vertrauen.
- Israel, vertrau auf den Herrn!
- Er ist für euch Helfer und Schild"
- (Ps 115,3-9).
Die Heilige Schrift stellt vor Augen, daß Gott allein der Helfer und Befreier der Menschen ist. Die Götter sind "Nichtse". Von "Nichtsen" ist nichts zu erwarten; darum ruft das erste Gebot zur Entscheidung gegen die vermeintlichen Götter auf und fordert um des Menschen willen das Bekenntnis zum einzigen Gott des Himmels und der Erde. Nur die Entscheidung für ihn und die Treue zu ihm können den Menschen auf dem rechten Weg halten. Aus ihm sind wir hervorgegangen, zu ihm sollen wir wieder heimfinden; er ist Ursprung, Sinn und Ziel unseres Lebens. Wer von ihm abfällt, verliert die Sinnausrichtung seines Lebens. Seine Liebe fordert auf, sich vertrauensvoll an ihn zu binden.
Die Entscheidungssituation vor Gott verdichtet sich im Kommen Jesu Christi. In Jesus wird die Liebe Gottes anschaubar, die um uns wirbt und die uns fordert. Jesus ist "der Erste und der Letzte und der Lebendige" (Offb 1,17f). Er macht in seiner Verkündigung den gleichen Anspruch auf unbedingte Entscheidung geltend, wie er uns im ersten Gebot begegnet. In Anlehnung an das erste Gebot sagt Jesus: "Niemand kann zwei Herren dienen; er wird entweder den einen hassen und den andern lieben, oder er wird zu dem einen halten und den andern verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon" (Mt 6,24).
Jesus lädt uns ein, daß wir uns vorbehaltlos auf seinen Weg einlassen und alles, was auf diesem Weg hindernd entgegenstehen könnte, zurückweisen. Dazu kann in bestimmten Situationen sogar die Beziehung zu den Eltern und zur Familie gehören. "Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig, und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig" (Mt 10,37). Solche Forderungen wären unmenschlich, wenn uns in ihnen nicht eine Liebe begegnen würde, die den Menschen über alle irdischen Bindungen hinaus anruft und ihn neu zu den Menschen hinführt.
Für Jesus ist die Liebe zu Gott das erste und wichtigste Gebot; er ruft es im Einklang mit Israel in Erinnerung: "Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und mit all deiner Kraft" (Mk 12,29f; vgl. Dtn 6,4). Wer Jesus liebt, in dessen Person sich Gott aufs höchste in seiner Liebe erschlossen hat, liebt auch Gott. So erwächst aus der Liebe zu ihm ein personales Verhältnis zu Gott durch Jesus Christus im Heiligen Geist.
Jesus gibt dem Gebot des Alten Bundes eine neue Tiefe: "Das ist mein Gebot: Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe" (Joh 15,12).
2. Die Antwort des Glaubens als Ja zu Gott durch Jesus Christus im Heiligen Geist
2.1. Sich bestimmen lassen durch Gottes Ruf
Die Antwort des Christen auf den Ruf zum Glauben an den einzigen Gott ist das Ja zu Gott durch Jesus Christus im Heiligen Geist (vgl. KKK 150-152; KEK 1, 40-43). Dieses Ja ist aber immer wieder Situationen ausgesetzt, in denen sich andere Götter anbieten, ja aufdrängen.
Hier stellt das erste Gebot vor die Frage: Wodurch lasse ich mich tatsächlich bestimmen? Die wichtigste Voraussetzung für das Festhalten an Gott ist, daß wir uns für Gottes Wort offenhalten und auf Gottes Willen für unser Leben hören. Ein Beter im Alten Testament sagt: "Das Gehör hast du mir eingepflanzt; darum sage ich: Ja, ich komme . . . Deinen Willen zu tun, mein Gott, macht mir Freude" (Ps 40,7-9). Dieses Hören ist nicht leicht. Gott ist das Geheimnis in und über unserem Leben; nicht immer tritt in dem, was wir täglich erleben, deutlich zutage, was Gott uns sagen will, worin sein Wille besteht und was der Sinn all dessen ist, was wir erleben. Wenn wir uns offenhalten für ihn, dürfen wir darauf vertrauen, daß er uns führt.
Die wichtigste Quelle, aus der wir Gottes Willen erkennen und verstehen lernen und aus der wir Kraft für das Festhalten an Gott schöpfen, ist die Botschaft des Evangeliums, die uns die Kirche darbietet. Das Wort Gottes macht uns hellhörig für das Wahre und Gute und erschließt uns Gottes Willen für unser Leben. Wir hören es in der Liturgie der Kirche, wir lassen es in der Lesung der Heiligen Schrift auf uns wirken, und wir bedenken es in der persönlichen oder gemeinschaftlichen Betrachtung. So macht das Wort Gottes fähig, kritisch zu unterscheiden, alles zu prüfen und das Gute zu bewahren: "Prüfet alles, und behaltet das Gute" (1 Thess 5,21). Es macht unabhängig von dem Sog und der Inflation der Wörter, Vorstellungen und Idole, in denen sich falsche Götter anbieten. Die Ausrichtung unseres Lebens an Gottes Wort schränkt unser Leben nicht ein, sondern legt die vielen Möglichkeiten wahren Menschseins erst frei. Am Leben vieler Menschen, die Gottes Wort aufgenommen haben, läßt sich ablesen: Je mehr sie sich vom Ruf Gottes bestimmen lassen, um so mehr erfüllt sich ihr Leben. Sie finden zur Wahrheit Gottes, die befreit (vgl. Joh 8,32) und froh macht.
2.2. Entschiedenheit für Gott gegen Unglaube und Ideologie
Eine schwere Herausforderung des Glaubens ist die Begegnung mit dem Unglauben. In der Gesellschaft, am Arbeitsplatz und nicht selten in der eigenen Familie begegnen wir Menschen, denen es gleichgültig ist, ob es Gott gibt oder nicht. Manche lehnen den Gottesgedanken ausdrücklich ab; andere meinen, der Mensch könne über Gott gar nichts aussagen; und noch andere erklären, in den Wissenschaften sei nichts von Gott zu erkennen. "Manche sind, wie es scheint, mehr interessiert an der Bejahung des Menschen als an der Leugnung Gottes, rühmen aber den Menschen so, daß ihr Glaube an Gott keine Lebensmacht mehr bleibt. Andere machen sich ein solches Bild von Gott, daß jenes Gebilde, das sie ablehnen, keineswegs der Gott des Evangeliums ist. Andere nehmen die Frage nach Gott nicht einmal in Angriff, da sie keine Erfahrung der religiösen Unruhe zu machen scheinen und keinen Anlaß sehen, warum sie sich um Religion kümmern sollen" (GS 19). Viele verweisen auch auf das Übel in der Welt und halten es mit der Vorstellung von Gott für unvereinbar; und nicht wenige erklären, die Möglichkeiten der Weltgestaltung, die uns Wissenschaft und Technik geliefert haben, machten Gott überflüssig. Was zählt, sei allein der Mensch.
Für solche Erscheinungen tragen auch die Gläubigen selbst eine gewisse Verantwortung. Sie können an der Entstehung des Atheismus einen erheblichen Anteil haben. Das trifft vor allem zu, wenn sie "durch Vernachlässigung der Glaubenserziehung, durch mißverständliche Darstellung der Lehre oder auch durch die Mängel ihres religiösen, sittlichen und gesellschaftlichen Lebens das wahre Antlitz Gottes und der Religion eher verhüllen als offenbaren" (GS 19).
Gegenüber einem Denken, das den Menschen selbst als einzigen Gestalter seiner Geschichte versteht und die Befreiung des Menschen allein vom Menschen her erwartet, zeigt die Heilige Schrift, daß wir die wahre Befreiung und Erlösung von Gott geschenkt bekommen. Es ist sinnlos, sein zu wollen "wie Gott" (Gen 3,4) und sich an die Stelle Gottes zu setzen. Von Gott her empfangen wir unsere Größe, von ihm her erfahren wir aber auch unsere Begrenzung. Die Annahme der Grenzen ist für uns hilfreich und heilsam. Sie führt dazu, Gott in seinem Gottsein anzuerkennen, die von Gott eröffnete Freiheit vor ihm zu verantworten und sie nicht zum Aufstand gegen Gott zu mißbrauchen.
Vor allem erheben Ideologien den Anspruch, Sinn und Ziel des Menschen zu bestimmen. "Auch da, wo man die Verehrung eines Gottes ausdrücklich ablehnt, bleibt gewöhnlich sein Thron nicht leer: Idole und abergläubische Praktiken treten an seine Stelle; nicht selten machen sich hier Ersatzformen religiösen Verhaltens breit; an die Stelle des unvergleichlichen Gottes treten ideologische Ausschließlichkeitsansprüche, die von Intoleranz und Fanatismus geprägt sind" (Grundwerte und Gottes Gebot 16).
Der Begriff "Ideologie" ist seit Beginn des 19. Jahrhunderts in Gebrauch und hat viele Wandlungen erfahren. Im alltäglichen Sprachgebrauch ist "Ideologie" weithin gleichbedeutend mit "Weltanschauung", "Theorie" und "Wertsystem". Der negative Ton ist nicht zu überhören, der einerseits auf mangelnde Beweisfähigkeit von Behauptungen zielt, andererseits Unduldsamkeit, Fanatismus und mangelnde Selbstkritik unterstellt. In einer begrifflich stärker ausgeprägten Terminologie meint das Wort eine Wahrheitsüberzeugung, die im Dienst praktischer Interessen steht. Sie können mehr oder minder bewußt ("Betrug") oder auch dem einzelnen oder einer Gruppe selbst verborgen sein ("ideologisches Bewußtsein"). Ideologien wollen rückläufig die Macht- und Lebensansprüche gesellschaftlicher Gruppen rechtfertigen. Der Verdacht auf solche Strukturen hat sich seit Marx, Nietzsche und Freud ungemein erhöht. Jedes wirklichkeitsgerechte Denken ist Ideologie-Kritik, weil es wachsam ist gegenüber ungerechtfertigten Ansprüchen.
Viele Menschen sind der Meinung, daß das Christentum eine Weltanschauung bzw. Ideologie neben anderen sei. In einer Ideologie entwirft ein Mensch sich ein Bild (griechisch: eidolon) von der Wirklichkeit, unter das er die Wirklichkeit dann, wenn sie mit diesem Bild nicht (mehr) übereinstimmt, zwingt. Es ist geradezu ein charakteristisches Merkmal der Ideologien, daß sie die Wirklichkeit in ihren unterschiedlichen Dimensionen vollständig und umfassend aus einem Ansatz heraus erklären wollen, der im Grunde nur ein einziger Faktor der Wirklichkeit ist. Im Christentum ist dies anders. Hier entwirft nicht der Mensch sich ein Bild von Gott, sondern Gott ist es, der sich den Menschen offenbar macht. Wenn das erste Gebot die Menschen davor warnt, sich von Gott ein Bild zu machen (Dtn 5,8-10), dann will es damit auch den Offenbarungscharakter der Religion zum Ausdruck bringen. Gott ist unverfügbar und steht auch nicht den Gedanken, Ideen und guten oder schlechten Absichten der Menschen zur Verfügung. Verfügbar ist den Menschen nur die Welt, nicht aber Gott. Das Christentum leitet sich darüber hinaus von einer Person her, von Jesus Christus. Das Wort, das Jesus Christus mitteilt, ist Er selbst.
Was über Ideologien gesagt ist, gilt weithin auch von Sekten, die ihre Sicht von Gott und Christentum oder ihren an ihnen vorbeiführenden "Heilsweg" fanatisch und oft kämpferisch absolut setzen.
In den Herausforderungen, denen der Glaube durch den Unglauben der Umwelt und durch Ideologien ausgesetzt ist, zeigt sich, daß der Widerspruch, den der Glaube in der Welt erfährt, zum Schicksal der Glaubenden gehört. Das ist ihnen von Jesus selbst vorausgesagt: "Ein Jünger steht nicht über seinem Meister und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Der Jünger muß sich damit begnügen, daß es ihm geht wie seinem Meister" (Mt 10,24 par.). Das Wort des Herrn "In der Welt seid ihr in Bedrängnis" (Joh 16,33) hat sich bis hin zum Ertragen des Martyriums von Anfang an bis heute unzählige Male bestätigt. In allen Jahrhunderten sind Christen wegen ihres Glaubens vor die Gerichte der Mächtigen geschleppt worden; immer wieder werden ihnen in Ländern, die sich atheistischen Ideologien verschrieben haben, schwere Lasten und Prüfungen auferlegt; immer wieder werden sie als nicht mehr zeitgemäß, als Schuldige an unmenschlichen Zuständen und als Hindernis für menschliche Freiheit und Entfaltung angesehen und abgelehnt; immer wieder geraten sie in Konflikt mit den Herrschenden, wenn sie sich gegen Unrechts- und Gewaltsysteme wehren oder sich gegen deren Interessen für die Rechte der Unterdrückten, der Armen und der Notleidenden einsetzen.
Es gehört zur Taktik von anmaßenden Machthabern, durch Vorspiegelungen ihr Handeln zu rechtfertigen und durch utopische Verheißungen eine zukünftige Freiheit vorzutäuschen, die sie selbst nicht schaffen können.
Gegen solche Verfälschungen der Sinnziele des Menschen steht die freimachende Wahrheit des Evangeliums. Jesus ruft den Jüngern zu: "Habt Mut: Ich habe die Welt besiegt" (Joh 16,33). Wer an ihn glaubt und darauf vertraut, daß Gott den Menschen die Treue hält, ist nicht mehr durch Ideologien und weltliche Mächte manipulierbar.
Auch in der Kirche gibt es die Gefahr, sich durch Macht verführen zu lassen. Weltliche Mächte können sie in ihre Interessen einspannen. Es ist der Kirche nicht immer gelungen, sich von Abhängigkeiten an weltliche Macht freizuhalten und auf ungerechtfertigte und ungerechte Machtausübung (im Sinne von Machtanmaßung) nach außen und nach innen zu verzichten. Jeder einzelne trägt mit an der Verantwortung der Kirche, ungerechter Macht entgegenzutreten und so die Zukunft des Menschen für das Kommen des Reiches Gottes offenzuhalten. Gegenüber allen Versuchen, den Glauben an Gott durch innerweltliche Ziele zu ersetzen, muß sich der Christ bewußt sein: Wer dem Menschen den Glauben nimmt, befreit ihn nicht; er macht ihn nicht reicher, sondern ärmer. Wer den Menschen auf das Diesseits beschränkt, macht ihn zu einem "beschränkten" Menschen. Wer dem Menschen den Sinn des Lebens raubt, raubt ihm die Hoffnung. Wer dem Menschen die Hoffnung nimmt, führt ihn in die Verzweiflung.
3. Grundformen der Vergötzung und Wege geglückten Lebens
3.1. Vergötzung von Besitz
Der Mensch ist bestrebt, sein Leben zu erhalten und seine Zukunft zu sichern. Erwerb und Besitz materieller Güter helfen, den persönlichen Lebensraum zu gestalten, und geben das Gefühl, gesichert zu sein gegen Krankheit, Unfall, Verlust der Arbeitskraft und Vereinsamung im Alter.
Ein Großteil der Daseinsvorsorge richtet sich nicht nur auf das persönliche Leben, sondern auch auf die Familie, auf die Zukunft der Kinder und auf das Gemeinwohl des Volkes und der Völker. Solche Vorsorge vermittelt nicht nur das Gefühl, materiell gesichert zu sein, sondern es verschafft auch eine größere Unabhängigkeit, ein Freisein für andere Dinge wie Reisen, Förderung der Kunst und Kultur, Beschäftigung mit persönlichen Hobbies und Einsatz für andere Menschen. Oft stehen hinter solchem Tun auch hohe menschliche Tugenden wie Klugheit und Verantwortungsbewußtsein, Fleiß und Sparsamkeit, Einsatzbereitschaft und Sinn für die Güter der Schöpfung.
Alles das ist gut und richtig, solange es aus der Haltung stammt, zu haben, als hätte man nicht, und zu besitzen, als besäße man nicht (vgl. 1 Kor 7,29-31). Fehlt diese Ausrichtung, beginnt sich der Blick auf die Daseinsvorsorge einzuengen; dann können Besitz und Reichtum dazu verleiten, immer mehr haben zu wollen und das Haben über das Sein zu stellen. Der "unselige Hunger nach Geld" kann dazu treiben, daß Reichtum zum Mammon, zum alles beherrschenden Götzen wird.
Das Zweite Vatikanische Konzil sagt: "Alle sollen deshalb ihre Willensantriebe richtig leiten, um nicht im Umgang mit Dingen der Welt und durch die Anhänglichkeit an die Reichtümer wider den Geist der evangelischen Armut im Streben nach vollkommener Liebe gehindert zu werden" (LG 42). Unübersehbar wird hier der Blick auf die Gefahren gelenkt, die mit der Sorge und Vorsorge für unser Leben verbunden sind. "Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt" (Mk 8,36). Viele hören das Wort vom Reich Gottes, das in sie eingepflanzt ist, "aber dann ersticken es die Sorgen dieser Welt und der trügerische Reichtum, und es bringt keine Frucht" (Mt 13,22). Jesus warnt vor dem Reichtum, in welchem der Mensch den Mammon zum Götzen macht: "Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel" (Mt 6,19f). "Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz" (Mt 6,21). "Niemand kann zwei Herren dienen . . . Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon" (Mt 6,24). "Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als daß ein Reicher in das Reich Gottes gelangt" (Mk 10,25). Wer nur darauf aus ist, seinen materiellen Besitz zu vermehren, verfehlt das wahre Leben (vgl. Lk 12,16-21). Niemand darf blind sein für die Not der Menschen vor seiner Tür (vgl. Lk 16,19-31) und der vielen in aller Welt, die unter dem Existenzminimum leben. Die Besitzenden und Reichen, die an der Not in der Welt vorbeisehen, werden im Gericht des Menschensohnes nicht bestehen (vgl. Mt 25,31-46).
Jesus nachfolgen kann unter Umständen bedeuten, daß einer seinen ganzen Besitz aufgibt (vgl. Mk 1,16-20; Lk 14,33). Wie schwer das für jemand werden kann, schildert die Erzählung von dem Mann, dem Jesus das Angebot macht: "Geh, verkaufe, was du hast, gib das Geld den Armen, und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben; dann komm und folge mir nach! Der Mann aber war betrübt, als er das hörte, und ging traurig hinweg; denn er hatte ein großes Vermögen" (Mk 10,21ff).
Für den, der sich in Jesus Christus geborgen weiß, können Reichtum und Besitz nicht mehr zu Götzen des Lebens werden. Er braucht nicht auf irdischen Besitz zu bauen. Auch die ängstliche Sorge um das tägliche Leben wird überflüssig; er weiß, daß Gott selbst dem Leben eine letzte Sicherheit gibt (vgl. Mt 6,25-33). Jesu Wort und Beispiel laden ein, gelassen und mit Vertrauen den Ereignissen des Lebens zu begegnen. Wir sollen uns in der Einstellung zu Besitz und Vermögen von der Haltung leiten lassen, die uns daran erinnert: Wir sind vor Gott alle arm; die Güter der Welt sind vergänglich; wir sollen sie im Geist der Armut so gebrauchen, daß unser natürliches Streben nach Besitz nicht der Habsucht, dem Geiz und der Hartherzigkeit gegen Arme und Notleidende verfällt. So ist das erste Gebot eine kritische Anfrage an unser Verhalten im Umgang mit den Gütern der Welt.
3.2. Vergötzung von Macht
Der Mensch verlangt nach persönlicher Geltung und Anerkennung. Er will in der Gemeinschaft der Menschen anerkannt sein und entsprechend seinen Fähigkeiten und Leistungen etwas gelten, Einfluß haben und Macht ausüben. Wenn dieses Streben in rechter Weise in den Dienst der menschlichen Person und der menschlichen Gemeinschaft gestellt wird, ist es ein positiver menschlicher Wert. schenkt
Geltung, Ansehen und Macht werden aber zur Bedrohung, wenn das Geltungs- und Machtstreben entartet. Der eine wird aus Geltungssucht zum Streber. Er denkt nur an seine Karriere und schiebt rücksichtslos alles beiseite, was ihm im Wege steht. Er ist sogar bereit, Glauben und Religion aufzugeben, wenn er dadurch sein Ziel erreichen kann. Ein anderer stellt sich in überheblichem Stolz über alle anderen; er nützt seine Position aus und wird zum Tyrannen. Ein dritter schließlich verliert in falschem Vertrauen zu sich selbst das Vertrauen zu allem, auch zu Gott. Er meint, man könne sich auf niemand verlassen. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott! schenkt
In solchen Vergötzungen der Macht und der Geltung des eigenen Ich spiegeln sich Einstellungen wider, die in tiefem Widerspruch zur Weisung Jesu an seine Jünger stehen: "Ihr wißt, daß die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen mißbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein, und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein" (Mk 10,42-44). Aus ihrer dienenden Bereitschaft antwortet Maria auf den Anruf Gottes: "Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du gesagt hast" (Lk 1,38). Freiwillig erklärt sie sich bereit, in Liebe zu dienen. schenkt
Den äußersten Weg dienenden Gehorsams ist Jesus selbst gegangen: "Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen; er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz" (Phil 2,6ff). In seiner Nachfolge geben Menschen sich ganz an Gott hin. Gott soll der einzige Herr des Lebens sein. Dadurch wird auch ein neues Miteinander unter Menschen möglich.
3.3. Vergötzung von Genuß und Lust
Der Mensch verlangt nach Genuß und Lust. Dieses Streben umfaßt viele Beweggründe. So sprechen wir von der Lust der Sinne (Sehen, Riechen, Schmecken, Hören, Tasten) und von geistigem Genuß. Es gibt die Tendenz, das Genießen der Lust sogar zum Prinzip des sittlichen Handelns und Verhaltens zu erheben. Nach dieser Auffassung findet der Mensch sein Glück in der Erfüllung seiner Triebbedürfnisse, im Genuß der Lust.
Viele sehen in der Erfüllung der Geschlechtlichkeit und im sexuellen Genuß ein wichtiges Zielbild ihres Lebens. Tatsächlich gehört das Verlangen nach geschlechtlicher Erfüllung zur Dynamik des menschlichen Lebens. Es ist als von Gott geschenkte Antriebskraft für das menschliche Leben von großer Bedeutung. Es ist in Verbindung mit den geistigen Kräften des Menschen gleichsam ein Motor des Handelns. Der Mensch darf es weder unterdrücken, noch darf er es dem Selbstlauf überlassen; es ist in seine Verantwortung gelegt. Wenn es als wirklich menschliches Erleben erfahren wird, kann es den Menschen in tiefer Weise beglücken, es kann ihn aber auch als bedrängende Macht so beherrschen, daß er seine Freiheit verliert, der sexuellen Trieberfüllung verfällt und das Sexuelle zum Abgott seines Lebens macht.
Die Geschichte der Menschheit zeigt, daß bei manchen Naturvölkern die Sexualität eine so große Bedeutung hat, daß man sexuelle Symbole als Götterstatuen, als Abwehr gegen Zauber und Magie und als Fruchtbarkeits- oder Männlichkeitssymbole errichtet hat, um die Macht des Sexuellen zu beschwören oder die Sexualität als Abgott zu verehren. Israel hatte gegen diese Kulte einen schweren Kampf zu bestehen. Heute beherrscht die Vergötzung der Sexualität oft die Plakatwände und die Titelseiten einer darauf eingestellten Presse, die Medienprogramme und die Filmwerbung. Auf sie hat sich auch eine ganze Werbe- und Unterhaltungsindustrie eingerichtet, in der es allein um sexuelle Aufreizung und sexuellen Konsum geht.
Die Kirche hat in ihrer sittlichen Verkündigung zu allen Zeiten die Vergötzung der Sexualität verworfen. Jede Art kultischer Verehrung Gottes durch sexuelle Handlungen ist ihr fremd. Die Vergötzung der Sexualität ist eine innere Versklavung an den Trieb, der Menschen so beherrschen kann, daß sie nicht mehr daran denken, die Sexualität sinnvoll zu kultivieren. Solche Versklavung zerstört nicht nur die Liebe zwischen Menschen, sondern auch die Liebe zu Gott.
3.4. Wege geglückten Lebens: Die "evangelischen Räte"
Die christliche Tradition zählt die Vergötzung des Begehrens zu den Lastern, denen der Mensch beim Streben nach Besitz, Macht und Genuß leicht verfällt: "die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und das Prahlen mit dem Besitz" (1 Joh 2,16). Angesichts dieser Gefährdung ist der Mensch verpflichtet, seine Einstellung zu Macht, Besitz und Genuß so zu gestalten, daß die Strebungen in rechter Weise in die Gesamtorientierung des Lebens eingefügt sind. Dabei können auch Askese und Verzicht eine große Bedeutung für die Lebensform des Menschen haben. Das ergibt sich aus der Verantwortung eines jeden für die sittlich richtige Gestaltung seiner Grundstrebungen. Eine besondere Weise des Verhaltens zu Besitz, Geschlechtlichkeit und Macht ist die freigewählte Lebensform von Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam, die sich in der Kirche unter dem Begriff "evangelische Räte" herausgebildet hat (vgl. auch KEK 1, 285).
Die Formel "drei evangelische Räte" stammt aus dem 12. Jahrhundert, die Lebensform selbst ist in der Kirche von Anfang an als Ideal der Nachfolge Christi in der Nachahmung der Jünger Jesu mit ihrem Herrn bekannt. In der Zeit der Kirchenväter und in der mittelalterlichen Theologie unterschied man im Anschluß an die Perikope vom reichen Jüngling (Mt 19,17.21) einen zweifachen Weg des christlichen Lebens: den Weg der Gebote und den Weg der Räte. Letzterer galt als der Weg der Vollkommenheit (vgl. dazu besonders die Erläuterungen in KKK 915-933; 1973f).
Das Zweite Vatikanische Konzil (LG 39-42; vgl. PC 12-14) stellt heraus, daß es grundsätzlich eine allgemeine Berufung zur Heiligkeit und zur Gemeinschaft mit Jesus Christus gibt. Alle Christen sind zu vollkommener Liebe berufen, die man auf beiden Wegen erreichen kann. Die evangelischen Räte sind eine besondere Weise des christlichen Lebens und haben einen wichtigen zeichenhaften Sinn. Sie sind ein Weg der besonderen Berufung. Für jene, die diesen Ruf erfahren, ist er der "bessere" Weg im Sinne der für sie richtigen Lebensform, in der sie die Bereitschaft der Kirche zur Hingabe auf Christus hin leben. Insofern ist der Ruf verbindlich.
Die konkrete Form der evangelischen Räte ist wesentlich durch das Leben in kirchlichen Gemeinschaften geprägt. In der Gemeinschaft kann Armut ihren vollen Sinn bekommen als Offenheit für andere und Zeugnis der Hoffnung, ohne daß man sich selbst durch entsprechenden Besitz absichern oder sich im Bedarfsfall einfach der Sozialfürsorge überlassen muß. Die Gemeinschaft ist weiter der beste Rückhalt für die freigewählte Ehelosigkeit, die zu einer Offenheit für den apostolischen Auftrag verhelfen soll, ohne den einzelnen in Isolation zu führen. Die Gemeinschaft läßt schließlich auch den Gehorsam eine christliche Vollgestalt finden.
Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam sind eschatologische Zeichen, das heißt Ausdruck einer Hoffnung, die nach der Vollendung des Gottesreiches ausgreift. Dabei zeigen freilich die konkreten Formen kirchlicher Gemeinschaften "eine wunderbare Vielfalt" (PC 1), die durch die Tradition, durch die apostolische, caritative oder ähnliche Zielsetzungen und Faktoren bestimmt ist.
4. Die Begegnung mit Gott in Gottesbildern und Gottesvorstellungen
Das erste Gebot verbindet mit dem Anspruch: "Du sollst keine anderen Götter neben mir haben" die Forderung: "Du sollst dir kein Gottesbild machen, das irgend etwas darstellt am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde" (Dtn 5,8; Ex 20,4).
4.1. Bilder von Gott und der Heilsgeschichte in Kult und Kunst
Das Volk Israel hat der Forderung des ersten Gebotes, sich kein Gottesbild zu machen, große Bedeutung beigemessen. Es waren nicht nur Götterbilder verboten, sondern auch Bilder von Jahwe als dem alleinigen Bundesgott.
Hierin folgte Israel seiner alten Tradition, denn schon zur Zeit des Mose kannte man im Unterschied zu den Umweltreligionen, in denen Götterstatuen kultisch verehrt wurden, keinerlei Gottesstatue. In den Texten der Bibel ist immer nur von der "Bundeslade", einem von Mose angefertigten Schrein, die Rede, die offenkundig die Anwesenheit des mit dem Volk mitziehenden Bundesgottes versinnbildlichen sollte. Freilich gab es auch in Israel die Versuchung, Jahwe in einem Bild zu vergegenwärtigen (vgl. Ri 17-18). In den alten Heiligtümern außerhalb Jerusalems hat man, wie archäologische Funde bestätigen, kleinere Stelen (Mazzeben) aufgestellt, die die Gegenwart Gottes kennzeichnen sollten. Doch hat sich in Israel klar die Auffassung durchgesetzt, daß das Bilderverbot eindeutig jede Abbildung von Jahwe verbiete. Dahinter stand nicht der Gedanke, daß man die Geistigkeit Gottes nicht in ein materielles Bild einfangen kann, sondern vielmehr die Absicht, Gottes Überweltlichkeit und Freiheit vor jedem unangemessenen Zugriff des Menschen zu sichern und den unendlichen Unterschied zwischen Gott und Mensch zu wahren.
Das Christentum ist Israel im Verbot bildlicher Darstellungen von Gott nicht gefolgt, doch bestanden wegen der kultischen Verehrung von Kaiserbildern und wegen der Verfolgung der Christen, die eine solche Verehrung ablehnten, starke Vorbehalte gegen kultische Bilder.
In frühchristlicher Zeit tauchen ab Mitte des 3. Jahrhunderts religiöse Bilder auf, zunächst Darstellungen aus dem Alten und Neuen Testament, dann auch Christus- und Heiligenbilder. Im byzantinischen und karolingischen Bilderstreit kam es zu schweren Auseinandersetzungen über die Erlaubtheit der Bilder und vor allem ihrer Verehrung. Das Zweite Konzil von Nizäa (787) entschied für die Bilderverehrung. Der eigentlich theologische Hintergrund dieser Entscheidung ist darin zu sehen, daß mit dem Kommen Jesu Christi Gott selbst Mensch geworden ist. Gott lebt in Jesus Christus sein Gottsein auch auf menschliche Weise. Damit hat Gott ein "konkretes" Gesicht, das Gesicht Jesu von Nazaret. Das menschliche Antlitz Jesu ist das Antlitz Gottes, es ist "Ikone des Vaters". Dieses Verständnis machte die Darstellung Jesu Christi im Bild möglich. In der Reformation kam es nach der bereits seit dem Mittelalter andauernden Kritik am Mißbrauch von Bildern zu schweren Bilderstürmen, gegen die sich Martin Luther schon früh wendet: Das Bild ist zwar nicht heilsnotwendig, aber nützlich. Die reformierten Kirchen lehnen zwar in Anschluß an Zwingli und Calvin einen Gebrauch von Bildern ab, was heute noch an der nüchternen Leere der Kirchen dieses Bekenntnisses erkennbar ist. Das Konzil von Trient hat in dem "Dekret über die Anrufung und Verehrung der Heiligen, über die Reliquien der Heiligen und die heiligen Bilder" vom Jahre 1563 (DS 1823, 1825) in genauen Unterscheidungen entgegen möglichem Mißbrauch an der Verehrungswürdigkeit der religiösen Bilder festgehalten. Es hat auf die Nützlichkeit solcher Verehrung hingewiesen, da sie die Gläubigen an die Geheimnisse der Erlösung erinnert und ihnen Vorbilder christlichen Lebens vor Augen stellt (vgl. NR 11, 476).
Immer wieder hat die christliche Kunst versucht, die biblische Botschaft und das Leben der Heiligen in Bildern und Statuen darzustellen. Dabei spielen das jeweilige Gottesverständnis und die Stilrichtung der Kunst eine wichtige Rolle.
Neben hervorragenden künstlerischen Darstellungen gibt es viele Bilder, in denen die Inhalte des Evangeliums und die Gestalten der Heiligen nur unzulänglich zum Ausdruck kommen. - Die kritische Anfrage, die in diesem Zusammenhang an uns zu stellen ist, lautet: Mit welchen Bildern und Statuen umgeben wir uns in unseren Kirchen und Wohnungen? Welche Bedeutung haben sie für unsere Gottesverehrung? - Für manchen, der keinerlei Beziehung zum Glauben hat, sind künstlerisch wertvolle Bilder, Statuen und Heiligenfiguren kaum mehr als ein repräsentativer Schmuck, der sein ästhetisches Empfinden anspricht, seinen Sinn für Kunst ausdrückt oder seinen Reichtum zur Schau stellt. Für den Glaubenden ist nicht der hohe künstlerische oder der Geldwert einer religiösen Darstellung ausschlaggebend; für ihn ist wichtig, daß die Darstellung Wahres aussagen will, daß uns durch sie Gott begegnet und sie uns hilft, unser Bewußtsein für die Gegenwärtigkeit Gottes in unserem Leben wachzuhalten. Von diesem Sinn her ist es angemessen, daß gläubige Menschen in ihren Wohnungen religiöse Bilder und Statuen haben, die Zeichen und Ausdruck ihres Glaubens und ihrer Gottesverehrung sind. Sie ersetzen nicht den Glauben, aber sie lassen auf ihre Weise deutlich werden, daß es viele Weisen der Verehrung Gottes gibt.
4.2. Vorstellungen von Gott in Theologie und Frömmigkeit
Das biblische Bilderverbot ist eine beständige Mahnung, uns keine fixierten Gottesvorstellungen zu machen. Alle unsere theologischen Aussagen über Gott sind nur Aspekte des unbegreiflichen und unsagbaren Gottes. Ist ein der Größe und Erhabenheit Gottes entsprechendes Denken und Vorstellen von Gott überhaupt möglich? Sollten wir nicht besser vor dem unendlichen Geheimnis Gottes ganz schweigen? Besteht nicht die Gefahr, daß wir falsche Vorstellungen und Bilder von ihm haben? Eines der ältesten Gebete in deutscher Sprache, das "Wessobrunner Gebet", lautet:
- "Das erfragte ich unter den Menschen
- als gewaltigstes Wunder:
- Als Erde nicht war noch hoher Himmel,
- noch Baum noch Berg nicht war,
- noch Sonne nicht schien noch Stern,
- noch Mond nicht leuchtete
- noch das mächtige Meer,
- als nirgends nichts war aller Enden und Wenden:
- da war der eine allmächtige Gott,
- der Herren mildester;
- bei ihm viele Geister voll Herrlichkeit.
- Doch eher als sie war der heilige Gott.
- Allmächtiger Gott,
- der du Himmel und Erde geschaffen
- und den Menschen viel Gutes gegeben hast,
- verleihe mir in deiner Huld den rechten Glauben,
- gewähre mir Weisheit und Klugheit und Kraft,
- dem Verderber zu widerstehen,
- das Böse zu meiden
- und deinen Willen zu vollbringen. Amen."
- (Stundenbuch, Bd. III, S. 158f)
Eindringlich stellt uns das Gebet die Größe Gottes dadurch vor Augen, daß es die gesamte Wirklichkeit der Welt abschreitet und hinter allem Gott als den ganz Anderen und Unfaßbaren bekennt, der alles in souveräner Unabhängigkeit geschaffen hat.
In dieser Weise von Gott zu sprechen und ihn als den unendlich erhabenen, unvergleichlichen Gott zu bekennen, das scheint dem ersten Gebot besonders zu entsprechen.
In der sogenannten "negativen" Theologie steht das unbegreifliche Geheimnis Gottes im Mittelpunkt. Gott kann zwar auf analoge Weise erkannt werden, aber er bleibt der Unbegreifliche. Dahinter steht die Sorge um die unbeeinträchtigte Aufrechterhaltung der Aussage von der Andersartigkeit Gottes. Eine Grundaussage der negativen Theologie lautet: Wir wissen von Gott eher, was er nicht ist, als was er ist (Thomas von Aquin), oder: Gott wird besser durch Nichtwissen gekannt (Augustinus). Negative Theologie bleibt aber in ihren besten Vertretern (zum Beispiel Pseudo-Dionysius, Thomas von Aquin) nicht beim Weg der Verneinung stehen, sondern führt zum Geheimnis Gottes. - Die Weise, von Gott eher zu sagen, was er nicht ist, als was er ist, hat eine unverzichtbare Bedeutung (Lat. IV; DS 806). Unsere Begriffe sind geprägt von der Vorstellung der Endlichkeit und Unvollkommenheit und können deshalb ohne einen reinigenden Prozeß nicht auf Gott übertragen werden. Zudem wahrt die negative Theologie die bleibende Distanz des Menschen zu Gott. Sie läßt den Menschen nicht vergessen, daß Gott der ganz Andere ist, auch wenn er uns näher ist als wir uns selbst (Augustinus).
In der Geschichte der Theologie und der Frömmigkeit hat diese Denkweise große Bedeutung. Doch muß auch festgehalten werden, daß wir menschliche Bilder und Worte brauchen, um von Gott reden zu können. Wir müssen uns aber bewußt bleiben, daß Gott immer größer ist als alles, was wir von ihm denken, sagen und in Vorstellungsbildern ausdrücken können.
Es gibt eine Vielzahl von Gottesvorstellungen in der Volksfrömmigkeit. Manche davon sind wertvoll, andere können einer kritischen Prüfung nicht standhalten, weil sie das Gottesverhältnis verfälschen. Darüber hinaus können sie, wenn wir sie an andere weitergeben, ihrem Glauben schaden und ihnen zum Anstoß werden, so daß sie sich ärgern oder den Glauben zu verachten beginnen.
Gott als der nur "liebe Gott". Das Bild vom "lieben Gott" kann zu einem falschen Bild werden, wenn der liebe Gott als ein bequemer Gott verstanden wird, der keine Ansprüche stellt und alles, was der Mensch tut, mit dem Mantel der Nachsicht zudeckt. In dieser Vorstellung wird Gott verharmlost. Für viele ist jedoch die Vorstellung vom lieben Gott die schönste und innigste Weise der Gottesvorstellung. Ihnen ist der liebe Gott der liebende Gott, der sich den Menschen in väterlicher Liebe zuneigt und sie in seiner Liebe trägt. Dieser liebende Gott versteht die Menschen, er erbarmt sich ihrer Schwäche und verzeiht ihnen ihre Schuld.
Gott als der überfordernde Gott. Nach dieser Gottesvorstellung legt Gott den Menschen schwere Lasten auf und drückt sie mit seinen Geboten und Verboten nieder. Menschen, die Gott nur als fordernden Gott sehen, sind nicht selten selbst unbarmherzig oder gar fanatisch. Sie verkennen, daß der Gott der Gebote der befreiende Gott ist, der mit den Menschen geht und niemals etwas fordert, ohne es zuvor zu ermöglichen.
Gott als Aufpasser. Viele sehen in Gott einen Aufpasser, der darüber wacht, daß man alle Gebote und Vorschriften peinlich genau erfüllt. Gottes Hinschauen auf den Menschen ist nicht Kontrolle, sondern Schutz und Hilfe, Mitgehen und Mitleben, Erbarmen und Mitleiden mit den Menschen.
Gott als Lückenbüßer. Mancher erinnert sich erst an Gott, wenn er im Leben nicht mehr zurechtkommt. Gott soll der letzte Nothelfer sein, der zur Verfügung stehen muß, wenn man ihn um etwas bittet; mit ihm kann man verhandeln und feilschen; ihm gibt man alle möglichen Versprechungen, damit er das tut, was man von ihm haben möchte; man ist von ihm enttäuscht, wenn er die Wünsche nicht erfüllt.
Gott als Garant des irdischen Lebens. Viele fordern von Gott, daß alles im Leben glatt gehen soll, daß man überall durchkommt, daß alles kalkulierbar bleibt, daß nicht Leid, Krankheit oder Unglück hereinbricht und daß im Leben immer nur die Sonne scheint. Er soll der Gott des Erfolges sein.
Diese Beispiele lassen deutlich werden, in welcher Weise uns das erste Gebot auffordert, unsere Gottesvorstellungen selbstkritisch zu überprüfen.
4.3. Gottesbild, Gottes Ebenbild, Gottes Bild in Jesus Christus
Wir können den unendlich großen Gott niemals ergründen; er bleibt das Geheimnis, das nicht in Bilder, Worte und Vorstellungen eingefangen werden kann.
Die Heilige Schrift spricht in vielfacher Weise von Gott. Sie erzählt vom Weg Gottes mit den Menschen; sie spricht von Gott in außerordentlich farbigen und einander ergänzenden Bildern. Gott in ein festes Bild einzufangen wäre dem alttestamentlichen Gottesvolk als Frevel erschienen. Gott kann man nicht in Bildern, die von menschlichen Händen geschaffen sind, festmachen. Um so mehr spricht die Heilige Schrift in Worten und Vorstellungen von Gott, von dem Gott der Geschichte, der mit dem Volk den Weg seiner Befreiung, seiner Entbehrungen, seiner Verfehlungen und seiner Bekehrungen gegangen ist. Dieser Gott ist der lebendige Gott, der den Menschen mit "Du" anspricht. Nicht der Mensch macht Gott begreiflich, sondern Gott gibt durch sein Sprechen, seine Offenbarung und sein Handeln zu erkennen, wer er wirklich ist. Weil Gott mit dieser Anrede auf den Menschen zugeht und damit die Möglichkeit eines personalen Gegenübers eröffnet, erhält der Mensch die Möglichkeit und die Erlaubnis, den allmächtigen Gott mit "Du" anzureden.
Der sich offenbarende Gott begegnet uns personhaft. Wie anders könnte der Mensch von ihm sprechen, als er es auch sonst im Dialog mit Personen tut? Deshalb kann die Heilige Schrift in so unterschiedlichen Bildern, die Gleichnis- und Hinweischarakter haben, von Gott sprechen: Gott ist der eifernd Liebende, er geht den Menschen nach, er zürnt, ist traurig, rächt, zerstört, vernichtet, richtet wieder auf; Gott ist Vater, und er ist der mütterlich sich Erbarmende (Jes 49,15); er ist König und Hirt, er ist Weisheit und Wort; er läßt sein Antlitz über uns leuchten, "er hat uns in seine Hand geschrieben" (vgl. Jes 49,16). Alle diese Wortbilder, in denen wir von Gott sprechen, sind möglich, weil wir Gottes Ebenbild sind. Als Personen können wir in menschlichen Worten vom persönlichen Gott sprechen, und wir können zugleich von Gottes Bild im Menschen sprechen.
Am vollkommensten leuchtet das Bild Gottes in seinem menschgewordenen Sohn Jesus Christus auf. Er ist das "Ebenbild des unsichtbaren Gottes" (Kol 1,15). Er kann von sich sagen: "Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen" (Joh 14,9). Nicht der Mensch macht sich ein Bild von Gott, sondern Gott kommt dem Menschen entgegen im Bild seines Sohnes. Jesus Christus vermittelt uns nicht nur das Bild seines Vaters, sondern er ist auch der Zugang zu ihm. "Niemand kommt zum Vater außer durch mich" (Joh 14,6). In Jesus Christus ist anschaubar geworden, wer Gott für uns sein will. Indem wir Christi Brüder, Schwestern und Freunde werden, sind wir Kinder des Vaters. Das hebt keineswegs jene Distanz auf, von der das Bilderverbot spricht. Gott läßt uns teilhaben an seinem Geheimnis, aber er bleibt Geheimnis.
Die Fülle der Worte und Bilder, die unsere Teilhabe am Geheimnis Gottes in Jesus Christus ausdrücken, ermöglicht es, daß jeder einzelne sich auf seine persönliche Weise von den Bildern und Vorstellungen bestimmen läßt, die ihm am ehesten entsprechen. Es muß uns darum gehen, ein persönliches Verhältnis zu Gott zu gewinnen. Gott liebt jeden Menschen in der Einmaligkeit und Besonderheit seiner Person. Von Gott in dieser Weise geliebt, sollen wir selbst Liebende werden. "Wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm" (1 Joh 4,16).
Das Leben in der Gemeinschaft mit Christus beginnt mit der Taufe; hier treten wir ein in den endgültigen Bund mit Gott, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Die Taufe geschieht im Namen des dreieinigen Gottes. Jesus nimmt als der Sohn uns in seine liebende Beziehung zum Vater mit hinein und erfüllt uns mit seinem Geist, in dem wir mit ihm "Abba, lieber Vater!" sagen dürfen. Der Täufling legt das Taufversprechen ab; in ihm bindet er sich an Gott, der ihn in Jesus Christus zum Heil ruft und ihm seine Gnade schenkt. "Die Gnade ist eine Teilhabe am Leben Gottes; sie führt uns in das Innerste des dreifaltigen Lebens: Durch die Taufe hat der Christ Anteil an der Gnade Christi, der das Haupt seines Leibes ist. Als ein ,Adoptivsohn` darf er nun in Vereinigung mit dem eingeborenen Sohn Gott ,Vater` nennen. Er empfängt das Leben des Geistes, der ihm die Liebe einhaucht und der die Kirche aufbaut" (KKK 1997). Das ist es, was das erste Gebot am Anfang der Gebotsreihe fordert: eine Entscheidung für den Gott der Liebe, der uns in Jesus Christus endgültig zu sich gerufen hat. Diese Entscheidung gilt es immer wieder einzuüben.
II. Zweites Gebot: Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren
Ich bin dein Gott, der dir Leben und Zukunft schenkt
Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren
Gott will, daß wir seinen Namen anrufen und ihn nicht mißbrauchen.
1. Offenbarung des Namens Gottes und Gottesverehrung
1.1. Der Wortlaut des Gebotes
Das zweite Gebot hat im Buch Exodus und im Buch Deuteronomium den gleichen Wortlaut:
"Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht mißbrauchen, denn der Herr läßt den nicht ungestraft, der seinen Namen mißbraucht" (Ex 20,7; Dtn 5,11).
1.2. Sinn und Bedeutung des Gebotes
Die Offenbarung des Namens Gottes ergeht im Alten Testament an Mose. Im brennenden Dornbusch gibt sich Gott als der Gott der Väter zu erkennen. Mose soll sein Volk aus Ägypten herausführen. Mose fragt ihn nach seinem Namen, damit er dem Volk sagen kann, wie dieser Gott heißt, der zu ihm gesprochen hat.
Der eigentliche Hintergrund für die große Bedeutung der Offenbarung des Namens Gottes ist das Verständnis, das man im Umfeld Israels der Kenntnis des Namens beimaß. Anders als in unserem Kulturraum, wo Namen mehr nach besonderer Vorliebe verliehen werden, galt im vorderasiatischen und ägyptischen Raum, daß der Name eines Menschen in engem Zusammenhang mit seinem Wesen gesehen wurde. Wer den Namen eines anderen kannte, konnte gewissermaßen Einblick in sein Wesen nehmen und so Macht über ihn gewinnen. Das galt auch in der Beziehung zu den Göttern. Die Kenntnis ihres Namens bot die Möglichkeit, mit magischen Formeln über sie zu verfügen und sie den Menschen dienstbar zu machen. Deshalb suchten manche Götter (zum Beispiel der Gott Amon in Ägypten) ihren wirklichen Namen zu verbergen, um sich der Verfügung durch Menschen zu entziehen.
Gott offenbart dem Mose seinen Namen. Darin sagt er Wesentliches über sich selbst. Die entscheidende Stelle des Alten Testamentes, an der dies berichtet wird, lautet:
- "Da sagte Mose zu Gott: Gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen: Wie heißt er? Da antwortete Gott dem Mose: Ich bin der ,Ich-bin-da`. Und er fuhr fort: So sollst du den Israeliten sagen: Der ,Ich-bin-da` hat mich zu euch gesandt" (Ex 3,13f).
Der geheimnisvolle Gottesname JAHWE bedeutet gleichzeitig "Ich-bin-da" und "Ich werde da sein".
In diesem Namen offenbart sich Gott als ein Gott, der sich den Menschen entschieden zuwendet, er erscheint dem Mose als der rettende Gott. Er ruft das Volk auf, an ihn zu glauben und sich seiner Führung anzuvertrauen. Wer mit diesem Gott reden will, braucht nicht einen magisch wirkenden Namen wie die Nachbarvölker Israels. Gott ist für das Volk der vielfältig nahe Gott, der trotz dieser Nähe freilich auch als der eigenartig ferne Gott erfahren werden kann. Der mit dem Volk mitgehende Gott ist anders als die Götter der Völker. Über ihn kann man nicht verfügen, noch kann man ihn in das Kalkül menschlicher Pläne einbeziehen. Er ist seinem Volk voraus und geht ihm voraus auf eine Zukunft hin, die er für es bereitet hat. Er ist der freie und zugleich befreiende Gott, er ist der heilige Gott, ihm gebühren Ehre und Verehrung.
Der Umgang mit dem Namen Gottes hat in Israel eine wechselvolle Geschichte gehabt. Aus Sorge darum, daß man den Namen Gottes mißbrauchen könnte, hat man sogar gemeint, man solle den Namen JAHWE überhaupt nicht aussprechen. So hat man sich im dritten Jahrhundert vor Christus dazu entschlossen, diesen Namen durch ADONAI, HERR, zu ersetzen. Diese Entwicklung ging soweit, daß man allmählich auch das Wort GOTT durch HIMMEL ausdrückte und auch nicht mehr vom REICH GOTTES, sondern vom REICH DER HIMMEL sprach.
Nach christlichem Glauben offenbart sich Gott endgültig in seinem Sohn Jesus Christus: In der Ankündigung der Geburt Jesu Christi sagt der Engel zu Maria: "Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären; dem sollst du den Namen Jesus geben" (Lk 1,31). Im Menschgewordenen nimmt Gott den Namen eines Menschen an. Von nun an ist der Name Gottes für Christen unlösbar mit dem Namen Jesus verschmolzen, der bedeutet: "Gott ist Hilfe, Heil" (Je = Jahwe, schua = Heil). In ihm erfahren wir Gottes endgültige Zusage zu uns; in ihm sind wir erlöst und befreit. Jesus Christus ist der Christus, der Messias ("der Gesalbte"); er hilft; er ist getreu; er tritt mit uns vor Gott hin; mit ihm können wir im Heiligen Geist zu Gott "Abba, lieber Vater" (Röm 8,15; Gal 4,6) sagen. Er geht mit uns durch alle Zeit: "Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit" (Hebr 13,8).
In Jesus Christus ruft Gott den Menschen in seine Nähe und bindet ihn zurück an seinen Schöpfer und Erlöser. Indem Menschen sich in dieses Verhältnis zu Gott einbinden lassen, erkennen sie ihre eigene Endlichkeit und Geschöpflichkeit an und vertrauen darauf, daß Gott in Jesus Christus mit ihnen geht und sie in der Gemeinschaft des neuen Gottesvolkes trägt. Die Antwort des Glaubens auf die Offenbarung Gottes in seinem Namen und im Namen Jesu Christi ist das Ja zu Gott, zu seiner Größe, zu seiner "Ehre". Ihm erweisen die Menschen glaubend, hoffend und liebend Ehre, indem sie ihn anrufen und seinen Namen preisen und heilig halten.
2. Den Namen Gottes anrufen im Beten
Die Bindung des Menschen an Gott drückt sich am tiefsten in der Hingabe an Gott und im Beten zu Gott aus (vgl. zum Gebet als Ausdruck des Glaubens KEK 1, 86-91).
2.1. Weisen des Betens
Im Beten erkennt der Mensch seine eigene Geschöpflichkeit an, durchbricht sie aber zugleich und wendet sich dem Du Gottes zu; er ist offen für Gott, erhebt sein Herz zu ihm und spricht mit ihm. Beten ist "Erheben des Herzens zu Gott" (Johannes von Damaskus, de fide orthodoxa 3,24) und "Gespräch mit Gott". Alle Weisen des Betens sind Ausformungen unserer Bindung an Gott. Das christliche Gebet "ist Handeln Gottes und Handeln des Menschen. Es geht aus dem Heiligen Geist und aus uns hervor. In Vereinigung mit dem menschlichen Willen des menschgewordenen Gottessohnes richtet es sich ganz auf den Vater" (KKK 2564). Es ist eine Bewegung der Liebe, die von Gott ausgeht und auf welche der Mensch in Liebe antwortet.
Eine erste Weise des Betens ist das Preisen und Rühmen Gottes in der Anbetung als Antwort auf Gottes Handeln und auf sein offenbarendes Wort. "Gott anbeten heißt, ihn als Gott, als den Schöpfer und Retter, den Herrn und Meister von allem, was ist, als unendliche und barmherzige Liebe anzuerkennen . . . Gott anbeten heißt, wie Maria im Magnificat ihn zu loben, ihn zu preisen und sich selbst zu demütigen, indem man dankbar anerkennt, daß er Großes getan hat und daß sein Name heilig ist. Die Anbetung des einzigen Gottes befreit den Menschen von der Selbstbezogenheit, von der Sklaverei der Sünde und der Vergötzung der Welt" (KKK 2296f). Seit dem Kommen Christi preist die Kirche durch alle Zeiten in Hymnen, Liedern und Gesängen den Namen des dreieinigen Gottes. Ein altes Sprichwort sagt: "Wer singt, betet doppelt!" Er erhebt Herz und Stimme zu Gott, um Gottes Lob zu singen wie im Lobgesang der drei Jünglinge (vgl. Dan 3,51-90), im Sanctus der heiligen Messe (vgl. Jes 6,3; Offb 4,8) oder im Sonnengesang des heiligen Franziskus.
Eine zweite Weise des Betens ist das Danken als Antwort des Menschen auf die schenkende Liebe und Güte Gottes. Der Mensch hat sich nicht selbst gemacht, er lebt nicht aus sich selbst, er verdankt sich nicht sich selbst, sein Leben ist Geschenk und Gabe der Güte Gottes.
Im Dankgebet sagen wir Gott Dank für unser Leben und bringen uns im Dank an Gott zurück. Wir danken für die gute Schöpfung Gottes, für die Vielfalt des Lebens auf der Erde, für unsere Mitmenschen und vor allem für unsere Erlösung in Jesus Christus. So ist das Danken ein Grundakt des erlösten Menschen. Es soll im Alltag seinen festen Platz haben. In der Liturgie wird es vor Gott getragen und im Fest des großen Dankes, in der Eucharistie, gefeiert.
Oft gehen Menschen achtlos an Dingen vorbei, die ihnen als Geschenk und Gnade zugedacht sind; sie bemerken sie nicht und machen dadurch ihr Leben ärmer. Oft unterlassen sie es, Dank zu sagen, und nehmen das, was sie als Geschenk Gottes empfangen, wie selbstverständlich hin: die Geburt eines gesunden Kindes, die Treue eines Menschen, die Gaben der Natur, die Gesundung aus schwerer Krankheit und vieles mehr. Wie wir im Dank an Menschen daran denken, daß wir beschenkt worden sind, so sollen wir im Dank an Gott daran denken, daß wir selbst Geschenk seiner Güte und Liebe sind. Die höchste Weise der Danksagung ist die Feier der Eucharistie, in der die Kirche "bezeugt, was sie ist, und wird, was sie bezeugt" (KKK 2637).
Eine dritte Weise des Betens ist das Gebet der Hingabe als liebende Antwort des Menschen auf den Ruf der Liebe Gottes. Im Gebet der Hingabe, das auch das Reuegebet einschließen kann, geben wir uns ganz in Gottes Willen, wie Jesus Christus sich ganz dem Willen des Vaters übergeben hat.
Das Gebet der Hingabe kann am Anfang jedes Tages, aber auch an besonders schwierigen Wegmarken stehen: in Krankheit und Leid, in grundsätzlichen Lebensentscheidungen, in der Gefährdung des Glaubens, in Bedrängnis und Verfolgung.
Eine vierte Weise des Betens ist das Gebet der Klage, der Bitte und der Fürbitte. Es erwächst aus Not und Hilflosigkeit und ist Ausdruck unserer Bedürftigkeit vor Gott. Vieles, was in der Welt, in der Geschichte der Völker und im Leben der einzelnen Menschen geschieht, erscheint uns wie ein sinnloses und blindes Schicksal: Naturkatastrophen, der Tod eines geliebten Menschen, ungerechtes Leiden, Demütigung, Zurücksetzung, Kränkung und Verachtung. Viele Menschen sind einsam, leiden unter Krankheit und Alter und wissen vor Kummer nicht ein noch aus. Sie treten vor Gott hin mit der Klage oder gar anklagenden Frage: Warum geschieht das alles? Warum muß gerade mich solches Unheil treffen? Warum läßt Gott das alles zu?
Im Bittgebet wendet sich der Glaubende an Gott und vertraut ihm seine Sorgen an, wie ein Kind zu Vater und Mutter geht. Gott ist für uns wie ein Vater und wie eine Mutter, er liebt uns und nimmt sich unserer Sorgen an. Im Bittgebet drückt sich unser Vertrauen aus. Die Vertrauensäußerung kann auch zu einem eigenen Gebet werden (vgl. Ps 23).
Das Neue Testament berichtet davon, daß Jesus sich immer wieder in die Einsamkeit zurückzieht, um zu beten. Er bittet den Vater und lädt auch uns ein, zu ihm zu gehen und darauf zu vertrauen, daß Gott unsere Bitten in seinem Namen erhört: "Was ihr vom Vater erbitten werdet, das wird er euch in meinem Namen geben" (Joh 16,23). In der Bitte können wir nicht nur zum Vater im Himmel gehen, sondern auch zu Jesus Christus selbst. Er verheißt uns die Erfüllung unserer Bitten, zumal wenn wir einmütig im Namen Jesu versammelt sind und mit ihm uns an den Vater wenden (vgl. Mt 18,19f).
Zum Bitten gehört auch die Fürbitte. In ihr stehen wir füreinander bei Gott ein. Im Fürbittgebet erweisen wir unsere Solidarität mit den uns Anvertrauten und mit allen Menschen: mit den Lebenden und den Verstorbenen, ja, mit der ganzen Schöpfung Gottes.
Werden unsere Klagen, Bitten und Fürbitten, die wir "im Namen Jesu" an den Vater richten, wirklich immer gehört und erhört? Haben wir nicht oft den Eindruck, daß Gott auf unser eindringliches Bitten schweigt?
Von unserer menschlichen Einsicht her ist eine Antwort nicht möglich. Im Glauben an Gottes Vorsehung, die alles menschliche Verstehen übersteigt, und im Vertrauen auf Jesu Wort aber können wir sagen: Gott hört unser Klagen und erhört unser Bitten in einer Weise, die größer ist als alles, was wir denken können und zu hoffen wagen. Gott vermag "unendlich mehr zu tun, als wir erbitten oder uns ausdenken können" (Eph 3,20). Wir kennen seine Wege nicht. Er allein weiß, was uns zum Heile dient. Darum dürfen wir unser Klagen und Bitten vor ihn hintragen und uns selber seiner Liebe und Güte anvertrauen.
Die Kirche ist ihrem Wesen nach eine betende Kirche. Sie lobt und preist Gott; sie dankt für die Schöpfung und für die Erlösung in Christus; sie gibt sich ganz in die Liebe Gottes und bittet Gott für jeden einzelnen und für alle Menschen: für die Lebenden und für die Verstorbenen, für die Armen und die Reichen, für die Schwachen und Unterdrückten, für die Behinderten, Kranken und Sterbenden. Wir sind eingeladen, mit der betenden Kirche Gott zu ehren und ihn anzubeten. Wie das Gebet der Gemeinschaft den einzelnen führen will, so ist das Gebet des einzelnen immer von der Gemeinschaft getragen und dient der Gemeinschaft. Die höchste Weise des Betens ist die Feier der Eucharistie. "Die Eucharistie enthält alle diese Gebetsformen und bringt sie zum Ausdruck: sie ist ,die reine Opfergabe` des ganzen Leibes Christi ,zur Ehre seines Namens`; sie ist den Überlieferungen des Ostens und des Westens zufolge ,das Lobopfer` schlechthin" (KKK 2643).
2.2. Formen des Betens
Im Beten gewinnt unser Glaube Gestalt. Als "Atemholen der Seele" ist es lebensnotwendig für den Glauben. Darum ist Beten für den Glaubenden etwas Selbstverständliches.
Die Verpflichtung zum Beten ergibt sich nicht aus einem äußeren Gesetz, sondern aus dem Wesen des Menschen in seiner Beziehung zu Gott. Deshalb ergeht die Mahnung Jesu an die Jünger, "daß sie allezeit beten sollen" (Lk 18,1).
Die Formen des Betens können sehr verschieden sein. Wir kennen das private und das öffentliche Gebet, das mündliche und das Gebet ohne Worte, das vorformulierte und das freiformulierte Gebet. Alle diese Formen haben in der Kirche eine lange Tradition. Welche Form wir auch wählen mögen, entscheidend ist immer, daß wir "im Namen Jesu" beten und unser Leben durch ihn im Heiligen Geist vor den Vater bringen (zu den verschiedenen Formen des Gebetes vgl. besonders die Ausführungen in KKK 2705-2719).
Eine eigene Form der Einübung des Betens kann die Meditation sein. Sie findet besonders bei Menschen, die in der Vielfalt der Spannungen und Anforderungen der modernen Kultur ein Bedürfnis nach Stille, Sammlung und Einkehr verspüren, großen Anklang. Immer häufiger werden nicht nur Praktiken der Meditation, die aus dem christlichen Osten stammen, angewendet, sondern auch solche, die von den nichtchristlichen Hochreligionen inspiriert sind oder (wie zum Beispiel "Zen", "transzendentale Meditation" oder "Yoga") in der Welt des Hinduismus und Buddhismus beheimatet sind. Dabei wird nicht selten im Raum des Christentums und in kirchlichen Gemeinschaften der Versuch unternommen, die christliche Meditation mit der nichtchristlichen zu verschmelzen. Sofern es sich dabei um die Anwendung von bewährten Praktiken handelt, die aus dem christlichen Osten und aus den nichtchristlichen Hochreligionen stammen, können diese ein geeignetes Hilfsmittel für den Betenden darstellen, sogar mitten in äußerem Trubel innerlich entspannt vor Gott zu stehen (vgl. Schreiben der Kongregation für die Glaubenslehre über einige Aspekte der christlichen Meditation vom 15. 10. 1989, 28).
Allerdings ist zu beachten, daß mit den vielfachen Vorschlägen und Versuchen, christliche und nichtchristliche Meditation zu harmonisieren, auch Risiken und Irrtümer verbunden sein können. Nach manchen Vorschlägen sollen fernöstliche Methoden nur dazu dienen, sich psycho-physisch auf eine christliche Meditation vorzubereiten. Andere versuchen, mit Hilfe unterschiedlicher Techniken geistliche Erfahrungen zu erzeugen; und wieder andere "scheuen sich nicht, das Absolute ohne Bilder und Begriffe, wie es der Theorie des Buddhismus eigen ist, mit der Majestät Gottes, die in Christus geoffenbart wurde und die über die endliche Wirklichkeit erhaben ist, auf eine Stufe zu stellen" (ebd. 12). Bei Techniken, die physische Übungen beinhalten, ist stets zu prüfen, ob sie wirklich eine Einübung des Betens sind oder lediglich der Entspannung dienen oder gar zu einem Körperkult werden, der nichts mit der Erhebung des Geistes zu Gott zu tun hat. Bei den Vorschlägen, die auf ein Eintauchen in den Abgrund der Gottheit abzielen, ist an das Beispiel und die Lehre der heiligen Theresia von Jesus zu erinnern, die zu ihrer Zeit Methoden zurückwies, die dazu aufforderten, von der Menschheit Christi zugunsten eines vagen Eintauchens in den Abgrund des Göttlichen abzusehen.
Aus alledem ergibt sich, daß bei Versuchen, fernöstliche und christliche Meditation miteinander zu verbinden, stets deren Gehalt und Methode geprüft werden muß, damit es nicht zu einer für alle Seiten schädlichen Vermischung (Synkretismus) kommt. Zwar muß jeder einzelne sich seinen ganz persönlichen Weg des Betens suchen, aber er wird bei seinem Beten unpersönliche oder auf das eigene Ich konzentrierte Techniken meiden, die lediglich automatische Abläufe bewirken, in denen der Betende in einem rein innerlichen Spiritualismus verhaftet bleibt und so unfähig wird, sich dem transzendenten Gott frei zu öffnen.
Entscheidendes Kriterium für das rechte Beten ist, daß sich der Glaubende vom Heiligen Geist leiten läßt, der ihn durch Christus zum Vater führt und in die Gemeinschaft der Glaubenden einweist.
Die große Vielfalt der Formen des Betens eröffnet jedem die Möglichkeit, im Mitleben mit der Kirche und in seiner ganz persönlichen Weise Gott zu begegnen. Als Kinder des himmlischen Vaters dürfen wir zu ihm kommen, wie wir sind.
2.3. Ordnungen und Zeiten des Betens
Wir brauchen für unser Beten das Einüben wie auch Ordnungen und Zeiten des Betens. Für das Einüben des Betens mit Kindern und Jugendlichen kommt den Eltern, Priestern, Diakonen, Laien im pastoralen Dienst, Religionslehrern und Katecheten eine besondere Verantwortung zu. Den Kindern und Jugendlichen soll ein Schatz an Gebeten vermittelt werden, vor allem aber sollen sie lernen, mit innerer Sammlung zu beten. Eine lange christliche Erfahrung lehrt, daß für das Beten nicht nur die innere, sondern auch die äußere Haltung von Wichtigkeit ist. Die äußere Haltung soll Ausdruck der inneren Sammlung sein, und umgekehrt soll das "Herz bei dem verweilen, was der Mund ausspricht" (Die Regel des heiligen Augustinus, II).
Mancher sagt: Ich habe keine Zeit zum Beten. Andere meinen: Ich bete nur, wenn ich das Bedürfnis danach habe. Wieder andere: Ich finde nicht die Ruhe, täglich zu beten. Nach aller menschlichen Erfahrung verkümmert das Beten allmählich und verschwindet schließlich ganz, wenn es nicht einen festen Platz im Leben hat. Wir brauchen eine Ordnung regelmäßigen Betens. Unser Beten soll so sein, daß es den Alltag mit seinen Ereignissen und Begebenheiten durchdringt: Familie, Arbeit, Beruf, Umwelt und das menschliche Zusammenleben, ja, die ganze Wirklichkeit unserer Welt. Der Rhythmus des Tages sollte durch regelmäßiges Beten von der Wirklichkeit Gottes her durchdrungen sein (Morgengebet, Tischgebet, Abendgebet).
Die Übung, bestimmte Zeiten des Betens einzuhalten, macht nicht die ganze Ordnung des Betens aus. Es gibt viele Gelegenheiten, in denen wir vor Gott ganz spontan ein Wort des Dankes, der Bitte oder des Segens sagen. Von Zeit zu Zeit suchen wir die Stille, die Besinnung, die Meditation, die Anbetung, Tage der intensiven Begegnung mit Gott in Exerzitien oder Einkehrtagen. In diesen Weisen des Betens lebt der Glaubende sein Verhältnis zu Gott, wie es seiner Eigenart entspricht. Das Grundgesetz unserer Beziehung zu Gott ist in allem das Gesetz des Neuen Bundes: das Gesetz der Liebe. Liebe kann nur leben, wenn sie von der Kraft des Gebetes getragen und durchformt wird. Darum ist das Gebet in unserem Leben unerläßlich.
Es kann Zeiten geben, in denen jemand innerlich ganz "ausgetrocknet" ist und darunter leidet, daß er dann nicht beten kann. Solche Zeiten der Trockenheit können unterschiedliche Ursachen haben. Große Heilige, besonders die Mystiker, berichten immer wieder von solchen Situationen. Ihr Beispiel lehrt uns, daß wir uns auch in solchen Zeiten nicht für Gott verschließen dürfen, sondern ruhig werden, uns offenhalten und warten können. Dann erfahren wir, daß Gott in die schweigende Stille hineinspricht und ganz bei uns ist.
2.4. Das "Gebet des Herrn"
All unser Beten, unser Rühmen und Preisen, unser Loben und Danken, unsere Hingabe und unsere Klage und Bitte ist eine Ausfaltung jenes großen Gebetes, das Jesus seine Jünger gelehrt hat, als sie ihn baten: "Herr, lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat" (Lk 11,1). Dieses Gebet, das wir als "Gebet des Herrn" oder als "Herrengebet" bezeichnen, das "Vater-unser", ist als christliches Grundgebet (KKK 2759) in der Fassung üblich geworden, wie sie sich im Evangelium nach Matthäus findet (vgl. 6,9-13):
- "Vater unser im Himmel,
- geheiligt werde dein Name.
- Dein Reich komme.
- Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
- Unser tägliches Brot gib uns heute.
- Und vergib uns unsere Schuld,
- wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
- Und führe uns nicht in Versuchung,
- sondern erlöse uns von dem Bösen."
Das Vater-unser hat eine geschlossene Form. Nach einer feierlichen Anrede an Gott folgen sieben Bitten, drei Du-Bitten und vier Wir-Bitten. Gott wird mit "unser Vater im Himmel" angesprochen. Dabei soll Gott nicht etwa weit weg vom Menschen in den Himmel entrückt werden. Vielmehr soll zum Ausdruck gebracht werden: Über dem irdischen Vater gibt es noch einen himmlischen Vater. Seine Verläßlichkeit und Fürsorge ist zwar mit der eines irdischen Vaters grundsätzlich vergleichbar, aber es besteht eben ein himmelweiter Unterschied: "Wenn schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wieviel mehr euer himmlischer Vater!" (Mt 7,11). Zum anderen wird mit dem kleinen Wörtchen "unser" bereits in der Gebetsanrede eine Gebetsgemeinschaft hergestellt. Wer das Vater-unser betet, betet in der Glaubensgemeinschaft mit anderen.
In den drei Du-Bitten kommt die Sache Gottes zur Sprache: sein Name, sein Reich, sein Wille.
Im antiken Denken steht der Name für die Person selbst, sagt ihr Innerstes aus. Deshalb geht es beim Namen Gottes auch um seine Person, seine Wirkkraft - soweit sie von Menschen erfahrbar ist. Beim "Namen Gottes" denken wir sofort an die Geschichte von Mose vor dem brennenden Dornbusch, wo Gott seinen Namen in einem Tätigkeitswort ausgesprochen hat: Jahwe = Ich bin für euch da (Ex 3,14). Wenn die Gemeinde im Vater-unser darum bittet, daß Gottes Name geheiligt wird, dann geht es zwar auch darum, daß wir wünschen, alle Menschen möchten Gottes Namen Ehre erweisen, aber in erster Linie geht es darum, daß Gott in seinem Gottsein, als "alles über und in allem" offenbar werde und dadurch in seiner Größe und Erhabenheit anerkannt werden möge. Gott selbst soll dafür sorgen und auch selbst dafür die Initiative ergreifen, daß er bei den Menschen Anerkennung, Huldigung usw. erfährt.
Das genau ist auch der Grundgedanke der zweiten Bitte: "Dein Königreich soll kommen." Auch hier ist die Initiative allein bei Gott. Menschen können nur darum beten, daß Gott endgültig die Königsherrschaft ergreift.
Wie die dritte Bitte zum Ausdruck bringt, wird Gott dann König sein, wenn sein Wille geschieht - im Himmel, nach dem antiken Weltbild dort, wo der Hofstaat Gottes ist, also in seiner direkten Umgebung - und auf Erden, also dort, wo die Menschen leben. Für die matthäische Gemeinde nimmt der Wille Gottes ganz konkrete Züge an: Damit sind "Gesetz und Propheten" gemeint, wie sie Jesus in der Bergpredigt letztgültig ausgelegt hat (Mt 5,17; vgl. 22,40).
Im Grunde geht es in allen drei Du-Bitten um das gleiche: daß Gott sich in der Welt durchsetzt. Es geht um seinen Weg für und mit uns Menschen. Gott hat dabei den absoluten Vorrang. Weil die Gemeinde mit Jesus überzeugt ist, daß es für den Menschen nichts Besseres geben kann, bittet sie darum, daß Gott selbst die von ihm gewollte Zukunft für die Welt und für die Menschen herbeiführt. Vom Mittun der Menschen ist dabei nur sekundär die Rede, etwa vom Tun seines Willens - als Konsequenz der Tatsache, daß Gott als König herrscht. Die Gemeinde bemüht sich jetzt schon, entsprechend der Bergpredigt, also dem Willen Gottes gemäß, zu leben. Damit wechselt die Perspektive des Gebetes auf die Seite der Menschen.
In den sich anschließenden vier Wir-Bitten kommt die Sache der Menschen zur Sprache: ihre alltäglichen Bedürfnisse und Nöte.
An erster Stelle steht die Bitte um materielle Versorgung mit dem Grundnahrungsmittel Brot. Wörtlich wird man übersetzen müssen: "unser notwendiges Brot" oder vielleicht sogar: "Unser Brot für den morgigen Tag gib uns heute." Es geht in dieser Bitte nicht um mittel- oder langfristige Vorsorge, sondern es geht um die Haltung der Sorglosigkeit, die darauf vertraut, daß Gott weiß, was wir Menschen brauchen (vgl. Mt 6,32) - auf eine für den Alltag praktizierbare Formel gebracht: Auch der noch so religiöse Mensch lebt nicht von der Luft, auch nicht vom Wort allein (vgl. Mt 4,4); auch er braucht Brot zum Leben. Auch er darf zunächst an die primären Lebensbedürfnisse denken, bevor er sich - wie es ab der nächsten Bitte geschieht - die eigentlich ethischen und existentiellen Fragen zu Herzen nimmt. Und vor allem: auch der religiöse Mensch braucht sich nicht schäbig vorzukommen, wenn er Gott um die einfachen, für das alltägliche Leben notwendigen materiellen Dinge bittet.
Das Typische an der zweiten Wir-Bitte ist der Gedanke der göttlichen und menschlichen Vergebung: "Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern."
Im Rahmen des Matthäusevangeliums denkt man sofort an das Gleichnis vom unbarmherzigen Gläubiger (18,23-35). Es erzählt davon, daß einer zwar von seinem Herrn große "Schulden erlassen" bekommt, selbst aber nicht bereit ist, seinem Mitknecht eine kleine "Schuld" zu "erlassen". Natürlich ist hier und in der Vaterunser-Bitte von "Geldschuld" im übertragenen Sinn die Rede: Es ist daran gedacht, was Menschen Gott und einander "schuldig" bleiben. Die Vergebung von Schuld durch Gott, wie sie die Gemeinde zum Beispiel im Abendmahl feiert (Mt 26,28), muß Konsequenzen für das tägliche Miteinander haben. Das ist das Thema des Gleichnisses und unserer Vater-unser-Bitte.
Alle diese eindringlichen Worte sind um eine alte kirchliche Regelung gruppiert, die allerdings ganz andere Töne anschlägt. Wer sich gegen einen anderen verfehlt, soll zunächst unter vier Augen zurechtgewiesen werden; hört er nicht, sollen Zeugen hinzugenommen werden; hört er auch auf sie nicht, soll er vor die Gemeinde gestellt werden; wenn er auch auf die Gemeinde nicht hört, dann, so heißt es in der Regel, "sei er dir wie ein Heide und ein Zöllner" (Mt 18,15-17), das heißt, er soll aus der Gemeinde ausgeschlossen werden; und dieser Ausschluß wird als eine "Lösung" bezeichnet, die auch im Himmel "zu Buche schlägt" (vgl. Mt 18,18). Die Kontrastwirkung liegt auf der Hand: Die Gemeinde, die den Wortlaut ihrer kirchlichen Regelung plötzlich im Zusammenhang von eindringlichen Worten über Barmherzigkeit und unbegrenzbarer Versöhnungsbereitschaft hört, wird nicht umhin können, ihre "altbewährte" Praxis neu zu bedenken. Und jedesmal, wenn sie die Vergebungsbitte im Vater-unser spricht, wird sie sich fragen müssen, ob sie denjenigen, die sie ausgeschlossen hat oder die sie ausschließen will, wirklich nachgegangen, ihnen wirklich entgegengekommen ist und Versöhnung angeboten hat, mit einem Wort: ob ihr Gebet mit ihrer Alltagspraxis wirklich übereinstimmt. Um diesen Zusammenhang deutlich zu machen, hat der Evangelist die Vergebungsbitte im Anschluß an das Vater-unser als eindringliche Mahnung wiederholt: "Wenn ihr nämlich den Menschen ihre Fehltritte erlaßt, wird sie auch euch euer himmlischer Vater erlassen. Wenn ihr sie aber den Menschen nicht erlaßt, wird euer Vater auch eure Fehltritte nicht erlassen" (Mt 6,14f).
Die dritte und die vierte Wir-Bitte gehören zusammen. War in der Brotbitte die materielle Not das Thema, sprach die Vergebungsbitte die Not im sozialen Miteinander an, so geht es den letzten beiden Wir-Bitten um existentielle Not: daß auf den Menschen, solange er in dieser Welt lebt, negative Kräfte einwirken, denen er hilflos ausgesetzt scheint. Das Vater-unser spricht von "dem Bösen". Bei "Versuchung" ist an existentielle Bedrohungen des Lebens zu denken, an schwere Krankheit, an Leid, an all das, was einen mit Gott hadern lassen und den Glauben ins Wanken bringen kann. Mit einem Wort aus der Psalmensprache fleht das Vater-unser in seiner abschließenden Bitte darum, aus der unheimlichen Gewalt des Bösen "herausgerissen" zu werden (vgl. Ps 17,13). Damit schließt sich der Kreis zum Anfang des Vater-unser, das mit den Bitten um die Durchsetzung der Gottesherrschaft gegen alle Widerstände einsetzt.
Als grundlegende Gebetshaltung des Vater-unser wird deutlich: Bei der Sache Gottes, die in den Du-Bitten zur Sprache kommt, geht es in der Auswirkung letztlich um die Sache der Menschen; die Sache der Menschen, die in den Wir-Bitten ausgesprochen wird, bleibt letztlich auf Gott verwiesen. Menschen können aus eigener Kraft weder ihrer materiellen noch ihrer sozialen Not, erst recht nicht ihrer existentiellen Not Herr werden. Sie können nur auf Gottes Herrschaft hoffen, darauf, daß Gott sich endlich dort als Herr erweist, wo Menschen am Ende sind.
In kommunikativer Hinsicht ist das Vater-unser von vornherein im Blick auf eine größere Gemeinschaft formuliert. Das zeigt sich besonders an den Wir-Bitten. In den Bereichen, die eigentlich den ganz persönlichen Lebensraum betreffen (der Sorge um Nahrung, den Schwierigkeiten miteinander, den persönlichen Belastungen), wird der Beter sofort in die Gemeinschaft der anderen hineingestellt, indem er nicht "mein Brot", sondern "unser Brot" sagt, nicht um die Vergebung "meiner Schulden", sondern "unserer Schulden" bittet. Indem der einzelne nicht ich" und "mein", sondern "wir" und "unser" spricht, betet er zugleich für andere mit und darf umgekehrt darauf vertrauen: Ich stehe nicht allein mit meiner Not. Außerdem sind diese Wir-Bitten so offen formuliert, daß jeder mitbeten kann, ohne vereinnahmt zu werden. Die konkrete Umsetzung für das eigene Leben ist durch den einzelnen selbst zu leisten; sofern eine solche für das Gemeindeleben nötig ist, wird sie durch den Kontext des Evangeliums hergestellt, also durch die Verkündigung von Jesusgeschichten und Jesusworten in der Gemeinde. Stichworte und tragende Gedanken des Vater-unser können, wie für die Vergebungsbitte gezeigt, dadurch einen ganz spezifischen, eventuell sogar neuen Bezug erhalten.
Im Neuen Testament ist das Vater-unser ein zweites Mal überliefert, und zwar im Lukasevangelium (11,2-4):
- "Vater
- dein Name werde geheiligt.
- Dein Reich komme.
- Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen.
- Und erlaß uns unsere Sünden;
- denn auch wir erlassen jedem,
- was er uns schuldig ist.
- Und führe uns nicht in Versuchung."
Wie im Matthäusevangelium, so läßt sich auch im Lukasevangelium ein spürbarer Zusammenhang von Gebet und Gemeindesituation erkennen. Das Gebet prägt das Gemeindeleben; das Gemeindeleben mit seinen Schwierigkeiten und Problemen wirkt auf das gemeinsame Gebet zurück. Urchristliche Gemeinden zeigen ein großes Bemühen, zwischen dem Gebet, das sie ausdrücklich auf Jesus zurückführen, und ihrem konkreten Gemeindeleben eine lebendige Verbindung zu halten.
Beim Herrengebet ist deutlich der Hintergrund jüdischer Gebetspraxis zu spüren. Besonders auffallend ist die Nähe zum sogenannten Kaddisch: "Groß gemacht und geheiligt werde sein großer Name in der Welt, die er geschaffen hat nach seinem Willen. Er lasse seine Königsherrschaft herrschen in eurem Leben und in euren Tagen und im Leben des ganzen Hauses Israel, in Eile und in naher Zeit." Wie im jüdischen Achtzehngebet wird auch im Herrengebet um die Vergebung der Sünden gebetet: "Verzeihe uns, unser König . . ."
Jesus steht mit dem Gebet, das er seine Jünger lehrt, ganz in der Gebetstradition Israels. Allerdings lassen sich auch markante Unterschiede nicht überhören: Im Vater-unser fehlt jeglicher politische Einschlag und jegliche drängende eschatologische Note. Hinter der Anrede "Vater" dürfte die auch im Markusevangelium (14,36) und bei Paulus (Gal 4,6; Röm 8,15) überlieferte aramäische Anrede "Abba" stehen. Mit "Abba" wird zur Zeit Jesu ein älterer Mann angeredet, durchaus ehrfurchtsvoll. Zwei Dinge sind an dieser Wahl der Gottesanrede allerdings auffällig: Zwar wird in Israel Gott oftmals als "Vater" bezeichnet, Gott in sehr liebevollen Bildern als Vater (vgl. Dtn 1,31) oder Mutter (vgl. Jes 66,13) geschildert, aber es läßt sich für die Zeit Jesu äußerst selten nachweisen, daß Gott in Gebeten als "Vater" angeredet wird, noch dazu in der Umgangssprache (Aramäisch) und nicht in der Hochsprache (Hebräisch), die für den Gebetsraum typisch ist. Zum anderen fällt im Vergleich mit anderen Gebeten auf, daß die Anrede Gottes bei Jesus im Lukasevangelium äußerst nüchtern klingt - ein Grund, der in der Gemeinde des Matthäus schon früh dazu geführt hat, die Anrede so zu erweitern, wie es in der synagogalen Liturgie offensichtlich üblich war und in vielen späteren jüdischen Gebeten belegt ist: "Unser Vater im Himmel".
Auch der Schluß des jesuanischen Gebetes im Lukasevangelium ist sehr abrupt, es endet mit einer negativen Bitte. Auch in diesem Fall hat das Matthäusevangelium eine positive Bitte hinzugefügt: "Sondern erlöse uns von dem Bösen!"
Vollends liturgiefähig wird das Vater-unser schließlich dadurch, daß - wie es ebenfalls für jüdische Gebete charakteristisch ist - ein abschließender Lobpreis hinzugefügt wird (vgl. Didach‚ 8,2), ähnlich wie wir ihn heute zusammen mit den evangelischen Christen an das Vater-unser anzuhängen gewohnt sind: "Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen" (vgl. dazu KKK 2760).
Wenn Christen heute das Vater-unser in der Formulierung des Matthäusevangeliums beten, dann bewegen sie sich in einem reichen Traditionsstrom: Im Wortlaut der urchristlichen Gemeinden beten sie im Geist Jesu, dessen Worte wiederum in seiner eigenen geistigen Heimat, dem Judentum, verwurzelt sind. Im Vater-unser treten Christen mit Jesus vor Gott. Das Vater-unser atmet noch etwas von der religiösen Zukunftserwartung, die für Jesus und das Judentum so typisch ist: Die endgültige Zukunft dieser Welt steht noch aus. Sie liegt allein in Gottes Hand. Mit den Worten des Vater-unser bekennen wir uns auch als Christen bis heute dazu, daß die Erlösung letztlich noch aussteht und wir um die Erfüllung der Gottesherrschaft nur beten können.
Das Gebet des Herrn bleibt, trotz der Trennungen unter den Christen, "das Gemeingut aller Getauften und ein dringender Anruf an sie. Durch den gemeinsamen Glauben an Christus und durch die Taufe verbunden, sollen sie mit Jesus für die Einheit seiner Jünger beten" (KKK 2791).
"Die Getauften können nicht zu ,unserem` Vater beten, ohne alle, für die er seinen geliebten Sohn hingegeben hat, vor Gott zu tragen. Gottes Liebe ist grenzenlos, und unser Gebet soll es ebenfalls sein. Das Vater-unser öffnet uns für das gesamte Ausmaß der in Christus sichtbar gewordenen Liebe des Vaters. Wir beten mit allen und für alle Menschen, die den Vater noch nicht kennen, um ,die versprengten Kinder Gottes zu sammeln` (Joh 11,52). Diese göttliche Sorge um alle Menschen und um die ganze Schöpfung hat alle großen Beter beseelt; sie soll unser Gebet zu einer weitherzigen Liebe führen, wenn wir zu sprechen wagen: Vater ,unser`" (KKK 2793).
3. Gott ehren in Symbolen, Zeichen und Personen
3.1. Riten und Zeichen
Christliche Gottesverehrung bezeugt die Bindung des Menschen an Gott durch eine Vielfalt von religiösen Ausdrucksformen. Bereits das Alte Testament kennt neben einer großen Zahl an Riten, die auf die Reinigung, die Weihe und die Aufnahme in das Gottesvolk bezogen sind, heilige Orte (Tempel), heilige Zeiten (Sabbat, Paschafest), heilige Gegenstände und Geräte (Thorarollen, siebenarmiger Leuchter) und heilige Schriften (Thora, Schriften der Propheten) sowie religiöse Lieder, Psalmen und Gebete. Die Tradition solcher Riten und Zeichen hat sich im Christentum, freilich unter einer neuen Sinndeutung und unter Ausschluß vieler alttestamentlicher Vorschriften, fortgesetzt. Riten und Zeichen haben somit einen sozialen Charakter und sind Formen religiöser Kommunikation. In den Riten verbinden sich Menschen zum gemeinsamen Tun; Zeichen sind u. a. Erkennungszeichen, zum Beispiel in Form von formulierten Bekenntnissen und Kennen des Bekenntnisses. Bis heute sprechen wir von heiligen Orten (Kirchen, Kapellen, Wallfahrtsorte), heiligen Zeiten (Feiertage, Bußtage) und heiligen Geräten (Kelch, Patene, Hostienschale, Monstranz, liturgische Gewänder), heiligen Schriften (Altes und Neues Testament) und heiligen Handlungen (Weiheritus) bis hin zu geweihten Gaben der Schöpfung (Brot, Wein, Wasser und Öl). In alledem sehen wir Zeichen dafür, daß das Heilige in unserem Leben anwesend ist.
Riten und Zeichen, durch deren besondere Ehrung auf etwas Tieferes hingewiesen werden soll, gibt es auch im sozialen Leben: Die olympische Flagge weist auf die Verbundenheit der Kontinente hin; die Ehrung der Nationalfahne bezeugt den Respekt vor der Nation; das Tragen eines Ringes kann Freundschaft, Verlobung oder Verheiratetsein anzeigen; die Verleihung von Orden ist Symbol für besondere Verdienste. In allen Kulturen gehören solche Zeichen und Handlungen zum menschlichen Zusammenleben. Sie drücken in ihren unterschiedlichen Formen jeweils ein Element des menschlichen Zusammenlebens und der Zusammengehörigkeit aus.
3.2. Sakramente - wirkmächtige Zeichen der Gegenwart Gottes
Im christlichen Glauben sind die dichtesten Zeichen des göttlichen Heilshandelns die Sakramente. In ihnen wird Gottes Gnade gegenwärtig und wirksam.
Die Sakramente gehen auf Jesus Christus als Ursakrament des Heiles zurück. Er, der als Wort des Vaters in unsere menschliche Geschichte eingetreten ist und insbesondere durch Kreuz und Auferstehung in ihr wirksam wurde, hat seiner Kirche die Sakramente eingestiftet. Damit ist nicht gemeint, daß Jesus während seines irdischen Lebens alle Sakramente ausdrücklich durch ein Stiftungswort (wie bei der Eucharistie) eingesetzt oder gar alle Einzelheiten des Ritus festgelegt hat. Entscheidend ist, daß die Sakramente ihrem allgemeinen Wesen nach im Ganzen des Heilswerkes Jesu Christi grundgelegt sind und zusammen eine organische Einheit bilden (vgl. KEK 1, 320).
Die Kirche ist "in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit" (LG 1). Sie vermittelt den Gläubigen in Grundsituationen des menschlichen Lebens sakramentale Hilfen. Die Sakramente bewirken geistlich, was sie im Zeichen anzeigen. "Der unsichtbare Gott wendet sich im sichtbaren Zeichen des Sakramentes dem Menschen zu, um sich ihm zu schenken, und bietet ihm so das Heil an. Der glaubende Mensch nimmt dieses Geschenk in Freiheit und Dankbarkeit entgegen . . . So sind die Sakramente Zeichen des Glaubens in zweifacher Hinsicht: Der gläubige Mensch bezeugt in ihrem Empfang seinen Glauben an die wirksame Hilfe Gottes; durch dieses Wirken Gottes wird ihm gleichzeitig Glaube geschenkt und bestärkt" (Gemeinsame Synode, Beschluß: Schwerpunkte heutiger Sakramentenpastoral A, 2). Jesus Christus hat der Kirche die Sakramente als bleibende Zeichen seiner Nähe und Liebe anvertraut. Es ist ihre Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, daß in der Gemeinde der Glaubenden der rechte Gebrauch der Sakramente bewahrt und gelebt wird.
Die genaue Zahl der Sakramente hat sich im Lauf der Kirchengeschichte erst allmählich geklärt. Die Kirche hat die Sakramente seit ältester Zeit gespendet. Ihre Zahl wurde noch nicht ausdrücklich benannt, weil der Sakramentsbegriff noch nicht deutlich ausgebildet war. Erst als sich in der Frühscholastik dieser Begriff klärte und das Verständnis dafür wuchs, daß nur bestimmten heiligen Zeichen die höchste sakramentale Beschaffenheit zukommt, wurde (seit dem 12. Jahrhundert) von der Theologie die Ausgrenzung und Hervorhebung der Siebenzahl getroffen. Sie fand im 13. Jahrhundert Aufnahme in Beschlüsse kirchlicher Synoden und des Konzils von Lyon (1274: DS 860), das die sieben Sakramente auch im einzelnen benannte. Das Konzil von Trient nahm diese Lehre auf mit dem Zusatz, daß es "nicht mehr und nicht weniger Sakramente" gebe, nämlich: Taufe, Firmung, Eucharistie, Buße, Krankensalbung, Weihe, Ehe (vgl. ausführlich dazu KEK 1, 317-327).
Andere kirchliche Riten, Segnungen und Symbolhandlungen werden nicht als Sakramente, sondern als Sakramentalien bezeichnet: die Segnung des Wassers oder Brotes; die Segnung mit Weihwasser, die Bezeichnung mit dem Kreuzzeichen, die Weihe beim Ordenseintritt und vieles mehr. Im Unterschied zu den Sakramenten gehen die Sakramentalien nicht auf Christus zurück, sondern haben sich als Ausdrucksformen der Frömmigkeit in der Kirche herausgebildet. Sie bekunden, daß die ganze Wirklichkeit der Welt von Gottes Liebe und Güte umfangen ist. Als Ausdruck des Glaubens sind sie für den Christen eine geistliche Hilfe. Sie bereiten auf den Empfang der heiligmachenden Gnade in den Sakramenten vor oder lassen die sakramentale Gnade zur weiteren Auswirkung im Leben gelangen. Anders als die Sakramente wirken sie nicht auf Grund ihres objektiven Vollzugs, sondern mittels der Fürbitte der Kirche und des frommen subjektiven Bemühens des Empfängers (vgl. KEK 1, 327-329). In ihnen preisen wir Gott und erbitten seine Hilfe. Solches Segnen und Weihen setzt Glauben voraus und ist so bewahrt vor dem Verdacht der Magie. Alle Segnungen geschehen im Namen des dreifaltigen Gottes und im Zeichen des Kreuzes, mit dem wir uns selbst und andere Menschen, aber auch die Früchte der Erde und der menschlichen Arbeit segnen. Darin stellen wir alles, was wir sind und haben, unter den Schutz Gottes und vertrauen darauf, daß uns in Jesus Christus alles zum Segen wird.
3.3. Gott ehren in den Heiligen
Besonders aussagekräftige Zeichen der Erlösung durch Jesus Christus sind die erlösten Menschen selbst. Die Kirche stellt sie uns vor in den Heiligen. Weil die Kirche glaubt, daß sich das Leben aller, die in Christus gestorben sind, in der Gemeinschaft des Himmels mit ihm vollendet, bekennt sie sich zur Gemeinschaft mit den Heiligen über die Grenzen des Todes hinweg. Die Verehrung und Anrufung der Heiligen ist durch eine lange Glaubenstradition, die mit der altchristlichen Märtyrerverehrung beginnt, verbürgt. Die Kirche erklärt zwar die Verehrung einzelner Heiliger nicht als verpflichtend. Sie spricht nur von ihrer Erlaubtheit und Nützlichkeit (DS 1821). Aber sie bezeugt als ganze durch die Heiligenfeste und die Verwendung der Heiligenlitanei bei verschiedenen liturgischen Feiern, daß die Verehrung und Anrufung der Heiligen zum Vollzug des kirchlichen Lebens gehört, vor allem die besondere Verehrung der Mutter des Herrn. Der Grund dafür liegt in dem Lobpreis der Gnade Christi, die sich in den Heiligen siegreich erwies; dieses Lob kann von der Kirche nicht unterlassen werden.
Als Gemeinschaft der Heiligen sieht sie in den zur Ehre der Altäre erhobenen Heiligen die schöpferischen Vorbilder für das Streben nach Heiligkeit aller ihrer Glieder: "Wenn wir nämlich auf das Leben der treuen Nachfolger Christi schauen, erhalten wir neuen Antrieb, die künftige Stadt zu suchen" (LG 50). So denkt sie auch sehr hoch von der Fürbitte der Heiligen als Hilfe auf dem Weg zur Heiligung. Sie hält sich hier an das Wort des Origenes (+ 253/4): "Alle vor uns entschlafenen Väter unterstützen uns durch ihr Gebet. Sie sind um das Heil der Menschen besorgt und helfen durch ihre Fürbitten bei Gott" (De orat. 11,2). Die Geringschätzung einer solchen Hilfe zum Heil käme der Mißachtung eines göttlichen Angebots gleich. Deshalb bezeichnet das Konzil von Trient die Leugnung der Berechtigung zur Anrufung der Heiligen als unehrerbietig (DS 1821).
4. Besondere Formen der Gottesverehrung
Im Sakrament der Taufe ist der Christ für immer in das Mysterium Christi und seiner Kirche eingebunden. Das Taufversprechen ist der fundamentale Akt der Übereignung an Gott in Jesus Christus. Auf diesem Fundament bauen alle weiteren Formen der Gottesverehrung auf.
4.1. Gelübde
Seit alters her gibt es in der Kirche das Gelübde als eine besondere Weise der Gottesverehrung. Es ist ein Versprechen an Gott, in dem man sich zu einem bestimmten guten Werk verpflichtet oder sogar sein ganzes Leben in den besonderen Dienst Gottes oder der Menschen stellt. Die Würde und religiöse Qualität des Gelübdes erwächst daraus, daß sich der einzelne in einem ganz persönlichen Versprechen an Gott wendet: "Ich verspreche dir!" und sich damit bindet.
Die Kirche kennt unterschiedliche Formen von Gelübden: zum beschaulichen Leben, zum Dienst an Kranken, zur Mission oder zu Sühnewerken. Gelübde können innerhalb oder außerhalb einer religiösen Gemeinschaft abgelegt werden, und sie können privat oder öffentlich sein. Die bekannteste Form ist das lebenslang bindende Gelübde der "evangelischen Räte": Armut, ehelose Keuschheit und Gehorsam. Das Zweite Vatikanische Konzil führt dazu aus:
- "Durch die Gelübde oder andere heilige Bindungen, die jeweils in ihrer Eigenart den Gelübden ähnlich sind, verpflichtet sich der Christgläubige zu den drei genannten evangelischen Räten und gibt sich dadurch dem über alles geliebten Gott vollständig zu eigen, so daß er selbst durch einen neuen und besonderen Titel auf Gottes Dienst und Ehre hingeordnet wird. Er ist zwar durch die Taufe der Sünde gestorben und Gott geweiht. Um aber reichere Frucht aus der Taufgnade empfangen zu können, will er durch die Verpflichtung auf die evangelischen Räte in der Kirche von den Hindernissen, die ihn von der Glut der Liebe und der Vollkommenheit zurückhalten könnten, frei werden und wird dem göttlichen Dienst inniger geweiht. Die Weihe ist aber um so vollkommener, je mehr sie durch die Festigkeit und Beständigkeit der Bande die unlösliche Verbindung Christi mit seiner Braut, der Kirche, darstellt" (LG 44).
Wer ein Gelübde macht, will Gott keine Leistung darbringen, sondern sich enger an ihn binden und ihm mit seiner Hilfe die Treue halten. Die besondere Bindung setzt eine tiefe Verwurzelung im Glauben und einen persönlichen Anruf Gottes voraus. Auf ihn antwortet der Berufene mit der Selbstübergabe in der Haltung der Armut, der ehelosen Keuschheit und des Gehorsams. Diese Weihe an Gott kann nur im Glauben erfaßt und gelebt werden. Der Glaube vermag den Blick auf den positiven Wert der evangelischen Räte "um des Himmelreiches willen" (Mt 19,12) zu lenken und zugleich die kritische Funktion dieser Haltungen gegenüber einem übersteigerten Streben nach Besitz, Genuß und Macht herauszustellen.
Wer ein solches Gelübde ablegt, gibt nicht in unzulässiger Weise seine Freiheit auf, sondern entscheidet sich in Freiheit, in besonderer Weise für Gott dazusein. Er gelobt sich in frei gewählter Bindung Gott an.
In der Übernahme der evangelischen Räte gibt sich der Glaubende ganz in den Willen Gottes, um Christus gleichgestaltet zu werden und "die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinem Leiden" (Phil 3,10) zu erfahren. Im Weg des Gelübdes der evangelischen Räte geht es somit nicht um "religiöse Selbstverwirklichung", sondern um die totale Verfügbarkeit für den Willen Gottes. Diesem kann derjenige, der ein Leben nach den evangelischen Räten gelobt, nur entsprechen, wenn er ganz auf die Gnade Gottes vertraut. "Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt" (Phil 4,13).
Neben diesen Gelübden, in denen man sich selbst Gott weiht, gibt es Gelübde, in denen sich jemand zu einem bestimmten Tun oder zu einer Sachleistung verpflichtet (Wallfahrt, Spende, Dienstleistungen usw.). Ein Beispiel für ein solches Gelübde ist das Versprechen Jakobs, Gott für den Fall eines guten Geleites ein Heiligtum zu erbauen und den Zehnten zu entrichten (vgl. Gen 28,20 ff).
In der gesamten christlichen Tradition sind Gelübde als besondere Akte der Gottesverehrung hoch geachtet. Auf dem Konzil von Trient verteidigt die Kirche die Gelübde gegen die Reformatoren (Luther, Calvin). Heute ist auch in einigen evangelischen Gemeinschaften das Gelübde wieder zu Ehren gekommen.
Jedes Gelübde hat sittliche Konsequenzen. Diese betreffen den Verpflichtungscharakter und die Gültigkeit von Gelübden. Wer ein Gelübde ablegt, ist sittlich verpflichtet, es auch zu erfüllen. Diese Verpflichtung trifft nur zu, wenn das Gelübde gültig ist. Dazu müssen verschiedene Voraussetzungen gegeben sein: Erstens muß der Gelobende die persönliche Reife und ein ausreichendes Wissen über das haben, was er gelobt. Zweitens muß er die feste Absicht haben, wirklich ein verpflichtendes Gelöbnis abzulegen. Drittens muß er das Gelübde in Freiheit, das heißt ohne Furcht und Zwang, ablegen. Viertens darf er nur etwas geloben, was für ihn erfüllbar und was sittlich gut ist.
Diese sittlichen Normen werden durch kirchenrechtliche Bestimmungen bestätigt und ergänzt (vgl. CIC, can. 1191-1198).
4.2. Eid
Die Tatsache, daß es in der Tradition des Alten Bundes wie in der christlichen Kirche den Eid oder Schwur gibt, zeigt, daß dem Eid über die bloß gesellschaftliche Bedeutung hinaus ein hoher religiöser Wert zukommt. Der religiöse Eid, in welchem man Gott zum Zeugen der Wahrheit einer Aussage (Aussageeid) oder der Ehrlichkeit eines Versprechens (Versprechenseid) anruft, gilt als eine besondere Form der Gottesverehrung. Wer sich im Eid auf Gott beruft, will sein Gebundensein an Gott bekunden und sich Gottes Gericht unterstellen. Deshalb wurde Meineid, das heißt falsches Schwören, in Israel streng verurteilt (vgl. Ex 20,7; Lev 19,12; Ez 16,59; 17,13-21), und deshalb erhoben auch die Propheten schwere Klage über den Verfall des Eides (vgl. Jer 5,2; 7,9; Sach 5,3f; Mal 3,5). Immer wieder wird behauptet, das Schwören widerspreche den Forderungen des Neuen Testamentes. Jesus sagt in der Bergpredigt: "Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein; was darüber ist, ist vom Bösen" (Mt 5,37; vgl. Jak 5,12). Dieses Wort richtet sich nicht gegen das Schwören als solches, sondern gegen die Unsitte des unnötigen, leichtfertigen Schwörens, weil man Gott nicht ohne Grund zum Zeugen anrufen soll. "Ihr sollt überhaupt nicht schwören!" (Mt 5,43) ist im Rahmen der Bergpredigt eine jener absoluten Forderungen, die Jesus von seiner Reich-Gottes-Verkündigung her stellt; sie ist und bleibt wegweisend. Allerdings betrifft sie, wie die Formulierung zeigt, das mitmenschliche Verhalten wohl vor allem zur Bekräftigung eines Versprechens und nicht unmittelbar die Eidesableistung vor Gericht. Das zeigt sich daran, daß Jesus gegen die beschwörende Frage des Hohenpriesters nicht protestiert hat (Mt 26,63). Das Sich-Verwünschen und Schwören des Petrus in der Verleugnungsgeschichte dagegen wird eindeutig negativ bewertet (Mt 26,74). In einem positiven Sinn begegnen aber auch bei Paulus Anrufungen Gottes als Zeugen zur Bekräftigung dafür, daß er nicht lügt (2 Kor 1,23; 11,31; vgl. Röm 1,9; Phil 1,8). Das Schwurverbot Jesu muß auf jeden Fall vor einem unnötigen Gebrauch des Eides warnen, weil damit die Ehrfurcht vor der Heiligkeit Gottes mißachtet wird.
In der kirchlichen Tradition wird die Erlaubtheit des Schwörens grundsätzlich bejaht (Ambrosius, Augustinus). Sie wird aber von verschiedenen Gemeinschaften immer wieder in Frage gestellt. Wie bereits früher die Katharer, Waldenser und Wiedertäufer (letztere nur den Versprechenseid), lehnen heute die Mennoniten, Herrnhuter und Quäker unter Berufung auf die Heilige Schrift jede Art von Eidesleistung ab.
Die katholische Kirche sucht der Forderung der Heiligen Schrift dadurch zu entsprechen, daß sie die Eidesleistung möglichst einschränkt und sie nur für erlaubt ansieht, wenn schwerwiegende Gründe dafür sprechen. Nach den Rechtsnormen der Kirche darf ein Eid, das heißt die Anrufung des göttlichen Namens als Zeugen für die Wahrheit, nur geleistet werden in Wahrheit, Überlegung und Gerechtigkeit. Die Voraussetzungen für die gültige Eidesleistung sind ähnlich wie beim Gelübde (vgl. CIC, can. 1199; 1204).
Auch die evangelische Theologie bekräftigt im Anschluß an Martin Luther die sittliche Erlaubtheit des Eides, der ein Bekenntnis zu Gott zum Ausdruck bringt, wobei weltliche Bereiche in die Herrschaft Gottes einbezogen sind.
Nach heutiger Rechts- und Staatsphilosophie muß es in Staaten, in denen Religion als Angelegenheit des einzelnen angesehen wird, dem einzelnen Menschen überlassen bleiben, ob er sich bei einer Eidesleistung auf Gott berufen will oder nicht. In einem religiös neutralen Staat darf niemand gezwungen werden, einen religiösen Eid zu leisten.
Wichtiger als die rechtliche Regelung von Eidesleistungen ist jedoch, daß der sittliche Charakter des Eides das eigentliche Fundament der rechtlichen Regelung ist. Das zeigt sich besonders, wenn jemand einen Meineid leistet. Wer sich beim Meineid auf Gott beruft, mißbraucht den Namen Gottes, indem er ihn in seine falsche Aussage und sein unaufrichtiges Versprechen hineinzieht. Wer einen Meineid leistet, verstößt auch dann gegen die sittliche Ordnung, wenn er dabei nicht Gott ausdrücklich zum Zeugen anruft. Dazu kommt, daß der Meineid ein schweres Unrecht gegenüber demjenigen ist, zu dessen Ungunsten der Meineid begangen wird.
Immer wieder gibt es Diskussionen über die Verbindlichkeit des politischen Eides, etwa des Fahneneides oder des Eides gegenüber dem Staatsoberhaupt. In der Zeit des Nationalsozialismus fühlten sich viele, besonders Beamte und Offiziere, an den Eid gebunden. Sie führten in bedingungsloser Treue zu ihrem Gelöbnis auch Gesetze und Befehle aus, die sittlich nicht zu rechtfertigen waren. Ein Eid kann immer nur soweit binden, wie er nicht zu unsittlichen Handlungen verpflichtet. Unsittliche Befehle dürfen nicht befolgt werden. Der Staatsbürger ist letztlich immer an sein Gewissen und an seine Verantwortung gegenüber der sittlichen Ordnung gebunden.
5. Mißbrauch des Namens Gottes
5.1. Aberglaube und Magie, Fluchen und leichtfertiges Reden über Gott
Das zweite Gebot will - und das war in Israel sein ursprünglicher Sinn - dem Mißbrauch des Namens Gottes wehren. Neben dem Mißbrauch durch falsches und leichtsinniges Schwören kam vor allem der Mißbrauch durch Aberglaube und Magie in Frage. Die Umwelt Israels war geradezu eine "Welt der Magie". Aberglaube und Magie waren, wie die Propheten berichten, auch in Israel verbreitet (vgl. Jer 27,9; Mi 5,11; Mal 3,5). Jede Form von Aberglaube wird in Israel als Zeichen für mangelndes Vertrauen auf Gott abgelehnt (vgl. Ex 22,18; Lev 19,26.31; 1 Sam 28; Jes 8,20; Jer 27,9). Durch Aberglaube wird Gott beleidigt. Aus der Sorge um die Reinerhaltung des Namens Gottes waren deshalb in Israel auch Zauberei und Magie streng verboten. Sie galten als Versuch, in Gottes Handeln einzugreifen (vgl. Ex 22,18; Lev 20,6; Dtn 18,10 u. a.).
Das Neue Testament spricht ein eindeutiges Urteil über den Aberglauben und das Festhalten an dämonischen Mächten und Kräften (vgl. Apg 13,10ff; 19,13-19).
Nach christlichem Verständnis verfälschen Aberglaube und Magie das Gottesverhältnis. Die Bindung an Gott durch Jesus Christus im Heiligen Geist steht grundsätzlich der Versuchung des Menschen entgegen, überall nach greifbaren Sicherheiten zu suchen. Alle Formen des Aberglaubens und der Magie widersprechen der Hoheit Gottes und seinem heiligen Namen.
Das Wort "Aberglaube" bedeutet verkehrter, falscher Glaube, aber auch unechte Glaubenshaltung. Aberglaube setzt ein magisches Weltbild und die Annahme unerklärbarer Mächte und Kräfte voraus, denen sich der Mensch ausgesetzt weiß und die er durch magisches Tun zu beeinflussen und günstig zu stimmen versucht. Eine abergläubische Einstellung läßt das Vertrauen darauf vermissen, daß der Mensch allein von Gottes Liebe und Güte getragen ist und von ihm allein sein Heil erwarten darf. Aberglaube verhindert so eine personale Gottesbeziehung; der Mensch flüchtet sich in eine Scheinwelt.
Aberglaube kann es in jeder Religion geben. Im Christentum kann er in einem magischen Verständnis von Elementen des christlichen Glaubens bzw. in einem Mißbrauch von christlichen Glaubens-, Kult- und Frömmigkeitsformen bestehen. Glaube und christliches Brauchtum können mit abergläubischen Vorstellungen verbunden sein oder zu Aberglauben werden (zum Beispiel die magische Verwendung von christlichen Symbolen und Zeichen zur Abwehr und Verbannung böser Mächte).
Magie ist mit Aberglauben verwandt und als eine Form des Okkultismus zu verstehen. Okkultismus ist die Beschäftigung mit Erscheinungen des Natur- und Seelenlebens, die die gewohnten Gesetzmäßigkeiten zu übersteigen scheinen. Mit bestimmten Praktiken (Glasrücken, Tischrücken, automatisches Schreiben, Pendel, Kristallsehen, Tonbandeinspielung) soll eine Verbindung mit dem "Übersinnlichen", mit Verstorbenen oder mit "Geistern" erzielt werden. Diese Form des Okkultismus wird als "Spiritismus" bezeichnet. Eine zweite Form des Okkultismus ist die "Magie". Hierbei soll durch Beherrschung geheimer Kräfte (schwarze Magie = Anrufung von Teufel und Dämonen und weiße Magie = Verwendung religiöser Formeln oder Symbole) eine negative (Schädigung von Mensch und Tier) oder eine positive Wirkung (Heilung von Krankheit, Gegenzauber gegen schwarze Magie) erreicht werden.
In der Deutung dieser Phänomene gibt es unterschiedliche Auffassungen. Nach der einen (Spiritisten) beweisen die okkulten Erscheinungen die Existenz einer jenseitigen Geisterwelt und die Unsterblichkeit der Seele. Der Kontakt mit der Geisterwelt (zum Beispiel mit Verstorbenen) wird von manchen als Trost empfunden und bejaht, während andere darin nichts als Teufelswerk sehen und okkulte Praktiken ablehnen. Nach der anderen Auffassung stammen die Kräfte, die bei okkulten Praktiken hervortreten, aus dem Unterbewußtsein der am Experiment beteiligten Personen und werden durch automatische Muskelbewegungen ausgelöst. Diese Richtung hält die Annahme einer Geisterwelt für überflüssig. Die Phänomene gelten grundsätzlich als wissenschaftlich erklärbar, wenn sie auch heute noch nicht geklärt sind.
Gegenwärtig ist die Verbreitung des Okkultismus bei Jugendlichen genauer untersucht. Sie setzen sich vor allem mit den einfachen Praktiken des Spiritismus auseinander. Erwachsene scheinen sich eher Bewegungen wie etwa "New Age" und Reinkarnationstheorien zuzuwenden. Im ganzen ist die Tendenz zur Annahme spiritistischer Weltbilder und mythologischer Weltdeutung steigend. Dahinter können psychologische Gründe stehen, aber auch eine Enttäuschung über das Versagen von Wissenschaft und Technik sowie das Gespür dafür, daß das rationalistische Weltbild der Aufklärung nicht ausreicht, um alle Phänomene der Welt zu erklären und den Menschen einen Sinn zu vermitteln. Daraus erwächst die Suche nach einem Weltbild und nach einer Schicksalsbewältigung durch okkulte Praktiken und durch Zuwendung zu Bewegungen, die den Anbruch eines "neuen Zeitalters" (New Age) ansagen.
In theologischer Hinsicht ist das Aufbrechen einer neuen Welle des Okkultismus ein Zurückfallen hinter die Einsichten des christlichen Gottes- und Menschenbildes und hinter die theologische Deutung des zweiten Gebotes. Der christliche Glaube sieht im Verhältnis zwischen Gott und den Menschen eine personale Beziehung. Diese verbietet ein Zurückfallen in Praktiken, mit denen über Gottes Freiheit und seine befreiende Zuwendung zu den Menschen verfügt werden soll. Wer sich in okkulten Praktiken die Kraft Gottes dienstbar machen will, macht Gott zum unfreien Götzen und liefert dadurch zugleich seine eigene Freiheit an die Unfreiheit aus; er fällt zurück in die Sklaverei der Abhängigkeit von Götzen. Demgegenüber ergeht vom zweiten Gebot her die Aufforderung: Wenn du Gott als den freien und befreienden Gott erfahren hast, kannst du doch Gottes Namen nicht mehr mißbrauchen und über Gott verfügen wollen.
Die gegenwärtige Zuwendung vieler Menschen zu okkulten Praktiken und zu Vorstellungen eines "neuen Zeitalters" ist aber auch eine kritische Anfrage an die Kirche und an die Gläubigen. Das Entstehen von Aberglaube und Okkultismus ist möglicherweise ein Ausdruck dafür, daß viele den christlichen Gott und den christlichen Glauben in der Kirche und bei den Gläubigen zu wenig als Befreiung zum wirklichen Menschsein erfahren. Das Wissen um Gott als Person und die rationale Erklärung von Glaubenswahrheiten sind in der Kirche notwendig, aber sie reichen nicht aus, um den Menschen für Gott und von Gott "ergriffen" werden zu lassen. Wo Kirche als Gemeinschaft von Glaubenden erlebt wird, die Gott als freien und befreienden Gott erfahrbar macht, wo die Frohbotschaft nicht Drohbotschaft wird und wo ihre Liturgie, ihr Beten, ihre Frömmigkeit Raum läßt für die innere Begegnung des Herzens mit dem unendlichen Geheimnis der Person Gottes, da ist nicht zu befürchten, daß irrational-magisches Denken aufbricht und der Name Gottes durch eine falsch geleitete Volksfrömmigkeit "entheiligt" wird. Gottes befreiende Gegenwart und sein Handeln in der Kirche, in den Menschen und in der alltäglichen Gegenwart wird am ehesten erfahrbar in der Art und Weise, wie Menschen mit Menschen umgehen, wie sie die geschenkte Freiheit in Gerechtigkeit und Liebe verwandeln und wie sie Gottes Schöpfung achten. Dadurch wird sein Name geheiligt.
Wie es der gesamten Tendenz der Offenbarung Gottes widerspricht, sich auf irgendeine Weise der Macht Gottes bedienen zu wollen, so widerspricht es auch der Ehre Gottes, unter Anrufung seines Namens Verwünschungen und Verfluchungen auszusprechen.
In heidnischen Religionen ist der Fluch eine magische Handlung, die den Feind oder Gegner schädigen soll. Auch im Alten Testament begegnet der Fluch an vielen Stellen. Hier wird er in die Ordnung Gottes gestellt. Gott selbst äußert seinen Zorn in der Verfluchung der Schlange (Gen 3,14), in der Strafandrohung bei Bundesbruch (Jer 11,3) und im Ausschluß aus der Gemeinschaft (Gen 4,11; 9,25). Fluch kann auch von Menschen ausgesprochen werden, aber nur in Abhängigkeit von Gott, der ihn allein vollziehen, abändern und zurücknehmen kann. In den sogenannten Fluchpsalmen (vgl. besonders Ps 109) liegen Bitten um Bestrafung von Feinden oder persönlichen Gegnern vor, die zugleich als Gottesfeinde gelten. Im Fluch wie in den Fluchpsalmen spielen Vorstellungen der Umwelt Israels eine Rolle, so vor allem die bildhafte orientalische Sprache. Im Neuen Testament ist der Fluch in dieser Bedeutung weithin aufgehoben. Andeutungen finden sich noch in den Weherufen (Lk 6,24 ff) und im Gerichtsurteil (Mt 25,41). Christen ist Fluchen untersagt (Lk 6,28; Röm 12,14), denn Verfluchung und Verwünschung verletzen die Ehrfurcht gegen Gott und die Liebe zum Nächsten.
Mancher Fluch richtet sich nicht gegen Menschen, sondern gegen Gott selbst und ist eine Gotteslästerung. Formen von offener oder versteckter Verächtlichmachung von Glaube und Religion in der Literatur, in Reden und Bildern, in Theaterstücken, Musicals und Fernsehsendungen verletzen die Ehre Gottes und die religiösen Gefühle der Gläubigen. "Der Glaube, der selbst für den Gebrauch des Namens Gottes solche Sorge trägt, erwartet, daß dies auch in der außerkirchlichen Öffentlichkeit respektiert wird. Der Andersdenkende soll Toleranz walten lassen vor einem Menschen, der Gott verehrt und seinen Namen hochhält, denn Gotteslästerung, auch in ihren sublimen Formen, verletzt die Würde und Freiheit glaubender Mitmenschen" (Grundwerte und Gottes Gebot, 18).
Damit der Name Gottes auch von anderen Menschen respektiert wird, genügt es nicht, sich auf die Verfassung des Staates zu berufen, sondern ist es erforderlich, daß die Glaubenden selbst nicht durch gedankenloses, leichtfertiges und respektloses Reden über Gott Anlaß dazu geben, seinen Namen zu mißbrauchen. Manche Kraftwörter oder Flüche sind sicher nicht ganz ernst gemeint, aber sie zeigen zumindest Gedankenlosigkeit und Mangel an Ehrfurcht.
5.2. Mißbrauch von Macht "im Namen Gottes"
Die schlimmste Weise, den Namen Gottes zu verunehren und seinen Namen zu mißbrauchen, ist die Anwendung von ungerechter Gewalt "im Namen Gottes". In seinem Namen ist in der Geschichte Schreckliches geschehen. Auch in der Kirche ist man im Lauf der Geschichte öfters der Versuchung der Macht erlegen. So liegt bis in unsere Zeit, in der die Kirche mit großem Nachdruck die Gewährleistung der Menschenrechte einklagt, eine schwere Hypothek der Vergangenheit auf der Kirche mit den Vorgängen, die mit der Inquisition in Zusammenhang stehen.
Die Inquisition ist die am meisten mißverstandene, aber auch die am meisten mißbrauchte Institution. Ihr ursprünglicher Sinn bestand darin, die Einheit des Glaubens vor der ernsthaften Bedrohung durch glaubensfremde, schwärmerische und umstürzlerische Bewegungen zu bewahren, die im Mittelalter, wie etwa bei den Katharern, zur Gründung von Neben- und Gegenkirchen führten. 1184 kam es, entsprechend dem damaligen Verständnis von geistlicher und weltlicher Obrigkeit, zwischen Papst Lucius III. und Kaiser Friedrich I. (Barbarossa) zu einer Vereinbarung über die Verfolgung von Häretikern. Der kirchlichen Obrigkeit kam die Aufgabe zu, vermutete Straftaten (Ketzerei) auszuforschen und zu verurteilen (inquisitio), während die weltliche Obrigkeit für die Vollstreckung des Urteils zu sorgen hatte. Die weltliche Obrigkeit, die sich als Schutzherrin der Kirche verstand und die Auflehnung gegen die christliche Religion als Bedrohung der christlichen Gesellschaft (res publica christiana) ansah, war an der Verfolgung der Häretiker in hohem Maße interessiert und drängte in der Folgezeit auf einen Ausbau der Inquisition. Bedeutende Theologen wie Thomas von Aquin (1225-1274) lieferten die theologische Rechtfertigung für die Verfolgung und Hinrichtung von hartnäckigen Häretikern (vgl. S. th. II II q. 11, art. 3).
Die Inquisition ist in der Folgezeit von den verschiedenen zuständigen Institutionen in den einzelnen Ländern in sehr unterschiedlicher Weise durchgeführt worden. Neben fanatischen Verfechtern gab es auch scharfe Gegner des Mißbrauchs der Inquisition, besonders bei der späteren Hexenverfolgung (Friedrich Spee) vom 15. bis 18. Jahrhundert.
Die Tragik der Inquisition besteht darin, daß dem damaligen Denken noch die Begründung der heute als selbstverständlich empfundenen Toleranz fehlte, daß ferner die ursprünglichen Anliegen einer ordentlichen rechtlichen Instanz im Sog von Exzessen und Massenwahn verfälscht und mißbraucht wurden und daß sich schließlich die Bemühungen von Kräften, die sich - wie die Inquisition in Spanien - gegen den Hexenwahn stellten, nicht genügend durchsetzen konnten. Mit der Abschaffung der Inquisition (in Portugal erst 1821 und in Spanien erst 1834) ist ein Kapitel beendet, das der Kirche bis heute als Mißbrauch von Macht im Namen Gottes vorgeworfen wird.
Auch eine historisch differenzierte und sachliche Bewertung der Vergangenheit kann unsere Betroffenheit über den Mißbrauch von Macht, an dem bei der Hexenverfolgung Katholiken wie Protestanten gleichermaßen teilhatten, nicht auslöschen. Aus einer vertieften Sicht hat Papst Pius XII. im Jahr 1955 in einer Ansprache vor Historikern den Blick für das Verhältnis von Kirche und Welt, von Glaube und Wissen klargestellt und entsprechende Kriterien vorgetragen (vgl. AAS XLVII, 1955, 672-682). Darüber hinaus hat Papst Johannes Paul II. mit der Rehabilitierung von Galilei einen großen Schritt zur Aufarbeitung der Vergangenheit getan.
Auch heute lebende Menschen haben zuweilen den Mißbrauch der Macht sehr empfindlich erlebt: Mißbrauch der Macht kann sein, wenn dem Gläubigen im Beichtstuhl oder in der Predigt in einer Weise, die mit dem Evangelium nicht vereinbar ist, mit dem Gericht gedroht wird. Es ist auch geschehen, daß in unverhältnismäßiger Weise kirchliche Regelungen absolut gesetzt und die konkrete Situation des einzelnen nicht gesehen wurde oder Menschen in ihrem Konflikt und in ihrer Verantwortung nicht ernst genommen wurden und harte Worte des Beichtvaters über sich ergehen lassen mußten. Solche Handlungen und verständnislose Worte sind Beispiele von Mißbrauch des Namens Gottes durch Amtsträger der Kirche, welche die Kirche heute bedauert und für die sie sich entschuldigt.
Mißbrauch von Macht im Namen Gottes war es in grauenhafter Weise, wenn Diktatoren unserer Zeit unter Berufung auf den "Allmächtigen" fremde Völker überfielen, Millionen von Menschen vernichteten, in Gefangenenlagern verhungern oder in Gefängnissen foltern ließen.
Wo immer unter Berufung auf Gott oder die göttliche Ordnung Willkür und Gewalttätigkeit geschieht, durch welche die menschliche Würde verletzt wird, treiben Menschen Mißbrauch mit dem Namen Gottes.
Kaum ein Wort der Menschensprache ist so mißbraucht, so befleckt, so geschändet worden wie das Wort "Gott". Martin Buber schreibt in seinen "Schriften zur Philosophie": "Ja, es ist das beladenste aller Menschenworte. Keines ist so besudelt, so zerfetzt worden. Gerade deshalb darf ich nicht darauf verzichten. Die Geschlechter der Menschen haben die Last ihres geängstigten Lebens auf dieses Wort gewälzt und es zu Boden gedrückt; es liegt im Staub und trägt ihrer aller Last. Die Geschlechter der Menschen mit ihren Religionsparteiungen haben das Wort zerrissen; sie haben dafür getötet und sind dafür gestorben; es trägt ihrer aller Fingerspur und ihrer aller Blut. Wo fände ich ein Wort, das ihm gliche, um das Höchste zu bezeichnen. Wir können das Wort ,Gott` nicht reinwaschen, und wir können es nicht ganzmachen; aber wir können es, befleckt und zerfetzt wie es ist, vom Boden erheben und aufrichten über eine Stunde großer Sorge" (Werke, 1. Bd., München 1962, 509 f).
Die Geschichte des Mißbrauchs des Namens Gottes ist für uns alle Mahnung und Anruf, den Namen "Gott" nur in tiefer Ehrfurcht auszusprechen und Gott durch unser Tun in der Welt zu ehren. Gott, der sich uns in Jesus Christus geoffenbart hat, würdigt uns, daß wir den Namen "Christen" tragen. Indem wir uns dessen würdig erweisen, ehren wir Gott.
III. Drittes Gebot: Gedenke, daß du den Sabbat heiligst
Ich bin dein Gott, der dir Leben und Zukunft schenkt
. . . Gedenke, daß du den Sabbat heiligst
Gott will, daß wir in der Anbetung und im Ausruhen ihm und seiner Schöpfung nahe sind.
1. Der Sabbat als Geschenk Gottes an das Volk des Alten Bundes
1.1. Der Wortlaut des Gebotes
Das Sabbatgebot ist in mehreren Fassungen überliefert, die sich gegenseitig ergänzen:
- "Sechs Tage kannst du deine Arbeit verrichten; am siebten Tag aber sollst du ruhen, damit dein Rind und dein Esel ausruhen und der Sohn deiner Sklavin und der Fremde zu Atem kommen" (Ex 23,12).
- "Gedenke des Sabbats: Halte ihn heilig! Sechs Tage darfst du schaffen und jede Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun: du, dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin, dein Vieh und der Fremde, der in deinen Stadtbereichen Wohnrecht hat. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel, Erde und Meer gemacht und alles, was dazugehört; am siebten Tage ruhte er. Darum hat der Herr den Sabbat gesegnet und ihn für heilig erklärt" (Ex 20,8-11).
- "Achte auf den Sabbat: Halte ihn heilig, wie es dir der Herr, dein Gott, zur Pflicht gemacht hat. Sechs Tage darfst du schaffen und jede Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht . . . Denk daran: Als du in Ägypten Sklave warst, hat dich der Herr, dein Gott, mit starker Hand und hoch erhobenem Arm dort herausgeführt. Darum hat es dir der Herr, dein Gott, zur Pflicht gemacht, den Sabbat zu halten" (Dtn 5,12-15).
1.2. Der Sabbat als Innehalten in der Arbeit
Das Wort "Sabbat" steht in enger Beziehung zum Wort "aufhören" oder "innehalten". Den Sabbat halten heißt: innehalten. Der Mensch muß innehalten, um die Wirklichkeit des Lebens tiefer wahrzunehmen. Zum Menschsein gehören Ruhe, Erholung, Muße und Zeit zur Besinnung. Das Leben ist nicht nur Arbeit. Der Mensch geht nicht in der Arbeit auf; er muß sich Ruhe und Zeit gönnen und darf sich über das Ergebnis seiner Arbeit freuen.
Die alle sieben Tage vollzogene Sabbatruhe war im damaligen Raum eine Besonderheit Israels. Sie fiel in ihrem zeitlichen Ablauf nicht mit den Mondphasen zusammen, die für die orientalischen Religionen von Bedeutung waren. Auch später blieb die jüdische Gewohnheit, den Sabbat zu halten, für die anderen Völker, mit denen Juden in der Diaspora zusammenlebten, unverständlich. Diese Weisung hat eine wichtige soziale Bedeutung. Die Schrift mahnt zur Arbeitsruhe am siebten Tag, "damit dein Rind und dein Esel ausruhen und der Sohn deiner Sklavin und der Fremde zu Atem kommen" (Ex 23,12). Hier werden die Tiere genannt und besonders solche Menschen, die leicht der Willkür und der Ausbeutung ausgesetzt sind. Der Sabbat als Ruhetag ist gerade für die Schutzlosen, die Wehrlosen und die Abhängigen da. Das Gebot ist gewissermaßen ein Arbeitsschutzgesetz. Es betont in der Weisung zur Arbeitsruhe die Gleichstellung aller Menschen vor Gott und erkennt ihnen elementare Schutzrechte zu (vgl. Ex 20,10; Dtn 5,14). Die Propheten mahnen, den Sinn des Ruhetages zu erkennen und ihn nicht zu einem Tag der Geschäfte, der Geschäftigkeit und der Arbeit zu machen (vgl. Am 8,5; Jes 1,13; Hos 2,12ff; Neh 13,15ff).
1.3. Der Sabbat als Zeichen des Bundes
Zeiten der Ruhe und Erholung gab es auch bei anderen Völkern. Doch in Israel wurde der Sabbat aus dem Glauben begründet. Die Feier des Sabbats ist Zeichen des Bundes zwischen Gott und seinem Volk:
- "Der Herr sprach zu Mose: Sag den Israeliten: Ihr sollt meine Sabbate halten; denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch von Generation zu Generation, damit man erkennt, daß ich, der Herr, es bin, der euch heiligt. Darum haltet den Sabbat; denn er soll euch heilig sein . . . Sechs Tage soll man arbeiten; der siebte Tag ist der Sabbat, Ruhetag, heilig für den Herrn . . . Die Israeliten sollen also den Sabbat halten, indem sie ihn von Generation zu Generation als einen ewigen Bund halten. Für alle Zeiten wird er ein Zeichen zwischen mir und den Israeliten sein. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht; am siebten Tage ruhte er und atmete auf" (Ex 31,12-17; vgl. Ez 20,12).
Im Bund mit Gott wird für das Bundesvolk der Sabbat religiös begründet; er wird zu einem Tag, der Gott geweiht ist und deshalb heilig gehalten werden soll.
1.4. Der Sabbat als Hinweis auf die Schöpfung und den Schöpfer
Gott hat am Anfang die Welt erschaffen und ihr eine Ordnung gegeben, die dem Menschen vorgegeben ist: die Ordnung des Arbeitens und des Ausruhens. Gott grenzt aus der Siebenerreihe der Tage einen Tag aus, an dem er ruht und an dem auch der Mensch in der Arbeit innehalten, ausruhen und anschauen darf, was er gemacht hat. Der Mensch geht nicht in der Arbeit auf, sondern er steht über ihr. Er ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und nimmt teil an Gottes Wirken und Ausruhen. Am siebten Tag auszuruhen, ihn im Ablauf des normalen Lebens zu einer besonderen Zeit der Erholung von der Arbeit zu machen und ihn durch Ruhe zu heiligen bedeutet, ihn einzubeziehen in den Bereich der Heiligkeit Gottes. Der Sabbat erinnert an die Ruhe des Schöpfers am siebten Tag (Gen 2,2-3). Doch ist er nicht ein Tag des leeren Dahinlebens und des Nichtstuns; er ist ein Tag der Hinwendung zu Gott, dem Herrn der Geschichte, dem Schöpfer der Welt und Urheber des eigenen Lebens. Der Mensch muß nicht in ängstliche Sorge und Hast verfallen. Er darf im Ausruhen und Erholen darauf vertrauen, daß die Schöpfung Gottes und in ihr der Mensch immer in Gottes Händen ist. Nicht der Mensch, sondern Gott selber vollendet das Werk der Schöpfung. Durch das Ruhen am Sabbat heiligt der Mensch diesen Tag und gibt Gott die ihm gebührende Ehre.
1.5. Der Sabbat als Erinnerung an die Befreiung
Die Pflicht, den Sabbat heilig zu halten, wird mit der Freiheitstat Gottes am Anfang der Geschichte Israels begründet: "Denk daran: Als du in Ägypten Sklave warst, hat dich der Herr, dein Gott, mit starker Hand und hoch erhobenem Arm dort herausgeführt. Darum hat es dir der Herr, dein Gott, zur Pflicht gemacht, den Sabbat zu halten" (Dtn 5,15). Daher ist jeder Sabbat ein Fest der Freiheit. Indem das Volk den Sabbat hält, erweist es, daß es mit dem Gott der Befreiung im Bund geeint ist.
Das feiernde Gedenken der Befreiung hat auch soziale Konsequenzen. Indem sich Israel daran erinnert, daß es selber einmal Sklave war und in seinem Sklavendasein Gottes Nähe erfahren hat, wird es sich seiner Verantwortung für die Fremden und die Sklaven im eigenen Lebensbereich bewußt. Alle sollen teilhaben an der Sabbatruhe. In der Erinnerung an die Befreiung feiert der Mensch den befreienden Gott. So hat der Sabbat von Anfang an den Grundcharakter der Freude und des Feierns (vgl. Hos 2,13; Jes 1,13).
1.6. Der Sabbat als Zeichen der Erneuerung des Bundes und der kommenden Herrlichkeit
In der Zeit des babylonischen Exils, in der die gläubigen Israeliten nicht mehr die räumliche Nähe Gottes im Tempel suchen konnten, gewann der Sabbat eine eigene Bedeutung. Er wurde hier zum Zeichen der lebendigen Identität des Volkes im Bund mit seinem Gott. Zeichen war der Sabbat gerade deswegen, weil das äußere Innehalten, oft gegen den Widerstand der Umgebung, Zeichen der inneren Erneuerung des Bundes war.
Im Exil war es nicht möglich, den Sabbat in der Öffentlichkeit zu feiern. Doch lebte er fort in den Familien. Durch die Jahrhunderte blieb diese Feier das Erkennungszeichen der Juden. Selbst dort noch, wo ihm nicht mehr lebendiger Glaube entsprach, erhielt sich dieses Zeichen und trug dazu bei, daß über die Zeiten der Zerstreuung und Verfolgung hinweg die Identität des Volkes erhalten blieb. Die Juden haben die Sabbatfeier bis auf den heutigen Tag nie aufgegeben und sind im Unterschied zu anderen Völkern in der Zerstreuung nicht in andere völkische Verbindungen hinein aufgelöst worden, sondern bis heute sie selbst geblieben. Für sie sind die Riten der Sabbatfeier wie auch der Paschafeier immer wieder Anlaß, sich an den alten Glauben der Väter zu erinnern und zugleich den Glauben stets neu lebendig werden zu lassen.
Für das alttestamentliche Gottesvolk ist der Sabbat aber nicht nur ein Tag des dankbaren Gedenkens der Befreiung am Anfang seiner Geschichte mit Gott und der Erinnerung an die Ordnung der Schöpfung; er ist darüber hinaus ein Tag der Erwartung, der Hoffnung und der Zuversicht. Er ist Symbol jener kommenden Herrlichkeit, in der Gott alle Tränen abwischen wird, wo kein Tod und keine Trauer mehr sein werden und wo endgültige Befreiung, volle Freude und bleibendes Heil geschenkt werden. Diese Erwartung begründet im Neuen Testament den Ausblick auf die noch ausstehende "Sabbatruhe", die dem Volk Gottes noch "vorbehalten ist" (Hebr 4,9).
Als Unterpfand der künftigen Herrlichkeit ist der Sabbat für das jüdische Volk in dieser Weltzeit Verpflichtung und Mahnung.
Das Gebot, den Sabbat zu heiligen und zu achten, nimmt unter den Zehn Geboten im Alten Testament den breitesten Raum ein (vgl. Ex 20,8-11; Dtn 5,12-15). Trotz mancher Fehlentwicklungen durch Vergesetzlichung in den späten Phasen des Alten Testamentes hat das Sabbatgebot für die gläubigen Juden seine Aktualität bis auf den heutigen Tag erhalten.
2. Der christliche Sonntag als Geschenk Gottes an das Volk des Neuen Bundes
2.1. Der Sonntag als "Herrentag"
Der christliche Sonntag hat eine enge Beziehung zum alttestamentlichen Sabbat, aber er ist nicht mit ihm gleichbedeutend. In der neutestamentlichen Heilsordnung entsteht der Sonntag neben dem Sabbat. Der entscheidende Grund für die Feier des Sonntags ist die Auferstehung Jesu Christi. Mit ihr kommt etwas unerhört Neues in die Welt: die Befreiung von Sünde und Tod und der Anfang der Neuschöpfung als Werk des auferstandenen Herrn. Der erste Tag der Woche als Tag der Auferstehung Christi wird zum Tag der Feier des Neuen Bundes in Christus.
Ist der Sonntag der erste Tag der Woche, dann ist er der Wochenanfang; ist der Montag der erste Tag der Woche, dann ist der Sonntag das Wochenende. Letztere Zählung geht auf eine gesellschaftlich-politische Entscheidung zurück, mit der man den Anforderungen der modernen Arbeitswelt gerecht werden wollte. Allerdings muß das Verständnis des Sonntags als Wochenende gegenüber dem Sonntag als dem ersten Tag der Woche nicht als eine bloß verweltlichte Deutung verstanden werden. Denn die Einheit der Feier der Großen Woche (Karwoche) erlebt den Ostersonntag durchaus auch als einen Endpunkt, und diese Sicht hat ebenfalls den wöchentlichen Ostertag (Sonntag) geprägt.
Auch der "achte Tag" ist ein Name für den Sonntag neben dem Sonntag als "Herrentag". Deshalb hat das Zweite Vatikanische Konzil den "achten Tag" als Sonntagsnamen wieder aus der Vergessenheit herausgeholt, indem es sagt: "Aus apostolischer Überlieferung . . . feiert die Kirche Christi das Pascha-Mysterium jeweils am achten Tage, der deshalb mit Recht Tag des Herrn oder Herrentag genannt wird" (SC 106).
In Erinnerung an dieses Heilsereignis des Neuen Bundes versammelten sich die Christen seit der Zeit der Apostel am ersten Tag der Woche, um den Tod und die Auferstehung Jesu Christi zu feiern. Dieser Tag war der Tag des Gedenkens und des Dankens. Davon berichtet schon die Apostelgeschichte: "Als wir am ersten Wochentag versammelt waren, um das Brot zu brechen, redete Paulus zu ihnen . . ." (Apg 20,7). Ein Zweifaches wird hier deutlich: die Zusammenkunft am ersten Tag der Woche und die Feier des "Brotbrechens", das heißt der Eucharistie. Der Sonntag entsteht somit als etwas, das vom Sabbat verschieden ist. So erhält der erste Tag auch einen neuen Namen: "Herrentag". Dieser Name kommt bereits im Neuen Testament vor (Offb 1,10).
Im romanischen Sprachbereich ist der Name "Herrentag" bis heute der Name für den Sonntag geblieben (lateinisch: dies dominica, italienisch: domenica, französisch: dimanche). Die germanischen Sprachen haben diese Umbenennung nicht vollzogen. Sie haben für alle Tage der Woche die Benennung behalten, die ihnen nach bestimmten Gestirnen oder Gestirngöttern zugeschrieben worden sind. Der Tag der Sonne erfuhr eine christliche Umdeutung. In Christus war den Christen die "Sonne der Gerechtigkeit" aufgegangen; theologisch könnte man von Christus als Sonne der neuen Welt sprechen, die einmal den ganzen Kosmos in das neue Licht österlicher Verklärung tauchen wird.
Sonntag - Herrentag - meint zunächst nicht, daß der Mensch an diesem Tag etwas für Gott tun müßte; er besagt vielmehr, daß der erhöhte Herr sich der feiernden Gemeinde in besonderer Weise zuwendet. Am Sonntag feiern die Glaubenden das Geschenk ihrer Erlösung und Neuschöpfung.
Der heilige Augustinus schreibt über den siebten oder letzten Tag der Welt: "Sein Ende wird kein Abend sein, sondern der Herrentag als achter ewiger Tag, der durch Christi Auferstehung geheiligt ist, die nicht nur die ewige Ruhe des Geistes, sondern auch des Leibes vorausgebildet hat. Da werden wir feiern und schauen, schauen und lieben, lieben und preisen. Sieh, das wird das Endziel ohne Ende sein, denn was anderes ist unser Ziel, als zu dem Reiche hinzugelangen, das kein Ende hat" (Vom Gottesstaat, 22,30).
Die Christen waren von früher Zeit an der Überzeugung, daß man ohne Sonntag nicht leben könne (vgl. Ignatius von Antiochien, Brief an die Magnesier 1 f), denn der Sonntag gebe der ganzen Woche und dem Leben aus dem Glauben Richtung und Maß. In einer frühen christlichen Schrift um 100 heißt es: "Am Herrentag des Herrn aber versammelt euch, brecht das Brot und feiert die Eucharistie, nachdem ihr zuvor eure Sünden bekannt habt, damit euer Opfer rein sei. Es soll aber keiner, der mit seinem Nächsten Streit hat, sich mit euch versammeln, bis sie sich ausgesöhnt haben, damit euer Opfer nicht entweiht werde" (Didach‚ 14,12).
Ein schönes Zeugnis dafür, wie wichtig den Christen der ersten Jahrhunderte die gottesdienstliche Versammlung gewesen ist, liegt uns aus dem beginnenden 4. Jahrhundert vor. Im Februar des Jahres 303 hatte Kaiser Diokletian befohlen, alle gottesdienstlichen Räume zu zerstören und alle gottesdienstlichen Versammlungen zu verhindern. Zu den Gebieten, in denen das Edikt besonders grausam durchgeführt wurde, gehörte Nordafrika. In Karthago stehen am 12. Februar 304 neunundvierzig namentlich aufgeführte Christen mit ihrem Priester vor Gericht, einunddreißig Männer und achtzehn Frauen. Sie sind in Abitinae, einem kleinen Ort bei Karthago, verhaftet worden, während sie an einem Sonntag zur Feier des Gottesdienstes versammelt waren. Der Prozeß endete mit der Hinrichtung aller neunundvierzig Christen. Die "Akten der heiligen Saturinus, Dativus und vieler anderer Märtyrer in Africa" berichten über zwei Verhöre folgendes:
Als nämlich der Prokonsul sagte: "Du hast gegen die Verordnung der kaiserlichen Gebieter gehandelt, um alle diese (Leute) zu versammeln", da antwortete der Presbyter Saturinus auf Eingabe des Geistes des Herrn: "Wir haben unbekümmert (darum) das Herrenmahl gefeiert." Der Prokonsul fragte: "Warum?" Er antwortete: "Weil das Herrenmahl nicht unterbleiben kann . . ." Als aber Emeritus herangeführt worden war, sprach der Prokonsul: "Sind in deinem Haus, entgegen den Verordnungen der Gebieter, Versammlungen abgehalten worden?" Emeritus, erfüllt mit dem heiligen Geist, erwiderte ihm: "Wir haben in meinem Haus das Herrenmahl gefeiert." Darauf sagte jener: "Warum hast du jenen den Zutritt erlaubt?" Er antwortete: "Weil sie meine Brüder sind; ich habe es ihnen nicht verwehren können." - "Aber du hattest die Pflicht, es ihnen zu verwehren." Darauf er: "Ich habe es nicht gekonnt, da wir ohne das Herrenmahl nicht (sein) können" (Acta SS. Saturini, Dativi et aliorum plurimorum martyrum in Africa, 9-11).
Die Christen wußten sich damals verpflichtet, den Tag des Herrn zu feiern, auch wenn dieser Tag kein Tag der Arbeitsruhe war. Zwar herrschten nicht überall ideale Zustände, aber nicht selten nahmen Christen in der Verfolgung für die Teilnahme am Herrenmahl sogar das Martyrium auf sich. Erst äußere politische Veränderungen haben dazu geführt, daß der Tag des Herrn auch als der Tag der Arbeitsruhe eingeführt wurde. Von Kaiser Konstantin wurde im Jahr 321 der Sonntag zum offiziellen Feiertag des Reiches erhoben.
Die Sabbatruhe des Alten Bundes wird im Neuen Bund in den christlichen Sonntag übernommen. Dieser wird durch den christlichen Gottesdienst ausgezeichnet.
Das Verständnis des Sonntags und seine kirchenrechtliche Regelung hat in der Geschichte viele Stationen durchlaufen. Eine Zusammenfassung der Sinngebung des Sonntags bietet heute die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils:
- "Aus apostolischer Überlieferung, die ihren Ursprung auf den Auferstehungstag Christi zurückführt, feiert die Kirche das Pascha-Mysterium jeweils am achten Tag, der deshalb mit Recht Tag des Herrn oder Herrentag genannt wird. An diesem Tag müssen die Christen zusammenkommen, um das Wort Gottes zu hören, an der Eucharistiefeier teilzunehmen und so des Leidens, der Auferstehung und der Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus zu gedenken und Gott dankzusagen, der sie ,wiedergeboren hat zu lebendiger Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten` (1 Petr 1,3). Deshalb ist der Herrentag der Ur-Feiertag, den man der Frömmigkeit der Gläubigen eindringlich vor Augen stellen soll, auf daß er auch ein Tag der Freude und der Muße werde. Andere Feiern sollen ihm nicht vorgezogen werden, wenn sie nicht wirklich von höchster Bedeutung sind; denn der Sonntag ist Fundament und Kern des ganzen liturgischen Jahres" (SC 106).
2.2. Der Sonntag als Tag der Gemeinschaft der Gläubigen
Der Sonntag ist für die frühen Christen "Tag des Herrn", und er ist zugleich "Tag der Gemeinde". Die Gemeinschaft der Glaubenden als Kirche Jesu Christi existiert als sichtbare Wirklichkeit. Deshalb kommen die Gemeinden zusammen, um in der Eucharistie Gottes Erbarmen zu feiern, das er in Tod und Auferstehung Jesu Christi schenkt. So bezeugen sie gemeinsam den Glauben, bestärken einander im Glauben und treten stellvertretend für die vielen vor Gott hin. Ihr Zusammenkommen ist ein sichtbares Zeichen ihres Glaubens. Für eine Gemeinde ist dies lebensnotwendig.
Die Mahnungen des Apostels an die Gemeinde in Korinth (vgl. 1 Kor 10-14) zeigen aber auch, daß das kostbare Gut der Einheit mancherlei Anfechtungen und Bedrohungen ausgesetzt war. Es wurden soziale Unterschiede deutlich; einige sahen auf andere herab oder drängten sich vor. Paulus ruft dazu auf, daß jeder, der am Gottesdienst teilnimmt, seine Begabung einbringt. Das alles dient dem Aufbau der Gemeinde aber nur, wenn es aus Liebe zu Christus und aus Liebe zueinander geschieht. Glaubenserfahrungen, geistliches Leben und geistliche Gnadengaben, die einzelnen geschenkt sind, sollen in den Gottesdienst eingebracht werden und den Glauben der Gemeinde mittragen. In der Verantwortung der Gemeinde für den Glauben der Gesamtkirche wissen sich die ersten Christen verpflichtet, am Gottesdienst der Gemeinde teilzunehmen.
Die Versammlungen der Gläubigen hatten, wie manche Briefe des Neuen Testamentes zeigen, nicht ausschließlich liturgischen Charakter. Man feierte in der Eucharistie die Vergegenwärtigung des Herrn, von der her die Gemeinden auch ihren Dienst an den notleidenden Brüdern und Schwestern wahrnahmen (vgl. 1 Kor 16,1f). So wirkt sich der gemeinsame Glaube, der im Zusammenkommen der Gemeinde gefeiert wird, auch auf das konkrete Miteinander der Gläubigen, auf das Einstehen füreinander und auf die Sorge umeinander aus. Wie Jesus nach dem Mahl seinen Jüngern in der Fußwaschung ein Beispiel seiner Liebe gegeben hat (vgl. Joh 13,1-20), so soll die Erfüllung des neuen Gebotes der Bruderliebe (Joh 13,34f) im tätigen Dienst füreinander das kennzeichnende Merkmal seiner Jünger sein.
3. Der Sonntag des Christen heute
3.1. Der Sonntag in der heutigen Gesellschaft
In der heutigen Gesellschaft hat der Sonntag im Vergleich zu früheren Zeiten einen anderen Stellenwert erhalten. Für den größten Teil der Menschen ist er in unserer modernen Industriegesellschaft nicht mehr der Feiertag, der aus dem Ablauf der Woche herausragt, sondern er ist ein Teil des verlängerten Wochenendes. Dieses beginnt für viele bereits mit dem Freitagnachmittag und endet am Sonntagabend oder schon früher. Demzufolge spricht man davon, daß an die Stelle der früheren Sonntagskultur eine Wochenendkultur getreten sei.
Untersuchungen über das Verhalten der Menschen, die am Wochenende von beruflicher Arbeit befreit sind, deuten darauf hin, daß sich in letzter Zeit ein ausgeprägter Lebensstil des Wochenendes zu entwickeln beginnt. Für einen großen Teil der Gesellschaft hat das Wochenende mehrere Sinndimensionen:
- Es befreit den Menschen aus den Sachzwängen der täglichen Arbeit und erlaubt ihm die persönliche Verfügung über seine freie Zeit.
- Es bietet dem Menschen über die anfallenden privaten Arbeiten hinaus eine Zeit des Ausruhens, der Muße, der Besinnung und der Möglichkeit zur Mitfeier des Gottesdienstes.
- Es eröffnet die Möglichkeit zur Teilnahme an Veranstaltungen, Bildungskursen, Treffen und Begegnungen mit Verwandten und Freunden sowie zur Aufnahme und Pflege sozialer Kontakte.
- Es vermittelt im Wechsel von Arbeitszeit und Freizeit für viele das Bewußtsein einer gemeinschaftlichen Lebensordnung.
- Es gibt Spielraum für die Familie, der man sich jetzt mehr zuwenden kann als während der Arbeitstage der Woche.
So ist das Wochenende jener Freiraum, auf den sich die Menschen Woche für Woche freuen. Das freie Wochenende ist ein großer Gewinn. Es sollte möglichst nicht durch wirtschaftliche oder sonstige Interessen durchbrochen oder ausgehöhlt werden. Um des einzelnen, der Familie und der Gesamtgesellschaft willen müssen alle Gruppen und Verbände, einschließlich der Kirchen, daran interessiert sein, das Wochenende wenn möglich als Freizeit zu erhalten. Insbesondere haben Industrie, Tourismus- und Dienstleistungsbetriebe sowie die Landwirtschaft die Verpflichtung, daran mitzuwirken, daß der Sonntag erhalten bleibt.
Allerdings können die positiven Seiten des Wochenendes nicht darüber hinwegtäuschen, daß es Faktoren gibt, die dazu beitragen, daß seine Möglichkeiten weder für alle noch von allen Menschen in angemessener Weise verwirklicht werden.
Erstens kommen in der arbeitsteiligen Gesellschaft des Industriezeitalters bestimmte Berufsgruppen nur selten in den Genuß des freien Wochenendes. Für berufstätige Mütter, Angestellte im Dienstleistungsgewerbe, Pflegepersonal in Heimen und Krankenhäusern ist gerade das Wochenende äußerst arbeitsintensiv. Wer in den Prozeß der Schichtarbeit oder der gleitenden Arbeitswoche eingespannt ist, hat seine freie Zeit oftmals am Anfang oder in der Mitte der Woche. Für viele, die bereits am Sonntag wieder zu entfernten Arbeits- und Ausbildungsstätten reisen müssen, ist der Sonntag nur zur Hälfte ein Tag der Erholung und Entspannung. Diejenigen, die als Arbeitslose zur totalen Freizeit verurteilt sind, erfahren das Wochenende nicht als Freizeit, sondern als eine weitere leere Zeit. Für wieder andere schließlich, wie etwa für Geschiedene oder vom Partner Verlassene, für Alleinstehende und oftmals auch für alte und kranke Menschen, kann gerade das Wochenende eine Zeit schmerzlicher Erfahrung von Trennung, Alleinsein und Einsamkeit sein.
Zweitens ist nicht zu übersehen, daß viele Menschen die freie Zeit nicht als positive Möglichkeit des Ausruhens, der Muße und der Besinnung ergreifen, sondern den Alltag einfach im Wochenende so fortsetzen, daß in der privaten Arbeit alles so weitergeht wie in der Arbeitswoche. Andere leben so sehr in den Alltagsgewohnheiten, daß sie mit der freien Zeit nichts anzufangen wissen und froh sind, wenn das Wochenende wieder vorbei ist. Wieder andere schließlich geraten im kommerziellen Überangebot der Freizeitgestaltung in die Gefahr, aus den Alltagszwängen in Wochenendzwänge zu fallen, in denen die freie Zeit ganz von Hektik, Streß und Anstrengung aller Art ausgefüllt ist.
Drittens trägt in der pluralistischen Gesellschaft auch das Schwinden des Glaubens und der Lebensgestaltung aus dem Glauben wesentlich dazu bei, daß das freie Wochenende vorwiegend von einer verweltlichten Wochenendkultur geprägt ist. Rein innerweltliche Einstellungen und Lebensgewohnheiten wirken sich mehr und mehr auch auf das Verhalten von Christen aus. Viele denken weniger an den Sonntag und an seine christliche Sinngebung als vielmehr an die Verplanung eines Wochenendes, in dem das Christliche ganz an den Rand gedrängt oder gar nicht in die Überlegung einbezogen ist. Für nicht wenige ist die Heiligung des Sonntags in der Feier der Eucharistie kaum mehr als ein lästiges Gebot, an das sie sich wenig gebunden wissen. Viele besuchen den sonntäglichen Gottesdienst nur, wenn sie "Zeit oder Lust" dazu haben.
3.2. Der Sonntag als Feiertag
Trotz vieler negativer Tendenzen besteht die Möglichkeit, den Sonntag zu feiern. Hier kann ein wirkliches Gegengewicht gegen die Zwänge geschaffen werden, die in der Arbeitswoche das Leben bestimmen. Es kommt darauf an, diese Chance zu ergreifen.
- "In seiner täglichen Arbeit verwirklicht der Mensch den Auftrag des Schöpfers, erwirbt seinen Lebensunterhalt und gestaltet die Welt. Um sich jedoch immer wieder seiner Würde als Mensch und Christ bewußt zu werden, setzt er in der Feier des Sonntags die werktägliche Arbeit aus und begegnet so wirksam der Gefahr, daß ihn die Arbeitswelt ihren Zwecken unterwirft, ihn versklavt und isoliert. Deshalb treten die Christen für den Sonntag als Tag der Feier und Ruhe ein; er ist wichtig nicht nur für ihre Gemeinde, sondern für die gesamte Gesellschaft" (Gemeinsame Synode, Beschluß: Gottesdienst 2.2.).
Dieser Sinngebung des Sonntags, in welcher es nicht nur um das persönliche Ausspannen und um die Erholung des einzelnen geht, sondern um das Innehalten und um die Ruhe der Gemeinschaft und Gesellschaft, entspricht auch in vielen Ländern die staatliche Gesetzgebung, die an Sonn- und Feiertagen bestimmte Arbeiten verbietet.
Der Sinn des Sonntags als Feiertag liegt darin, daß sich der Mensch ausruht. Er ist auch ein Tag der Besinnung über den verantwortlichen Umgang mit allem, was uns als Gottes Schöpfung anvertraut ist.
- "Spiel und Sport, Gespräch und Erholung, die Natur erleben und bewundern, sich kümmern um andere - das alles öffnet unseren Blick für Dank und Feier. Es kann uns nur ahnen lassen, daß es mehr gibt als nur das Tun, das auf einen Zweck ausgerichtet ist. Zugleich macht es uns deutlich, daß unser Leben nicht aufgeht in dem, was wir leisten. Die Arbeit ist keineswegs gering zu achten. Aber sie ist bei weitem nicht alles" (Den Sonntag feiern. Gemeinsames Wort der Deutschen Bischofskonferenz und des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 1. 12. 1984, 2).
Für uns Christen ist die Feier des ganzen Sonntags Zeichen und Ausdruck unserer Gottesverehrung; er ist der Tag des Gedenkens, des Dankens und der Freude an Gottes Schöpfung und Neuschöpfung in Christus. Deshalb soll man am Sonntag nicht arbeiten, sondern ruhen, nicht bebauen, sondern bewahren; es soll Frieden sein unter den Menschen und Frieden mit der ganzen Kreatur. Dieser Frieden soll ausstrahlen auf unser Leben in der Arbeitswoche. Zum Glaubenszeugnis, das wir als Christen der Welt schulden, gehört deshalb, wie ernst wir das Ausruhen von der Arbeit nehmen. Zugleich kann das Innehalten am Sonntag unsere Aufmerksamkeit auf die vielen Menschen lenken, die am Sonntag keinen Ruhetag haben. "Ihre Überbeanspruchung sollte für den Christen eine Herausforderung bedeuten, die Last des anderen mitzutragen und durch eigenen Einsatz auch diesen Menschen einen freien Sonntag oder einige freie Stunden zu ermöglichen (zum Beispiel durch Übernahme von Sonntagsvertretungen, Betreuung von Kindern)" (Gemeinsame Synode, Beschluß: Gottesdienst 2.2.).
Der Sonntag als Tag der Ruhe kann auch in der modernen Industriegesellschaft ein wirklicher Feiertag sein. Als Christen sind wir dazu aufgerufen, den Sinn des Sonntags immer wieder neu zu entdecken und ihn in der Gesellschaft vorzuleben. Es hängt nicht zuletzt von uns ab, was der Sonntag auf die Dauer für die Menschen bedeutet. In der Feier des Sonntags geben wir Zeugnis von unserem Glauben und von unserer Hoffnung.
3.3. Die Feier des Glaubens im Gottesdienst der Kirche
In ihrem Gottesdienst und besonders in der Eucharistie bewahrt und bezeugt die Kirche die Fülle ihres Glaubens. Christus ruft die Gläubigen immer wieder zur Feier seines Gedächtnisses zusammen, um in ihrer Mitte gegenwärtig zu werden, sich ihnen zu schenken, sie im Glauben zu bestärken und sie in der Liebe zu einen. Die Gemeinde bringt in und mit Christus dem Vater Anbetung, Lob und Dank dar; sie feiert den Tod und die Auferstehung Christi; sie wird mit Christus im Mahl vereint und erwartet sein Kommen in Herrlichkeit.
Im Hochgebet der Eucharistie beten wir: "Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit."
Die Feier der Eucharistie ist der eigentliche Mittel- und Höhepunkt des Sonntags. Das verpflichtet zur Feier der Eucharistie. In ihr soll das Vermächtnis des Herrn "Tut dies zu meinem Gedächtnis" erfüllt werden.
"Brotbrechen", so nannten die ersten Christen das, was sie dann später Eucharistie (Danksagung) nannten. Dieses Brotbrechen war das, was Jesus immer wieder mit ihnen getan hat, vor seinem Tod, beim Letzten Abendmahl und dort, wo der auferstandene Christus sich den zwei Emmausjüngern gerade bei solchem Brotbrechen zu erkennen gibt (Lk 24,30-32). Diese Geschichte, die den nach Emmaus mitgehenden Dritten den beiden Jüngern als den auferstandenen Christus vorstellt, zeigt, wie wichtig bereits den Christen zur Zeit des Evangelisten Lukas die Eucharistiefeier war. Die Christen damals hatte die Frage bewegt, wie sie, die nicht unmittelbar Augen- und Ohrenzeugen Jesu gewesen waren, zum Glauben an seine Auferstehung kommen und in diesem Glauben bleiben konnten. Der Evangelist gibt mit seiner Erzählung von den beiden Emmausjüngern eine klare Antwort. In der Teilnahme am Brotbrechen, also in der Feier der Eucharistie, gibt Christus sich als der Auferstandene zu "erkennen".
Bis heute ist die Feier der Eucharistie Offenbarungsgeschehen und als solches zugleich jenes Ereignis, das den Glauben lebendig hält und damit auch die Gemeinschaft der Glaubenden (Kirche). Ohne Eucharistiefeier wäre die Kirche nicht Kirche. Die Feier der Eucharistie ist nicht verzichtbar oder austauschbar oder gar ersetzbar. Auch ein Gottesdienst, der nicht Eucharistiefeier ist, verwirklicht nicht die Fülle des Vermächtnisses Jesu Christi.
Die Verpflichtung zur Teilnahme an der Eucharistiefeier ruft die Kirche auch durch das Gebot der Sonntagsheiligung, die sogenannte Sonntagspflicht, ins Bewußtsein. Im Hebräerbrief heißt es: "Laßt uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern ermuntert einander, und das um so mehr, als ihr seht, daß der Tag naht" (10,25). Ähnlich mahnt eine frühchristliche Schrift, daß "niemand die Kirche durch sein Fernbleiben verkleinere und den Leib Christi eines Gliedes beraube" (Didascalia II, 19,1).
Die Bestimmung des heutigen kirchlichen Rechtsbuches (CIC) zum Sonntag als Feiertag lautet: "Der Sonntag, an dem das österliche Geheimnis gefeiert wird, ist aus apostolischer Tradition in der ganzen Kirche als der gebotene ursprüngliche Feiertag zu halten" (can. 1246).
Zur Teilnahme am Gottesdienst und zur Sonntagsruhe heißt es: "Am Sonntag und an den anderen gebotenen Feiertagen sind die Gläubigen zur Teilnahme an der Meßfeier verpflichtet; sie haben sich darüber hinaus jener Werke und Tätigkeiten zu enthalten, die den Gottesdienst, die dem Sonntag eigene Freude oder die Geist und Körper geschuldete Erholung hindern" (can. 1247).
Nicht wenige stoßen sich daran, daß die Teilnahme an der sonntäglichen Eucharistiefeier ein verpflichtendes Gebot ist, das die Kirche ihren Gläubigen vom siebten Lebensjahr an auferlegt. Doch darf man nicht übersehen, daß nicht das Gebot der Kirche die Verpflichtung begründet, sondern sie als dem Herrn geschuldete Gabe und Teilnahme am Opfer Christi einschärft.
Deshalb erklärt die Gemeinsame Synode in ihrem Beschluß "Gottesdienst":
- "Auch wenn es vielen widerstrebt, angesichts eines so einzigartigen Angebotes von ,Sonntagspflicht` zu sprechen, so ist es doch nach wie vor eine ernsthafte Verfehlung gegen Gott und die Gemeinde, wenn ein Christ die Eucharistiefeier am Sonntag ohne schwerwiegenden Grund versäumt. Ob das im einzelnen Fall als schwere Sünde bezeichnet werden muß, ist von daher zu beurteilen, inwieweit sich hier eine Haltung der Undankbarkeit, Gleichgültigkeit oder Ablehnung gegenüber Gott und seiner Kirche ausdrückt. So ist das Gewicht dieser Verfehlung zu messen an der Haltung, in der der einzelne zu Gott und der Kirche steht. Zumal wer immer wieder ohne Grund der sonntäglichen Eucharistiefeier fernbleibt, steht in schwerem Widerspruch zu dem, was er als getaufter und gefirmter Christ der Gemeinschaft der Kirche und sich selbst schuldig ist, und er weist damit zugleich undankbar das Angebot Gottes zurück. Das Gebot der Kirche will die innere Verpflichtung nur bewußtmachen und unterstreichen. Es will eine Hilfe zur Selbstbindung sein und deutlich machen, daß die Teilnahme an der Eucharistiefeier nicht dem Belieben des einzelnen überlassen bleiben kann" (2.3.).
Im Sonntagsgebot geht es um die Teilnahme am Erlösungsgeheimnis als dem zentralen Lebensvollzug der Kirche, den der Glaubende aktiv mitträgt.
Wer der Eucharistiefeier am Sonntag fernbleibt und sich mit Vorwänden der Verpflichtung entzieht und so trotz besserer Einsicht Gottes Einladung zum Gastmahl seines Sohnes ausschlägt, macht sich schuldig. Sein Handeln steht im Widerspruch zu seinem Christsein.
Das Sonntagsgebot bindet nicht in jedem Fall und unter allen Umständen. Es kann Gründe geben, die von der Teilnahme entschuldigen. Das trifft zu, wenn aus einer Teilnahme schwere persönliche Nachteile (zum Beispiel Zerrüttung der Ehe) entstehen, unzumutbare Belastungen (zum Beispiel angegriffene Gesundheit, Krankheit, weite Wege) erwachsen oder Verpflichtungen der Nächstenliebe den Vorrang vor der Teilnahme an der Eucharistiefeier (zum Beispiel Pflege schwerkranker Angehöriger, Sorge für kleine Kinder) haben. Doch sollte man auch im Fall einer längeren Verhinderung (zum Beispiel Krankenpflege oder Kinderbetreuung) nach Möglichkeiten einer Ablösung Ausschau halten, so daß man auch in dieser Zeit immer wieder einmal am Gottesdienst teilnehmen kann. Nicht selten bieten Pfarrgemeinden für die Zeit des Sonntagsgottesdienstes eine Betreuung von Kindern an. Diejenigen, denen die Teilnahme an der Eucharistiefeier der Gemeinde unmöglich ist, bieten kirchliche Sendungen in Fernsehen und Radio die Möglichkeit, wenigstens auf diese Weise die Feier der Kirche mitzuleben.
In der Gegenwart wächst die Zahl der Orte, in denen die Gemeinden ohne Priester am Ort sind. Die Eucharistiefeier ist unter Umständen nur alle vierzehn Tage oder einmal im Monat möglich. Damit die Gemeinden nicht ganz ohne Gottesdienst sind, feiern an manchen Orten Ständige Diakone und bischöfliche Beauftragte mit der Gemeinde den Sonntag in einem Gottesdienst, in welchem sie das Wort Gottes verkünden und den Gläubigen die heilige Kommunion reichen. Auch in dem Fall, daß niemand zur Verfügung steht, der einen solchen Wortgottesdienst leiten kann, sollten die Gläubigen zum Gebet zusammenkommen, um den Sonntag auf die ihnen mögliche Weise zu heiligen.
Wer am Sonntag nicht die heilige Messe mitfeiern kann, wird nach anderen Möglichkeiten der Begegnung mit Jesus Christus suchen (Gebet, Lesen der Schrift, Meditation, Empfang der Krankenkommunion durch Kommunionhelfer, Gottesdienstbesuch an einem Wochentag, Wortgottesdienst auf einer Außenstation) und sich so in der Gemeinschaft der Glaubenden mit Jesus Christus verbunden wissen. Wenn diese Möglichkeiten auch nicht die sonntägliche Eucharistiefeier ersetzen, sind sie doch Zeichen und Ausdruck des Glaubens (vgl. CIC, can. 124 § 2).
Zu einer Belebung und Förderung des Sonntags können viele beitragen.
Eine wichtige Rolle kommt der Familie zu. Sie ist der Ort, an dem die Kinder durch das christliche Beispiel ihrer Eltern, durch die Einübung des Betens und durch die Feier der Sonn- und Festtage in den Glauben und die christlichen Lebensgewohnheiten hineinwachsen. Am Vorbild der Eltern gewinnen die Kinder mehr und mehr Einblick in den Wert und die Schönheit des christlichen Feierns, der gemeinsamen Erfahrung des Ausruhens, der Erholung, der Begegnung mit anderen Gläubigen in der sonntäglichen Meßfeier und in Gruppen junger Familien, die miteinander feiern, wenn ein Kind getauft wird oder zur Erstkommunion geht, wenn an christlichen Festen volkstümliche Sitten und Bräuche gepflegt werden (Martinstag, Nikolaus, Ostern usw.) und in Unterhaltung und Spiel das Gefühl der Zusammengehörigkeit geweckt und bestärkt wird.
Von großer Bedeutung sind die Vereine. Sie können in Zusammenarbeit mit der Pfarrgemeinde Sonntage und Festtage mitgestalten und mithelfen, daß ihren Mitgliedern die Möglichkeit des sonntäglichen Ausruhens und der Teilnahme am Gottesdienst erhalten bleibt. Kirchliche Verbände werden darauf achten, daß bei Veranstaltungen die Feier der Eucharistie eingeplant wird. Die Sportvereine sollen den jungen Menschen angemessenen Raum für das Leben in der Familie, in der Pfarrgemeinde und in anderen Gemeinschaften gewährleisten.
Mehr und mehr wirken sich die Veränderungen der modernen Arbeitswelt auf die Ausweitung der Sonntagsarbeit aus. Moderne Technologien bringen Zwänge mit sich, die von ihren ökonomischen Gesetzlichkeiten her zwar verständlich sind, aber letztlich auf Kosten der Menschen gehen. Wirtschaftler und Politiker müssen bei der Einführung neuer Technologien und bei der gesetzlichen Regelung der Arbeitszeiten bedenken, daß wirtschaftliche Rentabilität und Wachstum der Produktion zwar wichtig sind, aber nicht den Vorrang vor dem Menschen haben dürfen. Ausnahmen, die ein bestimmter Wirtschaftszweig für sich in Anspruch nimmt, können schnell zur Regel werden und dann zu einer Störung des sozio-kulturellen Gefüges der Gesellschaft beitragen. Wirtschaft und Politik müssen darauf bedacht sein, den Sonntag zu erhalten (vgl. dazu "Unsere Verantwortung für den Sonntag". Gemeinsame Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz und des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 25. 1. 1988).
4. Die Sonntagsfeier und die getrennten Christen
Viele fragen heute, ob die Feier des Sonntags nicht auch gemeinsam mit den getrennten Christen möglich sei. Gibt es nicht auf dem Weg zur Einheit gemeinsame Formen der liturgischen Feier, die als Erfüllung des Sonntagsgebotes angesehen werden können?
Auf diese Frage ist als erstes festzustellen: Nach katholischem Verständnis, das sich auf die apostolische Überlieferung stützt, gehören Herrentag und Herrenmahl zusammen. Deshalb hat die katholische Kirche durch alle Jahrhunderte daran festgehalten, daß zur Feier des Sonntags als Tag der Auferstehung Jesu Christi die sakramentale Feier seines Todes und seiner Auferstehung gehört. Das Gesetzbuch der katholischen Kirche legt fest: "Am Sonntag und an den anderen gebotenen Feiertagen sind die Gläubigen zur Teilnahme an der Meßfeier verpflichtet" (CIC, can. 1247). In Ergänzung dazu heißt es: "Dem Gebot zur Teilnahme an der Meßfeier genügt, wer an einer Messe teilnimmt, wo immer sie in katholischem Ritus am Feiertag selbst oder am Vorabend gefeiert wird" (CIC, can. 1248 1).
In bezug auf die orthodoxen Kirchen ist folgendes zu beachten: Mit ihnen besteht eine "sehr enge Gemeinschaft im Bereich des Glaubens" (ÖD 122). Sie besitzen "wahre Sakramente, vor allem aber in der Kraft der apostolischen Sukzession das Priestertum und die Eucharistie, wodurch sie in ganz enger Verwandtschaft bis heute mit uns verbunden sind" (UR 15).
Als Konsequenz aus der Gemeinschaft im sakramentalen Leben mit den Mitgliedern der verschiedenen orientalischen Kirchen, die nicht in voller Gemeinschaft mit der katholischen Kirche stehen, stellt das Ökumenische Direktorium fest: "Wenn die Notwendigkeit es erfordert oder ein wirklicher geistlicher Nutzen dazu rät und vorausgesetzt, daß jede Gefahr des Irrtums und des Indifferentismus vermieden wird, ist es jedem Katholiken, dem es physisch oder moralisch unmöglich ist, einen katholischen Spender aufzusuchen, erlaubt, die Sakramente der Buße, der Eucharistie und der Krankensalbung von einem nicht-katholischen Spender einer Ostkirche zu empfangen" (123). Eine weitere Konsequenz lautet: "Die katholischen Spender können erlaubt die Sakramente der Buße, der Eucharistie und der Krankensalbung Mitgliedern der orientalischen Kirchen spenden, wenn diese von sich aus darum bitten und in rechter Weise disponiert sind" (125).
Anders ist die Situation bezüglich der aus der Reformation hervorgegangenen, von der katholischen Kirche getrennten Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften. Hier ist die hinreichende Glaubens- und Sakramentsgemeinschaft nicht mehr bzw. noch nicht gegeben. Solange dies der Fall ist, ist für die katholische Kirche die Kommuniongemeinschaft mit diesen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften nicht möglich (vgl. KKK 1400; KEK 1, 360f).
Deshalb gilt bezüglich der Sakramente der Grundsatz, daß katholische Amtsträger die Sakramente nur katholischen Gläubigen spenden dürfen und daß katholische Gläubige die Sakramente nur von katholischen Spendern empfangen dürfen. Nur in Ausnahmefällen, die eigens durch "Richtlinien für die ökumenische Praxis" festgelegt sind, wird die Zulassung von evangelischen Christen zur Kommunion gestattet. Zu diesen Ausnahmen gehört nicht, daß evangelische Christen in konfessionsverschiedenen Ehen zur Kommunion zugelassen sind, wie auch nicht, daß Katholiken das evangelische Abendmahl empfangen dürfen (vgl. Gemeinsames Wort der Deutschen Bischofskonferenz und des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland "Zur konfessionsverschiedenen Ehe" vom 1. 1. 1985, II, 1).
Die Gemeinsame Synode der deutschen Bistümer erklärt im "Beschluß: Gottesdienst" ausdrücklich, daß sie "zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Teilnahme eines katholischen Christen am evangelischen Abendmahl nicht gutheißen" kann (5.5.). In einer Bitte um Verständnis fügt sie hinzu: "Die Synode bittet die katholischen und die evangelischen Christen um Verständnis für ihre Haltung in der Frage der Eucharistiegemeinschaft. Es geht ihr darum, daß die notwendigen Bemühungen um ein gemeinsames Eucharistieverständnis nicht durch ein übereiltes Vorgehen Schaden leiden. Das immer schmerzlich erfahrene Getrenntsein am Tisch des Herrn soll uns Antrieb sein, im theologischen Gespräch und im Gebet auf jene volle Einheit hinzuarbeiten, die der Herr im Abendmahlssaal von seinem Vater erfleht hat und die in der gemeinsamen Eucharistie ihren Ausdruck finden soll" (ebd. 5.6.).
Bezüglich ökumenischer Gottesdienste hat die Deutsche Bischofskonferenz (24. 2. 1994) eine Erklärung abgegeben, die im Sinne des Ökumenischen Direktoriums (25. 3. 1993) als Orientierung dient:
- Ökumenische Gottesdienste sind Wortgottesdienste, "in denen Katholiken sich mit Christen, die anderen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften angehören, zum gemeinsamen Gebet versammeln" (vgl. 1).
- Ökumenische Gottesdienste können die sonntägliche Eucharistiefeier nicht ersetzen. Sie haben stets Ausnahmecharakter (vgl. 5).
- Die sonntäglichen Gottesdienste ohne Priester, die an die Stelle der "Eucharistie treten, haben an der katholischen Sonntagsliturgie und Sonntagsspiritualität orientierte Feierordnungen; sie lassen sich daher so nicht als ökumenische Gottesdienste gestalten und müssen als von der Situation erzwungene Ausnahmen angesehen werden" (vgl. 6).
- Wo es nicht möglich ist, daß die verschiedenen Gemeinden zunächst je ihren Gottesdienst feiern und anschließend zu einer ökumenischen Feier zusammenkommen, kann in Ausnahmefällen und aus wichtigen Anlässen ein ökumenischer Gottesdienst an Sonntagen und kirchlichen Feiertagen am Vormittag stattfinden; dabei darf die Feier der Eucharistie nicht ausfallen (vgl. 7); es muß für die Katholiken die Möglichkeit zur Mitfeier der Eucharistie an diesem Sonntag gewährleistet sein (vgl. 8).
IV. Viertes Gebot: Du sollst Vater und Mutter ehren
Ich bin dein Gott, der dir Leben und Zukunft schenkt
Gott will, daß wir die Menschen ehren, die uns Leben, Gemeinschaft und Glauben geben.
1. Verantwortung in den Grundformen des Gemeinschaftslebens
1.1. Der Wortlaut des Gebotes
Der Wortlaut des vierten Gebotes ist in den beiden Fassungen des Dekalogs verschieden. Im Buch Exodus lautet er:
- "Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt" (20,12).
Im Buch Deuteronomium enthält das Gebot zwei Erweiterungen. Der Text lautet:
- "Ehre deinen Vater und deine Mutter, wie es dir der Herr, dein Gott, zur Pflicht gemacht hat, damit du lange lebst und es dir gut geht in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt" (5,16).
Über diese Texte hinaus findet sich eine dritte Fassung des Gebotes der Elternehrung im sogenannten "Heiligkeitsgesetz" im Buch Levitikus. Hier steht es an der Spitze einer Reihe von kultischen und sozialen Geboten und lautet:
- "Jeder von euch soll Mutter und Vater fürchten und auf meine Sabbate achten; ich bin der Herr, euer Gott" (19,3).
Auffällig ist hier, daß die Mutter vor dem Vater genannt wird und daß "fürchten" anstelle von "ehren" steht.
1.2. Der Sinn des Gebotes
Die erste Tafel des Dekalogs bezieht sich auf das Verhältnis des Menschen zu Gott. Er offenbart sich den Menschen als der einzige Gott; er macht dem Volk seinen Namen kund, erweist sich als der Gott der Befreiung und schließt mit dem Volk einen Bund der Treue. Das Volk soll und kann ihm vertrauen, seinen Namen ehren und zum Zeichen des Bundes und der Befreiung den Sabbat halten.
Die zweite Tafel des Dekalogs weitet den Blick von der Gottesbeziehung auf die Beziehung der Menschen untereinander und auf das Gemeinschaftsleben hin aus. Sie beginnt mit dem Gebot der Elternehrung. Die Einordnung dieses Gebotes in die zweite Tafel des Dekalogs ist nicht unumstritten. In der Geschichte des Judentums war das Gebot, die Eltern zu ehren, eng mit dem Gebot der Gottesverehrung verbunden. Der jüdische Philosoph und Theologe Philo von Alexandrien (+ um 45/50 n. Chr.) rechnete es sogar noch zur ersten Tafel des Dekalogs (Über den Dekalog, §§ 106ff).
Das vierte Gebot verbindet Gottesverehrung und Elternehrung, setzt sie aber nicht gleich. Das entspricht auch dem ursprünglichen Sinn des vierten Gebotes, das für die Ehrung der Eltern dasselbe Wort verwendet wie für die Verehrung Gottes. Im Hebräischen bedeutet verehren, jemand das ihm zustehende Gewicht zuzuerkennen, ihn für gewichtig zu halten. Es bedeutet in der Beziehung der Menschen zu Gott, ihm das zukommende Gewicht zu gewähren, ihn in seinem Gottsein anzuerkennen. Es bedeutet in der Beziehung der Kinder zu den Eltern, ihnen das ihnen zukommende Gewicht zu gewähren, sie in ihrem Elternsein anzuerkennen und sie dadurch als Vater und Mutter zu ehren.
Die besondere Nähe der Gottesverehrung und der Elternehrung ist im alttestamentlichen Gottesvolk darin zu sehen, daß die Eltern, besonders der Vater, die Aufgabe hatten, die Geschichte Gottes mit seinem Volk an die nächste Generation weiterzugeben. Die Eltern sollten als diejenigen geachtet werden, die die Großtaten Gottes und sein Mitgehen mit dem Volk auf die verheißene Zukunft hin lebendig zu halten hatten. Es war in Israel Brauch, daß am Paschafest der jüngste Anwesende das Recht hatte, nach dem Sinn des Paschafestes zu fragen. Auf sein Fragen wurde dann die Geschichte über die Herausführung aus der Sklaverei in Ägypten erzählt. Die Eltern zu ehren, sie für gewichtig zu halten, bedeutete in Israel nicht nur, sie als Vater und Mutter zu ehren, sondern auch als Vermittler des Glaubens und der Verheißung des Landes. Wenn die junge Generation die Eltern in dieser "Gottesnähe" achtete, bezeugte sie dadurch zugleich, daß sie Gott achtete. Das vierte Gebot verbindet mit dieser Ehrung die Segensverheißung: "damit du lange lebst und es dir gut geht in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt" (Dtn 5,16; vgl. Ex 20,12.).
Vom Wortlaut her geht es im vierten Gebot um die Forderung, daß die erwachsenen Kinder die materielle Versorgung der alten Eltern sicherstellen. Hier kommt die "Sozialverpflichtung" der erwachsenen Kinder zur Sprache. Diese hatte in der damaligen wirtschaftlichen Situation große Bedeutung. Wenn die Eltern den Besitz an ihre Kinder weitergaben, war es Aufgabe der Kinder, die Versorgung der Eltern zu übernehmen. Die Eltern waren ganz auf das Wohlverhalten der Kinder angewiesen. Das vierte Gebot schärft die Verpflichtung, die an sich bereits als soziale Aufgabe bekannt war, als Gebot Gottes ein. Der Wortlaut des Gebotes scheint dafür zu sprechen, daß es sich nur auf das Verhältnis der Kinder zu ihren Eltern bezieht. Die alttestamentliche Geschichte zeigt jedoch, daß das vierte Gebot nicht nur an die heranwachsenden Söhne gerichtet ist, sondern an ganz Israel als Volk. Dieses bestand in vorstaatlicher Zeit aus einem Verband von Großfamilien, die jeweils drei bis vier Familien umfaßten. Sie bildeten eine Rechts-, Wirtschafts- und Kulteinheit. Das Haupt der Großfamilie übte Autorität als Richter, Besitzer und Priester aus (vgl. Gen 12,8; 22,1-19; 28,18; 31,54; 46,1). Das vierte Gebot sollte in der damaligen patriarchalischen Gesellschaft vor allem der väterlichen Autorität, die zugleich politische und religiöse Autorität war, das ihr zustehende Gewicht geben. Eine entsprechende Ehrfurcht und Dankbarkeit gebührte freilich auch den Müttern. Wenn Israel die Ordnung der Generationen zusammen mit den Ordnungen des Politischen und des Religiösen achtete, war ihm Leben und Überleben in dem verheißenen Land zugesichert.
Diese dreifache Zielrichtung des vierten Gebotes blieb auch bestehen, als nach der Landnahme und der Staatsbildung das Königtum und das Priestertum je einen eigenen Stand bildeten. Das Gebot erstreckte sich auf diese Autoritäten. Innerhalb dieses erweiterten Rahmens ging es darum, in den drei Grundformen des Gemeinschaftslebens den verantwortlichen Autoritäten das rechte Gewicht zukommen zu lassen: in der Familie, in der politischen Gemeinschaft und in der religiösen Gemeinschaft.
Die drei Grundformen des Gemeinschaftslebens: Familie, politische Gemeinschaft und religiöse Gemeinschaft haben sich im Lauf der Geschichte vielfach gewandelt. Damit hat sich auch die Art und Weise, wie das vierte Gebot jeweils zu verstehen und zu erfüllen ist, gewandelt. Es geht nicht mehr nur um die Frage der Anerkennung der Autorität, sondern zugleich auch um das Miteinander aller Mitglieder in der jeweiligen Gemeinschaft; es geht um "die Forderung, in der Familie, in Staat und Gesellschaft, in der Kirche jedem Glied der Gemeinschaft mit Achtung zu begegnen und zu ihm zu stehen" (Katholisches Gebet- und Gesangbuch "Gotteslob", 119). Damit verbindet sich dann auch die Frage nach der Struktur dieser Institutionen und nach ihrer menschenwürdigen Gestaltung.
Das vierte Gebot stellt, wie der Katechismus der Katholischen Kirche betont, "eine der Grundlagen der Soziallehre der Kirche dar" (2198). Es stellt uns vor die Frage, wie heute Familie, politische Gemeinschaft und Gemeinschaft der Kirche zu sehen sind und wie wir in ihnen unsere Verantwortung wahrzunehmen haben.
2. Als Christen leben in der Familie
2.1. Zur Situation der Familie heute
Die Familie als Gemeinschaft der Eltern mit ihren Kindern ist von Gott gewollt (vgl. Gen 1-2; FC 3). Sie ist dazu berufen, in den Bedingungen unserer Welt den Plan Gottes aufzugreifen und zu verwirklichen (vgl. dazu KKK 2196-2233). Wie kann sie diese Aufgabe in unserer Zeit erfüllen? Um in dieser Frage zu sittlichen Orientierungen zu kommen, stellen wir uns die wichtigsten Merkmale der heutigen Familiensituation vor Augen.
Ein erstes Merkmal der heutigen Familiensituation besteht darin, daß sich in den modernen Industriegesellschaften die Familie als kleine häusliche Gemeinschaft der Eltern mit ihren Kindern versteht.
In früheren Zeiten war die Klein- oder Kernfamilie zumeist in eine größere Haus- und Hofgemeinschaft eingebunden, in der mehrere Generationen zusammenlebten. Dazu gehörten auch unverheiratete Verwandte, Knechte und Mägde oder Lehrlinge und Gesellen. Hier bot das Verhältnis von Eltern und Kindern sowie die Beziehung zu Großeltern, Verwandten und Angestellten viele gemeinsame Erlebnisinhalte. Arbeit und Freizeit, Werktag und Sonntag, Kindheit, Lebensmitte und Alter waren erlebnismäßig eng miteinander verbunden. Auch die sittliche Erziehung geschah zum großen Teil in dieser Gemeinschaft, die durch gleiche Ziele und Werte geprägt war. Dieses vielfältige Beziehungsgeflecht war sowohl für die Eltern als auch für die Kinder entlastend.
- Heute ist das Familienleben weithin vom Erwerbsleben getrennt. Die Kinder sind mit ihren Eltern, sofern diese berufstätig sind, nur noch nach Arbeitsschluß, an Wochenenden und im Urlaub für längere Zeit zusammen. Oft erfolgt mit dem Berufs- oder Arbeitswechsel des Vaters auch ein Wohnungs- oder Ortswechsel der Familie. Damit müssen auch gewachsene soziale Beziehungen aufgegeben werden. Das kann eine Familie belasten, es kann aber auch eine Chance für den Aufbau von Familien- und Sozialbeziehungen sein.
- Noch zu Beginn unseres Jahrhunderts lebten Eltern mit ihren Kindern fast die ganze Ehedauer zusammen. Nach der Heirat ihrer Kinder blieben den Eltern bis zum Tod eines Ehegatten oftmals nur noch wenige Ehejahre. Den Rest ihres Lebens lebten sie in der Familie eines der verheirateten Kinder. Heute bilden die verheirateten Kinder zumeist eine eigene häusliche Gemeinschaft. Ihr Kontakt zu den alleinlebenden Eltern hängt - abgesehen von der räumlichen Entfernung - davon ab, wie tief ihre emotionale Bindung ist oder wie weit sie die Eltern noch für die Betreuung der Kinder brauchen oder wie weit die Eltern als Großeltern wesentlich zur Betreuung ihrer Enkelkinder beitragen können. In dieser Hinsicht haben Großeltern gerade unter den gewandelten Verhältnissen unserer Zeit große Bedeutung.
Ein zweites Merkmal der heutigen Familie ist die veränderte Stellung der Frau und die Einstellung der Eheleute zum Kind bzw. zu Kindern.
Unter dem Einfluß des Christentums hat sich in der Geschichte ein Leitbild der Ehe entfaltet, dessen bestimmendes Element die gleiche Würde von Mann und Frau ist. Dieses Leitbild ist in der sakramentalen Ehe zum religiös verbindlichen Leitbild geworden. Der Treuebund der Ehe setzt voraus, daß Mann und Frau als Person gleichwertig sind. Aber erst die Abkehr vom patriarchalischen Verständnis von Ehe und Familie sowie die sozialen und wirtschaftlichen Umwälzungen ermöglichten der Frau größere Eigenständigkeit, Unabhängigkeit und Teilnahme am wirtschaftlichen und sozialen Leben. Dadurch wird es möglich, daß beide Ehegatten wichtige Inhalte des sozialen und kulturellen Lebens in ihre Familie einbringen. Sie teilen die Aufgaben in der Versorgung des Haushalts und in der Betreuung und Erziehung der Kinder.
- Die personale Sicht der Ehe hat große Bedeutung für die Entscheidung der Eheleute über die Zahl der Kinder. Heutige Familien haben im Vergleich zu früher im Durchschnitt wenige Kinder. Die Gründe dafür sind vielfältig; unter anderem ist ein wichtiger Grund die veränderte Einstellung der Eltern zum Kind als Person. Die Eltern möchten in der Lage sein, ihren Kindern Zuwendung und Geborgenheit, Pflege und Schutz sowie angemessene Erziehung und Ausbildung zu gewährleisten. Das scheint vielen unter den heutigen Lebensverhältnissen am ehesten möglich zu sein, wenn die Familie weder zu klein noch zu groß ist.
Ein drittes Merkmal der heutigen Familiensituation besteht darin, daß die Familienmitglieder in stärkerem Maße als früher von der Gesellschaft, von ihren Lebensformen und von ihren Wertvorstellungen mitgeprägt werden.
Bis in die Neuzeit war die Familie die tragende Kraft der Gesellschaft. Sie vermittelte in enger Beziehung mit den Bildungseinrichtungen von Kirche und Gesellschaft in der Kindererziehung bewährte Lebenserfahrungen, sittliche Wertvorstellungen und religiöse Überzeugungen.
- Heute ist die Familie als kleine Lebensgemeinschaft mehr und mehr zu einem Teilsystem der Gesellschaft geworden. Die einzelnen Familienmitglieder werden die meiste Zeit von außerfamiliären Institutionen in Anspruch genommen. Kindergarten, Schule, Ausbildung und Weiterbildung, Erwerbsarbeit und Beruf sowie kulturelle, soziale und politische Verpflichtungen können zwar das familiäre Leben entlasten, sie können es aber auch belasten.
- Erfahrungen und Wissen der Eltern sind heute für die heranwachsenden Kinder in manchen Bereichen nur noch von relativer Bedeutung. Das erworbene Wissen und die Fähigkeit der Jugendlichen im Umgang mit der ständig sich verändernden Technik übersteigen oft das Können der älteren Generation. Die Heranwachsenden machen ihre Lebenserfahrungen zum großen Teil außerhalb der Familie. Sie bringen ihre Erlebniswelt, ihre in der Gesellschaft gewonnenen Wertvorstellungen und ihre Lebensstile in die Familie ein. Manchmal sind die Auffassungen von Eltern und Kindern so verschieden, daß daraus schwere Konflikte entstehen.
- Manche Gesellschaftstheoretiker stellen die Fähigkeit der Familie, Kinder angemessen zu erziehen und sie in die gesellschaftlichen Aufgaben einzuführen, in Frage. Sie sehen in der heutigen Form der Familie den "Ort repressiver Autorität" und den "Ursprung gesellschaftlich-staatlicher Herrschaftsstrukturen". An die Stelle der bisherigen autoritativen Erziehung müsse eine emanzipatorische Begegnung der Generationen treten. Da diese von der Kleinfamilie nicht geleistet werden könne, müßten sich mehrere Familien zu Wohngemeinschaften zusammenschließen. In ihnen könne die Betreuung und Erziehung der Kinder abwechselnd von einem oder mehreren Erwachsenen vorgenommen werden. Auf diese Weise seien auch die Eltern von der Sorge für den Haushalt entlastet und könnten einen Beruf ausüben oder ihre Ausbildung fortsetzen.
- Nach anderen muß in unserer Zeit die in der Ehe begründete Familie nicht mehr die alleinige und unersetzliche Institution zur Weitergabe des Lebens und der Erziehung von Nachkommen sein. Diese Aufgabe könne auch von nichtehelichen Gemeinschaften übernommen werden. Die Zahl solcher Gemeinschaften ist gegenwärtig im Wachsen. Ihre Bedeutung ist allerdings nicht so groß, daß sie die Einstellung zur Familie als in der Ehe begründete häusliche Gemeinschaft von Eltern und Kindern zu zerstören drohte. Der weitaus größte Teil der Menschen ist davon überzeugt, daß Kinder eine vollständige Ehe brauchen, um glücklich aufzuwachsen. Die meisten halten es für wichtig, daß die Eltern verheiratet sind und mit den Kindern als Familie zusammenleben. Diese innere Zuordnung von Ehe und Familie entspricht auch dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Es stellt Ehe und Familie unter den besonderen Schutz des Staates (Art. 6 Abs. 1).
Die verschiedenen Merkmale der heutigen Familiensituation tragen dazu bei, daß gegenwärtig unterschiedliche Modelle von Familie nebeneinander bestehen. Dementsprechend ist dann auch die Beziehung zwischen Eltern und Kindern verschieden.
Die Gründe für die Entscheidung zu dieser oder jener Lebensform von Familie sind unterschiedlich. Materielle Lebensverhältnisse, Ansprüche an das eigene Leben, persönliche Einstellungen, gesellschaftliche Wertvorstellungen, Auffassungen über Betreuung und Erziehung der Kinder, schicksalhaftes Betroffensein und vieles mehr spielen dabei eine entscheidende Rolle.
Über alle diese Fragen gibt es eine breite Diskussion. In ihr zeigt sich eine Unsicherheit darüber, wie die eheliche Partnerschaft, die Rolle von Mann und Frau, die Weitergabe des Lebens, das Recht der Kinder auf Betreuung und Erziehung und die soziale Sicherung des Lebensstandards der Familie sinnvoll in Einklang gebracht werden können.
2.2. Die Familie als Ort der Annahme und Geborgenheit
In der Gegenwart begegnen wir allgemein einer hohen Wertschätzung des Personalen und der personalen Beziehungen. Diese wirkt sich auch auf die Familie und das Familienleben aus. Junge Familien erleben ihre Gemeinschaft als ursprünglichen Ort der Erfahrung von Hingabe und Annahme, von Liebe und Freude. Das Kind gewinnt in der Familie jenes Urvertrauen zum Leben, das die Voraussetzung für die Ichfindung und die Hingabefähigkeit des Menschen bildet. Wer kein Vertrauen erfährt, kann kein Vertrauen schenken und hat es schwer, sich anderen anzuvertrauen. Der Erfahrungs- und Erlebnisraum kann durch keine andere Einrichtung vollgültig ersetzt werden. Kinder brauchen eine konkrete Familie, in der sie die Zuwendung beider Eltern erfahren und sich im Umgang mit Geschwistern in soziale Verhaltensweisen einüben können, die für ihre eigene Reifung unerläßlich sind. Wo die Geborgenheit der Familie fehlt, besteht die Gefahr, daß ein gebrochenes Verhältnis der Kinder zu ihrer Lebenswelt entsteht.
In der Familie werden Kinder mit Werten und Wertvorstellungen, mit Versagen und Schuld, mit unterschiedlichen Meinungen und Konflikten konfrontiert. An ihnen können sie wachsen und reifen. Am Beispiel der Eltern erfahren Kinder auch, was Liebe und Partnerschaft konkret bedeuten. An der Art, wie Eltern einander begegnen, bildet sich die Einstellung der Kinder zu Geschlechtlichkeit und Liebe, zu Treue und Vertrauen. Mehr als jedes andere Versagen wirkt sich das Versagen der elterlichen Ehe auf die Lebenseinstellung der Kinder aus.
Kinder, die durch Scheidung der Eltern ihr Zuhause verlieren, haben es nicht leicht, bei sich selbst zu Hause zu sein und ein rechtes Verhältnis zu sich und zu anderen zu finden. Die biblische Weisung, daß Kinder ihre Eltern ehren und achten sollen, setzt voraus, daß sie zu ihren Eltern ja sagen können. Wo Kinder allein gelassen, schon in frühester Kindheit an mehrfach wechselnde Bezugspersonen weitergegeben oder zwischen geschiedenen Eltern hin- und hergeschoben werden, wird es ihnen nur schwer gelingen, ein uneingeschränktes Ja zu den Eltern sagen zu können. Fehlende Liebe ist durch nichts zu ersetzen. Materielle Geschenke können Liebe, Achtung und Ehrfurcht nicht erkaufen.
Alleinerziehende Väter und Mütter spüren besonders, daß sie den fehlenden Elternteil in der Erziehung nicht ersetzen können. Um so mehr verdienen sie für den selbstlosen Dienst an der Betreuung und Erziehung Anerkennung. Sie brauchen Rückhalt und Hilfe bei befreundeten Familien, in Freundeskreisen und in der Gemeinde. Oft können hier auch Großeltern die Aufgabe der Miterziehung übernehmen. Sie können den Kindern ihrer alleinerziehenden Tochter oder ihres Sohnes besondere Zuwendung schenken und ihnen nach Kräften dabei helfen, Werte zu entdecken, das Gute zu lieben und richtige Entscheidungen zu finden.
Oft stehen Eltern vor der Frage, wie Familienleben und Beruf sinnvoll verbunden werden können. Dafür gibt es keine einheitlichen Lösungen. Jede Ehe und Familie muß auf ihre Weise ihren Wert, ihre Kraft und ihre humane Gestalt zu finden versuchen. In der Familie müssen Kinder erfahren können: Meine Eltern haben mich gern, sie sorgen für mich, ich bin bei ihnen geborgen. Daraus erwächst dann das Vertrauen der Kinder zu sich selbst und zur Welt.
Die Familie ist auch der Raum, in welchem am ursprünglichsten erfahren wird, daß das menschliche Leben verdanktes Leben ist. Es ist Geschenk der Liebe der Eltern und der Liebe Gottes. Im Vertrauen auf Gott, der jeden einzelnen ins Dasein ruft und ihn liebt, lassen gläubige Eltern ihre Kinder taufen, beten für sie und mit ihnen und schenken ihnen von frühester Kindheit an das Gefühl, daß sie in der Liebe Gottes geborgen sind. Aus dieser Geborgenheit erwächst dann bei den Kindern auch die Dankbarkeit. Ihr Dank richtet sich an Gott und an die Eltern, aus deren Liebe sie das Leben empfangen haben. Der Dank soll sich darin äußern, daß Kinder die Eltern achten und ehren:
- "Ehre deinen Vater von ganzem Herzen, vergiß niemals die Schmerzen deiner Mutter! Denk daran, daß sie dir das Leben gaben. Wie kannst du ihnen vergelten, was sie für dich taten?" (Sir 7,27f).
Dank an Gott und Ehrung der Eltern sind nicht immer leicht zu vollziehen. Kinder, die bei ihren Eltern keine Liebe erfahren, sich selbst überlassen sind oder gar mißhandelt werden, sagen: Ich kann Gott nicht danken; ich kann auch meine Eltern nicht achten. Wie soll ich sie achten und lieben können, da sie mir so viel Böses angetan haben! Auch schwerbehinderten Kindern und Jugendlichen fällt es oft nicht leicht, für ihr Leben zu danken. Sie fragen: Warum hat Gott gerade mich so geschaffen? Wofür soll ich ihm danken? Dafür, daß er mich so geschaffen hat? Das kann ich nicht! Behinderte Kinder, die von ihren Eltern in ein Heim abgegeben worden sind, klagen nicht selten ihre Eltern an, daß sie sich nicht oder nicht genug um sie kümmern. Sie achten nicht ihre Eltern, sondern ihre Pfleger, Betreuer und Erzieher. Diese sind für sie Vater und Mutter geworden.
Die Familie erweist ihre besondere Stärke dadurch, daß in ihr die Kinder um ihrer selbst willen angenommen werden. Auch das behinderte, schwererziehbare oder weniger begabte Kind findet meist in der Sorge der Eltern und Geschwister eine Geborgenheit, die es in einer anderen Einrichtung so nicht erfahren kann, auch wenn das für die Eltern wie für die ganze Familie oft eine große Belastung ist, die von Außenstehenden kaum gerecht eingeschätzt werden kann.
Wie keine andere Gemeinschaft ist die Familie Ort der Zuflucht in der Not. Solange die Eltern leben, sollen die Kinder die offene Tür der Eltern suchen und bei ihnen Zuflucht, Hilfe und Trost finden.
Das Bewußtsein, ein Zuhause zu haben und immer wieder nach Hause finden zu können, ist in der Gegenwart besonders wichtig. Denn Auseinandersetzungen, Streit und Konflikte zwischen den Generationen sind häufiger und vielfach auch härter geworden. Heranwachsende entschließen sich schneller dazu, das Elternhaus zu verlassen und nach eigenen Vorstellungen zu leben. Eltern, die ihren Kindern ein Zuhause geschenkt haben, dürfen darauf vertrauen, daß ihr Bemühen nicht vergeblich gewesen ist. Sie werden die Verbindung auch dann nicht abbrechen, wenn sie die Entscheidungen ihrer Kinder nicht billigen können.
Die Aufgabe der Eltern, für ihre Kinder zu sorgen und ihnen Geborgenheit und Heimat zu schenken, darf aber die andere Seite des vierten Gebotes nicht übersehen lassen, nämlich die Pflicht der nachfolgenden Generation, für die ältere Generation zu sorgen. Durch den sogenannten "Dreigenerationenvertrag" scheint in unserer Gesellschaft zur Zeit die finanzielle Absicherung der älteren Generation weithin gewährleistet zu sein, aber es bleiben viele offene Fragen. Vor allem bleibt das Problem: Werden wir auf Dauer genügend jüngere Menschen finden, die sich um ältere und pflegebedürftige Menschen sorgen?
Wenn die erwachsenen Kinder selbst eine Familie gegründet haben und in eine andere Gegend verzogen sind, fühlen sich die Eltern oft einsam. Ihnen fehlen Nähe, Begegnung und Gespräch mit ihren Kindern. Mit zunehmendem Alter werden sie anfälliger für Krankheiten und brauchen pflegerische Betreuung. Oft kann sie aber von den Kindern nicht geleistet werden. Hier enthält der "Dreigenerationenvertrag" eine neue soziale Bedeutung. Wo die Möglichkeiten der Kinder und die sozialen Dienstleistungen nicht ausreichen, ist die gesamte mittlere und jüngere Generation zur Solidarität gegenüber älteren Menschen aufgerufen. Christliche Nächstenliebe fordert dazu auf, erfinderisch zu sein und zu sehen, daß "der Geringste unter den Schwestern und Brüdern" auch und gerade in den einsamen und kranken älteren Menschen zu erkennen ist.
2.3. Die Familie als Raum von Erziehung und Bildung
In der Familie werden Kinder angenommen und bejaht, so daß sie sich selbst annehmen und anderen vertrauen können. Dabei darf jedoch die Sorge der Eltern nicht stehenbleiben. Die Eltern werden ihre Kinder so in das Leben einführen, daß sie fähig werden, das Leben zu bewältigen. Dazu ist es notwendig, daß sie Lebenszusammenhänge kennenlernen und verstehen, daß sie mit Werten und Lebensordnungen vertraut werden, die Orientierung und Herausforderung sind. Die Familie hat im Zusammenspiel mit anderen Erziehungs- und Bildungseinrichtungen das Recht und die Pflicht, Kinder und Jugendliche so zu erziehen, daß sie in der Lage sind, ihre Aufgaben in Familie, Gesellschaft und Kirche wahrzunehmen. Kann die Familie das in der heutigen Zeit leisten, oder ist sie darin überfordert? Welche Zielvorstellungen sollen Eltern in der heutigen Gesellschaft vermitteln, in der sich unterschiedliche Sinnentwürfe anbieten?
Auf diese Fragen gibt es keine einfachen Antworten. Oft sind nicht nur Ziel- und Wertvorstellungen der Eltern selbst sehr unterschiedlich, so daß eine Einigkeit schwer zu erreichen ist; vielfältig und oft widersprüchlich sind vor allem Konzepte und Ziele, die von den Erziehungswissenschaften vertreten werden.
Voraussetzung für eine angemessene Erziehung und Bildung ist, daß Eltern in kluger Weise die Aufnahmefähigkeit der Kinder berücksichtigen und sich auf die unterschiedlichen Entwicklungsphasen in Kindheit und Jugend einstellen. Die sittliche Entfaltung soll möglichst wenig durch Verbote und Reglementierungen eingeschränkt werden. Bevormundung, Drohung, Zwang oder gar Prügelstrafe hemmen die Entwicklung mehr, als daß sie Selbstbestimmung, Freiheit und Verantwortung fördern. Wenn Eltern mit den Kindern sprechen und Beispiel geben, werden sie mehr erreichen als durch Strafe oder Zwang. Erziehung sollte immer davon ausgehen, daß in jedem Kind das Gute angelegt ist. Die Liebe, die sich am Guten freut (vgl. 1 Kor 13,6), entdeckt es, fördert es und läßt es so wachsen.
Es geht in der Erziehung nicht darum, den Kindern jeden Wunsch von den Augen abzulesen, sondern darum, Sinnziele und Werte zu vermitteln, mit denen sie sich in den einzelnen Phasen der Entwicklung auseinandersetzen können. Kinder müssen lernen, um solcher Werte willen auf persönliche Wünsche zu verzichten. Deshalb müssen Eltern sinnvolle Opfer und Verzichte von ihren Kindern verlangen. Die Autorität der Eltern soll helfende und orientierende Autorität sein.
In den einzelnen Entwicklungsphasen vollzieht sich Erziehung mehr und mehr in einem Dialog. Dabei sehen die Kinder ein, daß sittliche Werthaltungen und Orientierungen verbindlich sind, und übernehmen sie für ihre Lebensorientierung.
Erziehung geschieht nicht konfliktfrei. Eltern schulden ihren Kindern die Hilfe ihrer Autorität. Sie müssen Fehler und Fehlhaltungen beim Namen nennen. Es muß deutlich werden, daß Freiheit nicht Freizügigkeit und Bindungslosigkeit ist, sondern Bindung und Verbindlichkeit einschließt. Egoismus, Bequemlichkeit, Verzicht auf Werteinstellungen sowie Mißachtung anderer Menschen dürfen nicht kritiklos hingenommen werden. Ähnliches gilt auch, wenn Machbarkeit, Nützlichkeit, Erfolg oder Zweckmäßigkeit das Denken und Verhalten der Jugendlichen bestimmen. Eltern sind verpflichtet, Orientierungen zu geben, aber sie müssen diese möglichst auch begründen und einsichtig machen. Andererseits dürfen sie ihren Kindern aber nicht verweigern, Kritik an überholten Normen und Traditionen zu üben und zu einem persönlich zu verantwortenden Lebensentwurf zu finden.
Die größere berufliche und räumliche Mobilität wie auch die frühe Übernahme von Verantwortung erfordert heute von jungen Menschen große Entscheidungsfähigkeit. Dabei können Eltern beratend zur Seite stehen, dürfen aber den Heranwachsenden die Entscheidung nicht abnehmen oder Druck auf sie ausüben.
Eine Erziehung, bei der die Eltern die ersten Partner ihrer Kinder sind, vermag bei Eltern und Kindern gegenseitige Achtung und Ehrfurcht zu wecken, wodurch Autorität und Gehorsam in ein rechtes Maß kommen. Sie wird auch der Mahnung der neutestamentlichen Haustafeln gerecht, nach denen die Kinder den Eltern gehorchen und die Eltern die Kinder nicht einschüchtern sollen (Kol 3,20f). Im Epheserbrief (6,1-4) wird das Gebot der Elternehrung christlich motiviert. Das Gebot erinnert daran, daß die Ordnung des Familienlebens die Achtung vor den Eltern einschließt. Eltern behalten eine moralische Autorität auch dann, wenn die Kinder mündig geworden sind. Es ist eine große Aufgabe, die Erfahrungen der Geschichte und ihres Lebens an die kommende Generation weiterzugeben, Werte, Traditionen und Sitten zu vermitteln und auch für die Weitergabe des Glaubens zu sorgen.
Um diese Aufgabe erfüllen zu können, ist es notwendig, daß Gesellschaft und Staat die Familie fördern. Die gesellschaftlichen Voraussetzungen dafür, daß die Familien ihrem Erziehungsauftrag angemessen nachkommen können, sind gegenwärtig noch unzureichend. Zwischen dem Erziehungsauftrag der Eltern, der Gesellschaft und des Staates bestehen Spannungen und Unausgewogenheiten. Das wird vor allem daran deutlich, daß das gegenwärtige Erziehungssystem zwar Werte vermitteln möchte, aber in Wirklichkeit weithin von Kräften bestimmt wird, die auf ökonomische Sicherheit, Leistung, Wissen, technisches Können und Durchsetzungsvermögen zielen. Unter dem Druck der wissenschaftlich-technischen Anforderungen tritt in der schulischen und beruflichen Ausbildung die Erziehung zur sittlichen Persönlichkeit, zu Werten und humanen Grundhaltungen in den Hintergrund. Sie wird weithin dem privaten Raum der Familie zugewiesen. Die Folge davon ist, daß Familien oft isoliert sind oder überfordert werden. Dadurch wandelt sich das psychisch-soziale Verhältnis der Generationen und gefährdet das Bewußtsein der Verantwortung für die Zukunft. Hier wird das vierte Gebot zur Forderung auch an Gesellschaft und Staat, ihren Auftrag zu Erziehung und Bildung wahrzunehmen und so den humanen Wert dieses Gebotes in den heutigen Lebensbedingungen zu wahren.
2.4. Die Familie als "Hauskirche"
Seit frühester Zeit legt die Kirche großes Gewicht auf die Verkündigung über die christliche Familie. Bereits gegen Ende des 4. Jahrhunderts nennt der heilige Johannes Chrysostomus die Familie eine "Kirche". Auch heute bezeichnen kirchliche Dokumente die christliche Familie als "Kirche im Haus" (LG 11), als "häusliches Heiligtum der Kirche" (AA 11) oder als "Kirche im kleinen" (FC 49). Sie ist in besonderer Weise Bild und Verwirklichung der "Gemeinschaft der Gläubigen mit Christus und untereinander in der Einheit der Kirche Gottes" (FC 21). Universale Kirche und Kirche im Haus sind zutiefst miteinander verbunden. Zwischen ihnen besteht ein Verhältnis gegenseitiger Belebung und Fruchtbarkeit.
Die Kirche hat eine Sendung für alle Menschen, auch für die Familie. Sie vermittelt ihr die Gemeinschaft mit Jesus Christus und gibt ihr eine christliche Orientierung.
- Durch die Verkündigung des Wortes Gottes zeigt die Kirche der christlichen Familie das, was sie nach dem Plan des Herrn ist und sein soll.
- Durch die Feier der Sakramente bereichert und bestärkt die Kirche die christliche Familie mit der Gnade Christi, damit sie heilig werde zur Ehre Gottes des Vaters.
- Die christliche Familie lebt ihre Gemeinschaft mit Gott in der Feier der Sakramente und im gemeinsamen Gebet. Sie muß sich immer ihrer religiösen Wurzeln vergewissern. Diese sind ihr geschenkt in Taufe und Firmung. Sie werden erneuert und belebt in der Feier der Eucharistie und im Empfang des Bußsakramentes. Eine besondere Chance und Verantwortung hat die Familie für die Vorbereitung auf den Empfang dieser Sakramente und für die Begleitung und Vertiefung der sakramentalen Praxis der Kinder und Jugendlichen. Weithin ist es üblich geworden, daß Familienkreise die Vorbereitung auf die Firmung übernehmen oder auch Mütter und Väter als Katecheten tätig werden. Auch das bewußte Mitgehen der Familie mit den Zeiten des Kirchenjahres ist für das Familienleben wichtig. Feste Bräuche vertiefen und festigen den Glauben.
Die christliche Familie soll ihren Glauben bezeugen. Die Ehegatten stärken einander im Glauben und geben den Glauben an ihre Kinder weiter. Das geschieht nicht in erster Linie durch Worte, sondern dadurch, daß das Evangelium ins Leben übersetzt und im Leben der Familie sichtbar wird. In einer Familie, die sich dieser Sendung bewußt ist, bezeugen alle Familienmitglieder einander das Evangelium. Die Eltern geben es an ihre Kinder weiter und können es von ihnen als gelebtes Evangelium empfangen. Wo das geschieht, wirkt die Familie auch verkündend auf andere Familien und auf das Milieu, in dem sie lebt (EN 71).
Diesen Verkündigungsauftrag haben auch Familien, die in einer religiös gemischten Ehe gründen. Ihnen kommt darüber hinaus die Aufgabe zu, auf die Einheit im Glauben hinzuwirken. Dazu braucht die Familie Beratung und Betreuung durch Seelsorger in der Glaubensunterweisung und in der Verkündigung der sittlichen Botschaft der Kirche. Auch die Familien selbst können einander stärken und beraten: in Familien- und Freundeskreisen wie in der Gemeinde. Das ist besonders dort erforderlich, "wo verbreiteter Unglaube oder eine uferlose Verweltlichung ein wirksames Wachstum im Glauben unmöglich machen" (FC 52). In solchen Lebensverhältnissen ist die Hauskirche oft der einzige Ort, an dem Kinder und Jugendliche Glaubensunterweisung erhalten und Glaubensleben erfahren. Die christliche Familie soll zum Dienst der Liebe an den Mitmenschen bereit sein. Der Auftrag, Zeugin der Liebe Jesu Christi zu sein, wird von der Familie überzeugend gelebt, indem sie Geborgenheit schenkt, kranke und alte Menschen betreut und die Werke der Barmherzigkeit übt. Im Leben aus dem neuen Gebot der Liebe soll die christliche Familie aufnahmebereit, ehrfurchtsvoll und hilfreich sein gegenüber allen Menschen. Sie soll jeden Menschen in seiner Würde als Person und als Kind Gottes achten.
Die Familie ist ein Lebensraum, in dem jene Einheit im Namen Jesu Christi lebendig sein kann, die seine Gegenwart mitten unter uns gewährleistet (vgl. Mt 18,20). Gerade hier wird Familie als Hauskirche sichtbar und wirksam.
Vom Leben der Familie kann und muß die Kirche die Maßstäbe gewinnen, um sich selbst als "Familie Gottes" zu erweisen. Sie muß eine mehr häusliche, familiäre Dimension erhalten und sich um einen menschlicheren und mehr geschwisterlichen Stil bemühen.
Die christlich gelebte Familie hat eine unersetzliche Bedeutung für die Kirche. Als Hauskirche bringt sie ihren Glauben, ihr Beten und ihr Handeln in die Gemeinschaft und in die Gesamtkirche ein und strahlt zugleich in die Welt aus.
3. Die Christen und die politische Gemeinschaft
3.1. Das christliche Evangelium und die politische Autorität
Das vierte Gebot lenkt unseren Blick über die Ordnung der Familie hinaus auf die politische Gemeinschaft, auf die Ausübung der politischen Macht und die Stellung der Menschen zur politischen Autorität.
Christen lebten und leben in unterschiedlichen politischen Verhältnissen. Welche Orientierungen gibt ihnen das Evangelium für ihre Einstellung zur politischen Gemeinschaft und für ihr Verhalten gegenüber der politischen Autorität?
Zur Zeit Jesu war das jüdische Volk der römischen Fremdherrschaft unterworfen; doch ließen die Römer dem jüdischen Staat eine gewisse Eigenständigkeit. Die Befreiung vom Römerjoch war der gemeinsame Wunsch aller Schichten und Gruppen im Volk, das sich allein der Herrschaft Gottes unterstellt wußte. Religiöses und politisches Streben waren eng miteinander verbunden; aber wie man sich zu dem heidnischen Staat verhalten sollte, wurde verschieden beantwortet. Am radikalsten waren die Zeloten ("Eiferer"), die mit Waffengewalt die Römerherrschaft abschütteln wollten. Auf der anderen Seite waren die hohenpriesterlichen Kreise (Sadduzäer) zur Zusammenarbeit mit den Römern bereit, während die Pharisäer die fremden Herren ertrugen, sich aber durch treue Gesetzeserfüllung Gott unterstellten und von ihm die Befreiung erwarteten.
Aus der Unruhe der Zeit und den verschiedenen politischen Bestrebungen muß man die Antwort Jesu auf die Frage nach der Steuer für den Kaiser, die jeder Jude zahlen mußte ("Kopfsteuer"), verstehen. Die Münze mit Bild und Aufschrift enthielt den Anspruch des Kaisers auf göttliche Verehrung. Darum lehnten die Zeloten die Steuer ab, andere waren, wenn auch widerwillig, bereit, sie zu zahlen. Jesus sollte mit der Frage, ob die Entrichtung der Steuer erlaubt sei, in eine Falle gelockt werden. Bejahte er sie, machte er in den Augen seiner Gegner seine Verkündigung der Gottesherrschaft unglaubwürdig; lehnte er sie ab, konnte er als Rebell gegen die kaiserliche Herrschaft angeklagt und verurteilt werden. Die Antwort Jesu: "Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört" (Mk 12,17), hat grundsätzliche Bedeutung. Jesus erkennt zwar das Recht des Staates auf das, was ihm gebührt, an, schränkt es aber auch durch die Oberhoheit Gottes ein. Er geht über die politische Fragestellung hinaus und proklamiert das Recht Gottes als das höhere. Darin liegt ein Vorbehalt gegen ungerechte Forderungen und Machtansprüche, in denen Gott mißachtet wird. Jesu Wort weist die Richtung, wie man sich gegenüber der Staatsgewalt verhalten soll, gibt aber keine für jede Situation gültigen Handlungsanweisungen. Sein Wort ist in langer Geschichte verschieden ausgelegt worden. Die unterschiedlichen Situationen verlangen jeweils neue konkrete Entscheidungen.
Der realistische Blick Jesu auf die bestehenden und weiterbestehenden Verhältnisse in der Welt und die Anweisung, wie sich die Jünger demgegenüber verhalten sollen, finden an einer anderen Stelle einen klaren Ausdruck. Gegen das Geltungsstreben, in dem auch die Jünger befangen sind, sagt er:
- "Ihr wißt, daß die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht mißbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein, und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein" (Mk 10,42-44).
Das ist das "Grundgesetz", das Jesus für die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern aufrichtet, die sich Gott unterstellen wollen. Das gegenseitige Dienen nach dem Vorbild Jesu (Mk 10,45) ist ein Gegenbild zu allem in der Welt herrschenden Machtstreben. Gott will, daß alle Menschen von Unterdrückung und Ungerechtigkeit befreit werden. Der von Jesus formulierte Grundsatz wird zur Herausforderung für irdisch-menschliches Denken und zur Anklage für jeden Staat, der seine Macht mißbraucht, welche konkrete Form er auch besitzt. Durch seine Verkündigung, die an der befreienden Herrschaft Gottes orientiert ist, relativiert Jesus jegliche Bindung an eine bestimmte irdische Herrschaftsform. Wo ein Staat seine Macht zum Nutzen aller ausübt, steht er im Dienst Gottes und darf Achtung und Gehorsam beanspruchen.
Paulus fordert in diesem Sinn die römischen Christen auf, sich den übergeordneten (staatlichen) Gewalten zu unterwerfen (Röm 13,1-7). "Denn es gibt keine staatliche Gewalt, die nicht von Gott stammt" (13,2). Die Bürger schulden der staatlichen Autorität Gehorsam, und zwar nicht allein aus Furcht vor Strafe, sondern auch um des Gewissens willen, da sie im Dienst Gottes steht (13,4f). Aber darin liegt zugleich ein Vorbehalt: Der Staat ist Gott verantwortlich und darf sich nicht absolut setzen. Seine Aufgabe ist es, die Guten zu schützen und die Übeltäter zu bestrafen. Überschreitet der Staat seine Kompetenz, so erlischt die Verpflichtung zum Gehorsam.
Der durchweg staatsbejahende Ton des Apostels an dieser Stelle kann befremden, wenn man seine Mahnung, sich "dieser Welt" nicht anzugleichen, bedenkt (Röm 12,2). Müßte er nicht auch vor dem Mißbrauch staatlicher Gewalt warnen? Aber der vielerörterte Text erklärt sich wahrscheinlich aus der Absicht des Apostels, die römische Gemeinde in ihrer Situation zu einem loyalen Verhalten trotz aller bürgerlichen Beengung (harte Steuern und Zölle) anzuhalten. Das Römische Reich galt als ein relativ verläßlicher Ordnungs- und Rechtsstaat. Die gleichen Mahnungen zur "Unterwerfung" unter menschliche Obrigkeit, zu Ehrfurcht und Gehorsam begegnen in 1 Petr 2,13-17, jedoch mit deutlicher Unterscheidung: "Erweist allen Menschen Ehre, liebt die Brüder, fürchtet Gott und ehrt den Kaiser" (2,17; vgl. auch Tit 3,1).
Wo staatliche Stellen ihre von Gott gesetzten Schranken überschritten, traten dem von Anfang an die Christen entgegen.
Sogar der Autorität des Synedriums, der obersten jüdischen Behörde unter Vorsitz des Hohenpriesters, haben sich die aus dem Judentum stammenden christlichen Verkündiger nicht gebeugt. Als dieses geistliche Gericht den Aposteln Petrus und Johannes verbot, im Namen Jesu zu predigen, antworteten sie: "Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, mehr auf euch zu hören als auf Gott" (Apg 4,19); "Man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen" (Apg 5,29). Scharf ablehnende Äußerungen tauchen im Zusammenhang der antiken Erhebung der Herrscher zu göttlicher Würde (Herrscherapotheose) auf. Die Jerusalemer Gemeinde sah das furchtbare Ende des Königs Herodes Agrippa I. als Strafe Gottes für seinen lästerlichen Anspruch an, ein Gott zu sein (Apg 12,19-23).
Zur Konfrontation kam es, als unter Kaiser Domitian (+ 96 n. Chr.) von Christen verlangt wurde, ihn als "Herrn und Gott" anzuerkennen. Die Johannesoffenbarung sieht die Selbstvergötzung dieses Herrschers als Angriff auf die Hoheit und Würde Gottes an und verbietet, diesen Kaiserkult mitzumachen. Ein Staat, der in gotteslästerlicher Weise seine Macht mißbraucht, ist für den Seher von gottwidrigen dämonischen Kräften beherrscht (vgl. dazu Offb 13,2). Ihm müssen die Christen widerstehen, ja bereit sein, in den Tod zu gehen (Offb 13,10).
In den verschiedenen Aussagen des Neuen Testamentes zeigt sich, daß die Einstellung der frühen Kirche zur politischen Macht unterschiedlich ist. Soweit sich die politische Obrigkeit nicht gegen das göttliche Recht wendet, leben die Christen als treue Bürger des Staates. Sobald aber die Staatsgewalt mißbraucht wird oder der Staat zum Unrechtsstaat wird, sehen sich die Christen verpflichtet, den Gehorsam zu verweigern. Immer steht die Autorität Gottes höher als die Autorität des Staates.
Im Verhalten der Christen zur weltlichen Macht erhält das Gebot der Feindesliebe besonderes Gewicht. Jesus fordert die Jünger auf, für diejenigen zu beten, die sie verfolgen (Mt 5,44; vgl. Lk 6,28). In den Pastoralbriefen werden die Christen ermahnt, für alle Menschen zu beten, auch für die Herrscher und für alle, die Macht ausüben (1 Tim 2,1f). Selbst in den Verfolgungen übten die Christen die Feindesliebe (Mt 5,44; vgl. Lk 6,28) und hörten nicht auf, für die Regierenden zu beten. Das älteste uns überlieferte Gebet dieser Art formulierte Clemens von Rom um 96 n. Chr.:
- "Gib, daß wir deinem allmächtigen und vortrefflichen Namen sowie unseren Herrschern und Vorgesetzten auf Erden gehorsam sind. Du, Herr, hast ihnen die Herrschergewalt gegeben durch deine erhabene und unbeschreibliche Macht . . .
- Lenke ihren Willen auf das, was gut und wohlgefällig ist vor dir, damit sie die von dir verliehene Macht in Frieden und Milde ausüben, gottesfürchtigen Sinnes, und so deiner Huld teilhaftig werden" (1 Clem 60,4 - 61,2).
3.2. Grundlagen und Ziele der modernen politischen Gemeinschaft
In den ersten Jahrhunderten der Kirche war die bestimmende Ordnungsgestalt des Politischen in der Umwelt des Christentums das "Imperium Romanum". In ihm beanspruchte der Kaiser göttliche Autorität und Verehrung. Nach der "Konstantinischen Wende" änderte sich die Situation der Christen grundsätzlich. Die christliche Religion wurde zur offiziellen Religion des Reiches.
Von dieser Zeit an hat das Verhältnis von christlichem Glauben und Politik eine Entwicklung genommen, die über die mittelalterliche Verflechtung von Kirche und politischer Gemeinschaft im "Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation" und dem nachreformatorischen Auseinanderbrechen der religiösen Einheit des Christentums zur Vorherrschaft des absolutistischen Staates und schließlich zum modernen souveränen Nationalstaat führte. Dieser ist in unterschiedlichen Staats- und Regierungsformen gegenwärtig die vorherrschende Ordnungsgestalt des Politischen.
Wesentliche Bedeutung für die Entwicklung zum modernen Staat hat die Menschenrechtsidee. Im freiheitlichen Rechtsstaat ist die frühere Ständeordnung aufgehoben. Es herrscht Gleichheit aller Bürger vor dem Recht. Die Gesellschaft ist pluralistisch. In ihr gibt es unterschiedliche Religionen und Weltanschauungen. Der Staat gewährleistet jedem einzelnen wie den in der Gesellschaft bestehenden religiösen Institutionen Religions- und Konfessionsfreiheit.
Allerdings bestehen auch in der Gegenwart in den Staatsauffassungen erhebliche Unterschiede, die sich dann auch auf das Verhältnis zu Religion, Glaube und Kirche auswirken. Es gibt Staaten, deren Verfassung zu Neutralität, nicht aber zu Indifferenz gegenüber Religion und Weltanschauung verpflichtet; und es gibt Staaten, die von einer Ideologie geprägt sind und trotz verfassungsmäßig garantierter Religions- und Glaubensfreiheit Anspruch auf den ganzen Menschen erheben.
Christen können zwar in jeder Art von politischer Gemeinschaft als Glaubende leben - auch als unterdrückte und schweigende Kirche -, aber es ist für Christen nicht gleichgültig, wie die politische Gemeinschaft und ihre Autorität begründet werden, wie diese mit den Menschen, mit der Menschenwürde und den Menschenrechten umgeht und ob sie die Religion anerkennt, unterdrückt oder bekämpft.
Zwar kann die Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden kein eigenes Mandat über die konkrete Gestaltung der politischen Gemeinschaft beanspruchen, aber ihre religiöse Botschaft drängt von ihrer inneren Dynamik darauf hin, daß sich das menschliche Zusammenleben auf menschliche Weise erfüllen kann.
Die katholische Kirche und die reformatorischen Kirchen gehen in ihrer Staatsauffassung von unterschiedlichen Ansätzen aus, die für das ökumenische Gespräch und das politische Handeln wichtig werden können.
Nach lutherischer Auffassung ist der Staat eine Setzung Gottes. Durch den Abfall von Gott sind die Menschen in Gefahr, sich selbstsüchtig zu vernichten und ins Chaos abzustürzen. Um die dämonischen Mächte des Verderbens nicht überhandnehmen zu lassen, hat Gott andere Mächte und Gewalten eingesetzt. Sie sollen der Erhaltung der Menschheit in der Welt dienen. Eine dieser Notverordnungen und Schutzmaßnahmen Gottes ist der Staat. Durch ihn will Gott seine Schöpfung gnädig erhalten. Damit ist die Würde des Staates in seiner Beschaffenheit als erhaltende Ordnung Gottes begründet. Diese Würde besitzt sogar noch der totalitäre Staat; aber sie ist bei ihm verdunkelt. Jeder Staat soll den Erhaltungswillen Gottes durchscheinen lassen und beständig für eine Verbesserung der Lebensverhältnisse sorgen. Da die Ordnung des Staates im Gesetz und Gebot Gottes gründet, muß der Staat ein Rechtsstaat sein. Träger des politischen Amtes sind alle, die im Staatsgefüge mitwirken. Im demokratischen Staat haben alle Bürger Anteil an der obrigkeitlichen Gewalt. Wer in ein leitendes Staatsamt berufen ist, vertritt nicht bestimmte Interessen oder eine Partei, sondern ist "Obrigkeit". Christen tragen im Staat Verantwortung, aber sie glorifizieren ihn nicht, noch zerstören sie ihn durch staatsfeindliches Verhalten.
Nach neuerer reformierter Auffassung kann der Staat nicht theologisch begründet werden. Seine Berechtigung (Legitimität) ergibt sich aus der Möglichkeit, die Bürger und ihre Interessen zu integrieren. Der Staat ist somit eine menschlich-weltliche Größe, ein bestimmter Aufgabenbereich menschlichen Handelns. Zwar handelt der Staat nach göttlicher Anordnung, aber er ist keine göttliche Ordnung (vgl. dazu: Evangelischer Erwachsenenkatechismus, 751f).
Die katholische Soziallehre geht in der Frage, wie die politische Gemeinschaft und ihre Autorität begründet werden und welche Prinzipien zu achten sind, davon aus, daß die von Gott geschaffene menschliche Person Ursprung und Ziel des gesellschaftlichen Lebens ist. Der Mensch ist ein gemeinschaftsbezogenes Wesen. Er ist auf die Gemeinschaft verwiesen und auf sie angewiesen. Sein Leben kann nur gelingen, wenn er mit anderen zusammenwirkt. Deshalb ist es notwendig, daß die Menschen über die kleineren Gruppen der Gesellschaft (Familien, private Vereinigungen, Verbände usw.) hinaus sich zu einem größeren Ganzen zusammenschließen. Die höchste und abschließende Gemeinschaftsform ist die politische Gemeinschaft. Ihre Aufgabe und ihr Ziel ist es, die rechte Verfaßtheit des gesellschaftlichen Lebens und die Voraussetzungen für die Lebensentfaltung aller Bürger zu gewährleisten, das heißt, das Gemeinwohl sicherzustellen. "Die politische Gemeinschaft besteht also um dieses Gemeinwohls willen; in ihm hat sie ihre letztgültige Rechtfertigung und ihren Sinn, aus ihm leitet sie ihr ursprüngliches Eigenrecht ab" (GS 74).
Das Gemeinwohl umfaßt "die Gesamtheit jener Bedingungen des gesellschaftlichen Lebens, die den Gruppen als auch den einzelnen Gliedern ein volleres und leichteres Erreichen der eigenen Vollendung ermöglichen" (GS 26; 74; MM 65; PT 58). Das Gemeinwohl ist somit nicht ein Eigenwert, der um seiner selbst willen anzustreben wäre, sondern es ist ein Dienstwert: Er schafft die gesellschaftlichen Vorbedingungen für die Werte, die von den einzelnen Personen gemeinsam zu verwirklichen sind. Gemeinwohl verweist somit auf einen Mindestbestand von Werten, den eine Gesellschaft unbedingt anerkennen muß, damit jeder einzelne, die Familien und die gesellschaftlichen Gruppen ihre eigene Vervollkommnung voller und ungehinderter erreichen können.
Damit ein Mindestbestand von Werten im gesellschaftlichen Leben durchgehalten und durchgesetzt werden kann, ist eine Gemeinwohl-Autorität erforderlich. Diese hat aber immer nur den Wert-Zielen der einzelnen und der gesellschaftlichen Gruppen zu dienen. Sie ist rückgebunden und rückzubinden an die Rechte und Pflichten der menschlichen Person, zu deren Wahrung und Förderung sie eingesetzt ist. Sie kann dieser Aufgabe nicht gerecht werden, wenn die Gesellschaft in widerstreitende Interessengruppen zerfällt und die Geltung der Grundwerte in Frage stellt. Sie verfehlt ihre Aufgabe, wenn sie selbst ihre Grenzen überschreitet und so die Würde der Person verletzt.
Leitprinzipien der politischen Gemeinschaft und der politischen Autorität sind somit die Personwürde als Grundprinzip und das Gemeinwohl als Zielprinzip. Dazu kommen als Ordnungsprinzipien der Gesellschaft das Solidaritäts- und das Subsidiaritätsprinzip.
Das Solidaritätsprinzip geht von dem Gedanken aus, daß die Menschen an die Gesellschaft gebunden sind und daß die Gesellschaft an das Wohl der Menschen rückgebunden ist. Solidarität ist somit das Baugesetz der menschlichen Gesellschaft. Aus diesem Gesetz erwächst sowohl die sittliche Pflicht der einzelnen Personen, ihre Kräfte zum Wohl des Ganzen einzusetzen, als auch die Pflicht der Gemeinschaft, zum Wohl der Menschen tätig zu werden.
Das Subsidiaritätsprinzip geht davon aus, daß die einzelnen und die kleineren Gruppen bemüht sein müssen, alles zu tun, was dazu dient, ihr Ziel zu erreichen. Es berücksichtigt aber auch die Tatsache, daß der einzelne oder kleinere Gruppen oft trotz großen Einsatzes nicht in der Lage sind, in angemessener Weise ihr Ziel zu erreichen. Sie bedürfen der Unterstützung (subsidium) durch größere oder übergeordnete Instanzen. Das Subsidiaritätsprinzip enthält für solche Situationen die Forderung, daß die jeweils größere Gruppe bzw. die Gesellschaft die einzelnen oder die kleineren Gruppen und Gemeinschaften zu unterstützen hat. Sie darf sie aber niemals zerschlagen oder aufsaugen (QA 97) und ihnen entziehen, was sie aus eigenen Kräften leisten können. Sie ist Hilfe zur Selbsthilfe.
Diese Prinzipien, die in der katholischen Gesellschaftslehre gegen Ende des 19. und Anfang der dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts formuliert wurden, sind heute allgemein anerkannt. Sie richten sich sowohl gegen die Einseitigkeiten des Individualismus wie des Kollektivismus.
Die Leitprinzipien und Ordnungsprinzipien geben aber nicht an, wie das gesellschaftliche Zusammenleben zu organisieren und zu regeln ist, das heißt, welche Staats- und Regierungsform jeweils zu wählen ist.
Geht man im Sinne der katholischen Soziallehre und der Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen davon aus, daß die menschliche Person Wurzelgrund, Träger und Ziel aller Institutionen ist (vgl. GS 25f; 63), dann entspricht dem Anspruch auf Gleichheit und Mitbestimmung am ehesten der freiheitliche Rechtsstaat mit einer demokratischen Ordnung und einer demokratisch gewählten Regierung. Die zum Staatsvolk vereinten Menschen haben darüber zu bestimmen, welche Regierungsform sie in ihrer konkreten Situation für richtig halten (vgl. GS 74). Das Zweite Vatikanische Konzil nimmt in seinen Aussagen zur politischen Gemeinschaft bewußt keine Stellung zur Frage nach der bestmöglichen Staatsform. Es betont ausdrücklich: "Die Kirche, die in keiner Weise hinsichtlich ihrer Aufgabe und Zuständigkeit mit der politischen Gemeinschaft verwechselt werden darf, noch auch an irgendein politisches System gebunden ist, ist zugleich Zeichen und Schutz der Transzendenz der menschlichen Person" (GS 76). Die Erfahrungen der Geschichte wie der Gegenwart zeigen, daß demokratische Regierungsformen am ehesten geeignet sind, jene gerechten Verhältnisse zu schaffen, die dem einzelnen wie der Gesamtgesellschaft entsprechen.
Bei einer realistischen Sicht der menschlichen Verfaßtheit darf man nicht übersehen, daß es auch in der Demokratie Gefahren für die Demokratie geben kann. Sie können zum Beispiel darin bestehen, daß versucht wird, Mehrheitsentscheidungen über Angelegenheiten zu erreichen, die nicht in die Zuständigkeit parlamentarischer Abstimmung fallen, sondern dem Gewissensbereich zugehören und sittliche Fragen betreffen. Eine Gefahr für die Demokratie entsteht auch, wenn Minderheiten mißachtet oder unterdrückt werden oder wenn Vertreter von Interessen ungerechten Druck auf die Parlamentarier ausüben.
Wirklich demokratische Machtausübung ist möglich, wenn die eine Herrschaft in mehrere Gewalten aufgeteilt ist. In der parlamentarischen Demokratie wählt das Staatsvolk als oberster Souverän die gesetzgebende (legislative) Gewalt. Diese setzt die vollziehende (exekutive) Gewalt ein und kontrolliert sie. Beide schaffen die Bedingungen für eine unabhängige richterliche (judiziale) Gewalt. Die einzelnen Gewalten begrenzen sich gegenseitig.
Vornehmste Aufgabe der staatlichen Gewalt ist es, die Grundrechte zu schützen. Diese werden den Bürgern nicht von der politischen Autorität gewährt, sondern sind als vorgegebene zu gewährleisten und politisch durchzusetzen.
Heute gibt es zunehmend weltweite Beziehungen und gegenseitige Abhängigkeiten aller Menschen und Völker. Es zeichnet sich immer mehr die Notwendigkeit ab, das Gemeinwohl nicht nur national, sondern universal zu begreifen und inhaltlich zu bestimmen, zumal durch Wirtschaft, Wissenschaft, Technik, Kommunikation usw. faktisch bereits eine "Weltgesellschaft" existiert. Seit Pius XII. haben die Päpste immer stärker auf die weltweite Zusammenarbeit der Staaten hingewiesen und ihre Verantwortung für die Völkergemeinschaft betont.
Für die heutigen Nationalstaaten stellt sich immer stärker die Frage nach ihrem Anspruch auf absolute Souveränität. Die meisten heutigen Nationalstaaten stellen zwar eine selbstorganisierte Gesellschaft dar, in welcher die staatliche Herrschaft demokratisch legitimiert ist; aber sie besitzen auf Grund der Einbindung in größere Gemeinschaften längst nicht mehr eine absolute Souveränität. In wirtschaftlicher, sozialer, politischer und kultureller Hinsicht kann es durchaus sinnvoll sein, wenn die Nationen in verschiedenen Bereichen einer eingeschränkten Souveränität zustimmen. Sie brauchen dabei keineswegs ihre Identität als Rechts- und Kulturgemeinschaft zu verlieren.
3.3. Glaube und Politik, Kirche und Staat
Lange Zeit war das Verhältnis der Kirche zur Demokratie nicht spannungsfrei. Die Entwicklung des Staates zum modernen säkularen Staat und vor allem zur freiheitlich rechtsstaatlichen Demokratie hat es ermöglicht, das Verhältnis von Glaube und Politik wie von Kirche und Staat unbefangener zu sehen als in früheren Zeiten.
Nachdem die Kirche zur freiheitlichen Demokratie ein positives Verhältnis gewann, konnte das Zweite Vatikanische Konzil (1965) über das Verhältnis von Kirche und Staat erklären:
- "Die politische Gemeinschaft und die Kirche sind auf je ihrem Gebiet voneinander unabhängig und autonom. Beide aber dienen, wenn auch in verschiedener Begründung, der persönlichen und gesellschaftlichen Berufung der gleichen Menschen. Diesen Dienst können beide zum Wohl aller um so wirksamer leisten, je mehr und besser sie rechtes Zusammenwirken miteinander pflegen; dabei sind jeweils die Umstände von Ort und Zeit zu berücksichtigen" (GS 76).
Der Kirche geht es um das Heil des Menschen in der Verherrlichung Gottes durch die Nachfolge Christi. Dieses Heil ist in der Gottesreichverkündigung, im Leben, Sterben und Auferstehen Jesu Christi grundgelegt, es ist "verborgen" und wird in seiner Vollgestalt erst bei der Wiederkunft Christi sichtbar werden. Weltgeschichte und Heilsprozeß sind miteinander verbunden, lassen sich aber nicht in ein den Menschen verfügbares innerweltliches System bringen. Einen "Gottesstaat" kann es auf Erden nicht geben. Darum liegt es auch nicht im Auftrag der Kirche, im Bereich von Politik und Wirtschaft irdische Verhältnisse zu planen und zu gestalten. Die Kirche trägt dazu bei, daß sich in der Gesellschaft Gerechtigkeit und Liebe entfalten, sie verkündet Grundsätze der Gerechtigkeit, und sie übt öffentliche Kritik, wenn politische Verhältnisse der Würde des Menschen widersprechen (vgl. GS 63; 76).
Die Kirche stellt aber kein politisches Aktionsprogramm auf. Die Sendung, die Christus ihr aufgetragen hat, und das Ziel, das er ihr gesetzt hat, gehören der religiösen Ordnung an (GS 42). Ihre Sendung unterscheidet sich klar vom Auftrag der Politik. Das geduldige "Harren auf die Vollendung der Kinder Gottes" (Röm 8,19) umfaßt aber auch "die Sorge für die Gestaltung der Erde" (GS 39). Die Kirche ist "Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit" (LG 1; vgl. GS 42). Indem sie den Glauben verkündet und die Glaubenden durch die Sakramente heiligt, verbindet sie die Menschen mit Gott. Daraus soll eine neue, menschlichere Weise des Zusammenlebens erwachsen. Ein wesentlicher Bereich, in dem der Christ als Staatsbürger diesem Anspruch gerecht werden soll, ist der Bereich des politischen Handelns. Der Christ darf sich nicht von der politischen Verantwortung dispensieren und aus Angst davor, "sich die Hände schmutzig zu machen", von der Politik fernhalten.
Für den freiheitlich demokratischen Rechtsstaat besteht heute die Gefahr, daß er zum technokratischen Wohlfahrts- oder Versorgungsstaat wird, in dem vorrangig materielle Werte gelten. Hier haben Christen mit allen Menschen guten Willens die Aufgabe, Kritik anzumelden und die Politiker auf ihre verfassungsmäßige Verpflichtung gegenüber den Grundrechten aufmerksam zu machen.
Wo politische Richtungen zu innerweltlichen Heilsbewegungen werden und den Versuch unternehmen, den Staat zur umfassenden, sinnentscheidenden Größe des menschlichen Daseins zu machen, sind Christen verpflichtet, humane Wertvorstellungen in die Gesellschaft einzubringen und zu verhindern, daß der Mensch zur bloßen Funktion von Staat und Gesellschaft wird.
Eine Politisierung aller Lebensbereiche stellt eine Verengung und Verkürzung des Menschlichen dar. Die Politik ist zwar eine anspruchsvolle, aber nicht die einzige Art, anderen zu dienen. Sie kann nicht alle Probleme lösen. Wo versucht wird, die Politik ohne Einschränkung in alle Bereiche eindringen zu lassen, wird sie zu einer großen Gefahr. Es ist Pflicht aller, durch politisches Handeln die Würde des Menschen zu sichern und die persönlichen und sozialen Rechte durchzusetzen. Politische Ordnung und politisches Handeln sollen das Gute ermöglichen und Gerechtigkeit verwirklichen.
Christen sind bereit, ihre Aufgaben als Staatsbürger verantwortlich zu erfüllen. Sie tragen das Gemeinwohl mit, zahlen Steuern, verhalten sich loyal gegenüber der politischen Gemeinschaft und den demokratisch gewählten Mitgliedern des Parlaments und akzeptieren Mehrheitsentscheidungen, die politischer Natur sind und die Gewissensüberzeugung respektieren. Ihre Aufgaben als Staatsbürger erschöpfen sich aber nicht darin, dem Staat jene Dienste zu leisten, die für das Gemeinwohl notwendig sind; sie sollen darüber hinaus darauf achten, daß der öffentlichen Autorität eine nicht zu umfangreiche Gewalt zugestanden wird, noch von ihr ungebührlich große Zuwendungen und Begünstigungen gefordert werden. Die Eigenverantwortung der einzelnen, der Familien und gesellschaftlichen Gruppen darf nicht gemindert werden.
Für Christen gilt die Weisung: "Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört" (Mk 12,17). Dieses Wort fordert dazu auf, der politischen Autorität zu geben, was ihr zusteht, aber auch nur das. Der Christ kann und darf Forderungen, die mit dem eigentlichen und letzten Ziel des Menschen unvereinbar sind, nicht seine Zustimmung geben. "Man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen" (Apg 5,29).
Diese Orientierung soll zu Einstellungen und Haltungen führen, die das Zusammenleben in der politischen Gemeinschaft stützen und fördern: Bereitschaft zur Mitverantwortung für den rechten Aufbau der Gesellschaft; Zivilcourage gegenüber gesellschaftlichen und politischen Richtungen, die unaufgebbare sittliche Werte zu untergraben suchen; Hilfsbereitschaft gegenüber Menschen und Gruppen, die in der Gesellschaft benachteiligt sind; Mitbeteiligung am Prozeß der öffentlichen Meinungsbildung und vieles mehr.
Christliche Hoffnung schließt Nüchternheit und Gelassenheit ein. Sie mißt dem politischen Handeln große Bedeutung bei, erwartet aber von ihm nicht die Erfüllung des letzten Zieles. Zwar ist die Welt für den Christen der Ort des zeitlichen Daseins, nicht aber seiner endgültigen Erfüllung. Doch darf er, wenn er politische Verantwortung aus Liebe zu den Menschen übernimmt, trotz aller möglichen Mißerfolge wissen: "Die Liebe wird bleiben wie das, was sie einst getan hat" (GS 39).
In der freiheitlichen Demokratie will der Staat Heimstätte für alle Bürger sein. Das stellt ihn auch vor die Aufgabe, nicht nur für den einzelnen das Grundrecht auf Religionsfreiheit anzuerkennen, sondern auch für die Kirchen und Religionsgemeinschaften. In vielen Staaten kommt den Kirchen die Religionsfreiheit als körperschaftliches Grundrecht zu. Sie sind "Körperschaften öffentlichen Rechts". Das Verhältnis von Staat und Kirche wird durch das Staatskirchenrecht und Vertragsrecht (Konkordate, Kirchenverträge) geregelt. Die Kirchen besitzen das kirchliche Selbstbestimmungsrecht mit allgemeiner Rechtsfähigkeit und eigenständiger Organisationsgewalt. Es besteht nicht nur die Freiheit der Kirche vom Staat und des Staates von der Kirche, sondern auch die Freiheit der Kirche im Staat. Trotz der Scheidung der jeweiligen Aufgabenbereiche von Staat und Kirche gibt es auch gemeinsame Aufgaben (zum Beispiel für Schulen, Krankenhäuser und andere Institutionen in freier Trägerschaft).
Der tiefere Hintergrund für die gewissermaßen "kirchenfreundliche" Einstellung des freiheitlichen Rechtsstaates ist die Überzeugung, daß die Kirche einen Öffentlichkeitsauftrag und ein Hüter- und Wächteramt im Staat hat. Sie vertritt als Anwalt des Menschen vor allem solche sittlichen Vorstellungen, die der Staat selbst nicht entwickeln kann, die aber zum Zusammenleben der Menschen und zur Ordnung der Gesellschaft unerläßlich sind (vgl. Gemeinsame Synode, Offizielle Gesamtausgabe II, 192). Wenn die Kirche gesellschaftlich bedeutsame Aufgaben übernimmt, muß sie darauf achten, daß in der Gesellschaft nicht der Eindruck entsteht, die Kirche sei nur solange notwendig, wie Staat und Gesellschaft nicht in der Lage seien, die von den Kirchen wahrgenommenen Aufgaben selbst zu erfüllen. Die Kirche ist nicht ein gesellschaftlicher Interessenverband. Ihre transzendente Dimension und ihr universaler Heilsanspruch übersteigen und umgreifen vielmehr alle Bedürfnisse und Interessen von Gesellschaft und Staat.
3.4. Protest und Widerspruch im freiheitlich demokratischen Staatm
In neuerer Zeit wächst die Zahl der Bürgerinitiativen gegen staatliche Gesetze, Anordnungen und Regelungen, die nach Überzeugung von einzelnen Bürgern oder Bürgergruppen gemeinwohlgefährdend bzw. gerechtigkeitsverletzend sind.
Um zu einer Klärung der Frage zu kommen, welche Formen von Protest und Widerspruch im freiheitlich demokratischen Staat vertretbar sind, ist zu beachten, daß im demokratischen Staat Herrschaftsausübung und Herrschaftskontrolle voneinander unabhängig und an das Recht gebunden sind. Die Rechtsordnung begrenzt sowohl die Handlungsfreiheit der politischen Gewalt wie auch die der Bürger. Bei Grenzüberschreitung oder Mißbrauch von Macht durch die Regierung stehen verschiedene Mittel der Verhinderung zur Verfügung: politische Opposition in Meinungs- und Pressefreiheit (Art. 5 GG), Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit (Art. 9 GG) sowie parlamentarische Opposition als Grundelement der parlamentarischen Demokratie. Bei vermuteten Unrechtsentscheidungen können Bürger und Bürgergruppen beim Verfassungsgericht eine Verfassungsklage einreichen, und die parlamentarische Opposition kann ein öffentliches politisches Verfahren fordern. Bei allen diesen Formen von politischer Opposition handelt es sich um legalen, durch den demokratischen Rechtsstaat gewährleisteten Widerspruch.
Als Kontroll- und Balancierungsinstrument können auch, sofern sie in einzelnen Verfassungen festgelegt sind, plebiszitäre Elemente (Volksbegehren, Volksentscheid) in gewissem Umfang eine Hilfe zur Korrektur von Entscheidungen sein.
Von diesen normalen Formen des Rechts auf Protest und Widerspruch ist das Recht auf Widerstand zu unterscheiden. Seinem Ursprung nach ist dieses Recht ein vorstaatliches Menschenrecht. Es ist der Anspruch auf ein Handeln außerhalb des Schutzes einer gegebenen staatlichen Rechtsordnung und ihrer Institutionen. In einem demokratischen Rechtsstaat kann es ein einforderbares Recht auf Widerstand mit dem Ziel, die demokratische Ordnung zu beseitigen, nicht geben.
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland schreibt ein Widerstandsrecht fest (Art. 20 Abs. 4). Dieses gilt allein für den denkbaren Fall, daß die freiheitliche Ordnung selbst bedroht ist: "Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn anders Abhilfe nicht möglich ist."
Ein eigenes Phänomen stellen in unserer Zeit die verschiedenen Formen von Protest und Widerspruch dar, die unter dem Begriff "ziviler Ungehorsam" zusammengefaßt werden.
Um zu klären, ob ziviler Ungehorsam in einer demokratischen Gesellschaft eine ethisch vertretbare Form von Protest sein kann, ist sorgfältig zu prüfen, was unter zivilem Ungehorsam zu verstehen ist, welches sein Ziel und seine Mittel sind und mit welchem moralischen Anspruch er auftritt. Der Normalfall des politischen Handelns ist in einer demokratischen Gesellschaft die Einhaltung der Regeln der parlamentarischen Demokratie und der staatlichen Gesetze. Unter dieser Rücksicht haben die Deutschen Bischöfe auch erklärt, daß demokratisch legitimierte Mehrheitsentscheidungen, die sich auf Gerechtigkeit und Recht berufen können, verlangen, gerade von Christen respektiert zu werden (vgl. GF 5.3.6.). Für den Fall, daß Entscheidungen von Politikern mit dem eigenen Urteil im Einzelfall nicht übereinstimmen, sind Gruppen und Initiativen, die Entscheidungen der Politiker als falsch empfinden, gehalten, die Methoden ihres Einspruchs oder Protests zu überprüfen. Sie werden gebeten, "Wege zu wählen, von denen sie begründet sagen können, daß sie gewaltfrei bleiben, den Grundwerten des Grundgesetzes verpflichtet sind und nicht zu gesetzwidrigen Handlungen führen" (ebd.).
In einer Ausnahmesituation, in der alle legalen Mittel des Protests und Widerspruchs ausgeschöpft sind und keine andere Möglichkeit bleibt, als durch einen gewaltlosen Akt des Ungehorsams den Widerspruch gegen staatliche Maßnahmen zum Ausdruck zu bringen, die nach gewissenhafter Prüfung als gemeinwohl- bzw. als gerechtigkeitsverletzend empfunden werden, ist ein Akt zivilen Ungehorsams (Rechtsverletzung) zwar illegal, er kann aber moralisch legitim sein. Ein solcher Akt zielt nicht auf die Aushöhlung und Untergrabung der demokratischen Ordnung, sondern auf ihre Erhaltung und Förderung. In einem solchen Akt zivilen Ungehorsams spiegelt sich das moralische Urteil wider, daß es gerechtfertigt sein kann, die Gesellschaft durch einen verschärften Widerspruch auf einen sonst nicht zu behebenden Mißstand aufmerksam zu machen. Die Ernsthaftigkeit der Überzeugung und des verfolgten Anliegens wird dadurch zum Ausdruck gebracht, daß die für den begangenen Gesetzesungehorsam auferlegten Sanktionen in Kauf genommen werden.
Bei alledem versteht sich von selbst, daß sich Akte zivilen Ungehorsams moralisch verbieten, sofern sie schwerwiegende Beeinträchtigungen der Freiheit anderer und ihrer legitimen Ansprüche enthalten.
Regierung und Parlament können sich durch solche Akte zivilen Ungehorsams herausgefordert sehen, Maßnahmen, die von einiger Tragweite für die Bevölkerung sind, zu überprüfen und zu versuchen, durch bessere Gesetze eine breitere Zustimmung zu bekommen. Es gehört zur politischen Kultur einer demokratischen Gesellschaft, daß sie Protest und Widerspruch in vielen Formen tolerieren kann.
Bürgerinitiativen, Protestbewegungen und organisierte Gruppen sind gehalten, sich bei Protesten gegen Maßnahmen der politischen Gewalten im Rahmen der demokratischen Rechtsordnung zu bewegen. Überschreiten sie diesen Rahmen, tragen sie dazu bei, gerade das zu bewirken, was sie verhindern wollen: die Bedrohung der Demokratie und des freiheitlich demokratischen Staates. Gewaltloser ziviler Ungehorsam muß der Ausnahmefall bleiben.
3.5. Widerstand gegen ungerechte Gewalt
Die Frage nach dem Recht auf Widerstand gegen die Staatsgewalt ist nicht neu. Im Mittelalter stellte sie sich im Zusammenhang mit dem Widerstand gegen die Herrschaft von Tyrannen. Thomas von Aquin (+ 1274) und andere Theologen unterschieden zwischen einem Herrscher, der die Macht unrechtmäßig an sich gerissen hat (Usurpator) und die Macht mißbraucht, und einem Herrscher, der legitim an die Macht gekommen ist, aber durch Machtmißbrauch zum Tyrannen geworden ist. Viele Theologen rechtfertigten den Widerstand gegen Tyrannen und hielten unter bestimmten Voraussetzungen sogar die Tötung des Tyrannen (sogenannter Tyrannenmord) für erlaubt.
In diesem Sinne betont der Katechismus der Katholischen Kirche: "Bewaffneter Widerstand gegen Unterdrückung durch die staatliche Gewalt ist nur dann berechtigt, wenn gleichzeitig die folgenden Bedingungen erfüllt sind: (1) daß nach sicherem Wissen Grundrechte schwerwiegend und andauernd verletzt werden; (2) daß alle anderen Hilfsmittel erschöpft sind; (3) daß dadurch nicht noch schlimmere Unordnung entsteht; (4) daß begründete Aussicht auf Erfolg besteht und (5) daß vernünftigerweise keine besseren Lösungen abzusehen sind" (2243).
In der neueren deutschen Geschichte tauchte die Frage nach dem Recht auf Widerstand gegen die Staatsgewalt im Zusammenhang mit dem Widerstand gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft auf. Hier gab es eine Vielzahl von Aktionen (zum Beispiel der Weißen Rose, der Roten Kapelle) bis hin zum gescheiterten Attentatsversuch vom 20. Juli 1944. Da im totalitären Staat des Nationalsozialismus politischer Widerspruch durch politische und parlamentarische Opposition nicht möglich war, hatten die Aktionen eher den Charakter des Zeugnisses bzw. Bekenntnisses. Aus bekennenden und betenden Gruppen erwuchs auch der friedliche Widerstand, der in den totalitären sozialistischen Staaten schließlich zur grundsätzlichen Wende führte.
Ähnlich stellt sich die Frage nach dem Recht auf Widerstand dort, wo Völkern von ihren Regierungen Grundrechte vorenthalten oder wo Völkern oder große Bevölkerungsteile durch "ungerechte Strukturen" unterdrückt und ausgebeutet werden.
In vielen Ländern der Erde sind die Völker heute nicht mehr bereit, die bestehenden Verhältnisse in ihren Ländern als unabänderliches Schicksal hinzunehmen, zumal ungerechte Strukturen, die Unterdrückung, Analphabetentum, Verwahrlosung, Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung bewirken, von der Verantwortung des Menschen abhängen und auch von ihm verändert werden können.
Manche Völker verstehen deshalb ihren Widerstand gegen bestehende Strukturen als Mittel zur Befreiung von ungerechten Strukturen und Systemen, in welche persönliches ungerechtes Verhalten, Korruption, Verschwendung, Machtstreben und Menschenverachtung eingeflossen sind, so daß diese selbst gewissermaßen zu "sozialen Sünden" geworden sind (vgl. RP 16). Manche der in den letzten Jahrzehnten entstandenen Befreiungsbewegungen streben nach gewaltsamer Veränderung durch Revolution. Andere wollen Veränderungen durch Reformen erreichen. Wieder andere, besonders in den christlichen Basisgemeinden, suchen, ausgehend von einer Theologie der Befreiung und einer besonderen "Option für die Armen", in solidarischer Hilfe Not und Armut zu mildern und mit unterschiedlichen Mitteln eine Änderung der Strukturen, Institutionen und Systeme zu erreichen.
Die Theologie der Befreiung geht von der Frage aus, wie man angesichts des unermeßlichen Leidens der Armen in den lateinamerikanischen Ländern von der Liebe Gottes und von seiner Zuwendung zu den Armen sprechen und in solidarischer Hilfe dieses Leiden überwinden kann. Das sind die Grundmotive der Befreiungstheologie. Die lateinamerikanische Bischofskonferenz machte sich auf ihrer Generalversammlung 1968 in Medellin mit der "vorrangigen Option für die Armen" eine grundlegende Einsicht der Befreiungstheologie zu eigen. Papst Paul VI. wies darauf hin, daß man die Begriffe der Befreiung und des Heils in einem richtig verstandenen Sinne gleichwerten kann: "Das Wort Befreiung verdient also einen Platz im christlichen Wortschatz nicht nur wegen seiner Ausdruckskraft, sondern um des tiefer liegenden Inhalts willen" (Ansprache vom 31. 7. 1974). Papst Johannes Paul II. spricht ausdrücklich von der lateinamerikanischen Theologie, die die Befreiung zur Grundkategorie und zum Handlungsprinzip für die Lösung der Probleme des Elends und der Unterentwicklung erhebt (vgl. SRS 46). - Die bewegende Kraft der Botschaft, daß Erlösung auf befreiende Praxis zielt, hat zu einem Aufbruch geführt, der eine Veränderung der menschenunwürdigen Verhältnisse herbeiführen will. - In der Frage, wie Gottes Heil und Reich sich im Befreiungsprozeß verwirklichen muß, nehmen die Befreiungstheologen unterschiedliche Positionen ein; ihre lehrmäßigen Grenzen sind nicht genau abgesteckt. Damit verbundene Konflikte werden von denen, die aus der gegenwärtigen Unrechtssituation Nutzen ziehen, bewußt angeheizt, um Christen, die in Basisgemeinden arbeiten, zu diffamieren und ihre Tätigkeit zu erschweren.
Nach kirchlicher Lehre ist es "vollauf berechtigt, daß diejenigen, die an der Unterdrückung durch die Besitzer des Reichtums oder der politischen Macht leiden, sich mit moralisch erlaubten Mitteln dafür einsetzen, Strukturen und Institutionen zu erlangen, in denen ihre Rechte wirklich respektiert werden" (Instruktion der Kongregation für die Glaubenslehre über die christliche Freiheit und Befreiung vom 22. 3. 1986, 75f).
Das sittliche Urteil darüber, welche Mittel und Wege für das konkrete Handeln in solchen bedrängenden Situationen erlaubt sein können, muß sich immer an der menschlichen Würde und der menschlichen Freiheit ausrichten. Denn es gibt keine wirkliche Befreiung, wenn nicht von Anfang an die Freiheitsrechte respektiert werden.
Darüber hinaus ist zu bedenken, daß das Gebot der Nächstenliebe unvereinbar ist mit dem Haß gegen andere, sei es als Einzelperson oder als Gemeinschaft. Befreiung im Geist des Evangeliums läßt deshalb den Schluß zu, daß jemand Widerstand als Befreiung von ungerechter Gewalt nur in der Form des gewaltlosen Widerstands für gerechtfertigt hält. Im gewaltlosen Widerstand kann jemand Zeugnis dafür ablegen, daß nur die Liebe zu wahrer Freiheit führt, während Gewalt immer neue Gewalt mit sich bringt.
Als weiterer Weg ist auch an Gewaltlosigkeit als Strategie zu denken, wie sie in der neueren Geschichte zum Beispiel Mahatma Gandhi und Martin Luther King beispielhaft vorgelebt haben. Ob dieser Weg zum Erfolg führt, hängt allerdings in hohem Maß davon ab, ob die Herrschenden fähig und bereit sind, die Unrechtsverhältnisse zu ändern.
Einer (mit Waffengewalt vorgenommenen) Revolution als Weg der Befreiung von ungerechter Gewalt ist jede Art von Reform der Strukturen und Institutionen der Vorzug zu geben, zumal die Revolutionen unserer Zeit zumeist mit Ideologien verknüpft sind und nach kurzer Zeit neue Unterdrückung und Mißachtung der Menschenrechte mit sich bringen.
Wird ein Volk so geknechtet, daß ein gewaltloser Widerstand keine Änderung herbeiführt, kann das Recht auf gewaltsamen Widerstand als äußerste Möglichkeit in Anspruch genommen werden, aber nur, wenn keine andere Möglichkeit (zum Beispiel passiver Widerstand) mehr besteht, sich von der unerträglichen Gewaltherrschaft zu befreien.
Von dieser äußersten Möglichkeit spricht Papst Paul VI. in der Enzyklika "Populorum progressio" (31), wo es heißt, daß der bewaffnete Kampf als letzter Ausweg gerechtfertigt sein könnte, "um einer eindeutigen und lange andauernden Gewaltherrschaft, die die Grundrechte der Person schwer verletzt und dem Gemeinwohl des Landes ernsten Schaden zufügt", ein Ende zu setzen. Dagegen wird ein "systematischer Rückgriff auf Gewalt, der als angeblich notwendiger Weg zur Befreiung hingestellt wird", von der Kongregation für die Glaubenslehre als "eine zerstörerische Illusion angeprangert . . ., die den Weg zu neuer Knechtschaft eröffnet" (Instruktion über die christliche Freiheit und Befreiung, 76).
Heute sind alle Staaten und die Kirche aufgefordert, dazu beizutragen, daß in keinem Land der Erde Situationen entstehen, in denen unerträgliche Gewaltherrschaft die Menschen dazu zwingt, sich mit Mitteln zu befreien, die ihnen zutiefst widerstreben.
4. Die Christen und ihre Kirche
4.1. Allgemeine Pflicht, das kirchliche Leben zu fördern
Im Apostolischen Glaubensbekenntnis beten wir: "Ich glaube (an) die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche."
Viele Christen begegnen ihrer Kirche heute mit Vorbehalten und kritischer Distanz. Sie identifizieren sich nur teilweise mit ihrer Kirche. Man kann jedoch Jesus Christus und die Kirche nicht einfach trennen. Jesus Christus hat uns verheißen, daß er durch den Heiligen Geist bleibend bei seiner Kirche ist (vgl. Mt 28,20; Lk 24,49; Apg 1,8) und daß die Mächte der Unterwelt sie nicht überwältigen (Mt 16,18). So ist die Kirche ein vom Heiligen Geist gewirktes und belebtes "Mysterium"; andererseits ist sie als das "neue Volk Gottes" eine sichtbare Gemeinschaft. Sie ist nach Gottes Willen "in dieser Welt als Gesellschaft verfaßt und geordnet" (LG 8). "Die mit hierarchischen Organen ausgestattete Gesellschaft und der geheimnisvolle Leib Christi, die sichtbare Versammlung und die geistliche Gemeinschaft, die irdische Kirche und die mit himmlischen Gaben beschenkte Kirche sind nicht als zwei verschiedene Größen zu betrachten, sondern bilden eine einzige komplexe Wirklichkeit, die aus menschlichem und göttlichem Element zusammenwächst" (LG 8).
Die drei Grundaufgaben der Kirche sind: Verkündigung des Evangeliums, Feier der Eucharistie und der anderen Sakramente, Dienst der christlichen Liebe. Kurz zusammengefaßt bedeutet das: Glauben, Danken, Dienen. Wenn die Kirche diesen Auftrag in der Welt erfüllen soll, müssen sich alle, die zu ihr gehören, diesen Aufgaben stellen.
Für den heiligen Paulus ist es Pflicht eines jeden Gläubigen, nach seinen Fähigkeiten am Aufbau der kirchlichen Gemeinschaft mitzuwirken. Der Apostel vergleicht die Kirche in der Welt gern mit einem Gebäude, das sich noch im Aufbau befindet. So schreibt er an die römische Gemeinde: "Jeder von uns soll Rücksicht auf den Nächsten nehmen, um Gutes zu tun und (die Gemeinde) aufzubauen" (Röm 15,2). Und nach Korinth schreibt er: "Gebt euch Mühe, daß ihr vor allem zum Aufbau der Gemeinde beitragt . . . Alles geschehe so, daß es aufbaut" (1 Kor 14,12.26). Wenn der Apostel an dieser Stelle zunächst die Ordnung der gottesdienstlichen Versammlung in Korinth im Auge hat, so spricht er damit doch eine grundsätzliche Weisung aus: Alle haben zusammenzuwirken, daß die Kirche erstarkt und die ihr vom Herrn zugewiesene Aufgabe erfüllen kann. Alle sind darum für das Leben der Kirche mitverantwortlich.
Diese Pflicht beschränkt sich nicht auf die Zustimmung zu dem von der Kirche verkündeten Glauben; sie umfaßt auch den in der kirchlichen Gemeinschaft gelebten Glauben. Die Teilnahme am Leben der Kirche spielt sich auf den verschiedenen Ebenen ab, auf denen Kirche als sichtbare Gemeinschaft in Erscheinung tritt: in der Gemeinde, in der Diözese (Ortskirche) und in der Weltkirche. Sie geschieht in vielfältigen Formen: durch das Zeugnis des Glaubens im Alltag, in der Familie oder vor der Gemeinde und durch Mitverantwortung für die Weitergabe des Glaubens, durch die tätige Teilnahme am Gottesdienst, durch seelsorgerliche und caritative Dienste.
Die Formen des Einsatzes sind vielfältig: Mitarbeit, Beratung, Übernahme von Diensten und Ämtern, Gebet und Opfer, finanzielle Beiträge (vgl. GL 67,5). Nicht zuletzt tragen ein christliches Leben in Ehe und Familie, welche eine Art Hauskirche ist (LG 11), und die christliche Erziehung der Kinder zur Auferbauung der Kirche bei.
Eine besondere Weise kirchlicher Mitarbeit stellen die Gremien der Mitverantwortung dar, zum Beispiel Pfarrgemeinderat, Diözesanrat oder Priesterrat sowie Kirchenverwaltung bzw. Kirchensteuerräte. Für die Gestaltung des kirchlichen Lebens sind Verbände, Gruppen und geistliche Bewegungen bedeutsam. Solche Zusammenschlüsse sollen das Leben in Kirche und Welt mitgestalten. Sie sind eine wichtige Form, wie die Kirche der Welt nahe ist und wie sie an den Problemen, Ängsten und Sorgen der Menschen teilnimmt. Durch sie vollzieht sie auch Evangelisierung und Inkulturation.
4.2. Aufgabe der kirchlichen Autorität
Die vielfältigen Tätigkeiten, in denen sich das Leben der Kirche äußert, rufen nach einer ordnenden Hand. Als Gemeinschaft von Menschen mit vielen Fähigkeiten und Neigungen, aber auch mit Fehlern und Schwächen braucht sie eine Ordnung und eine Autorität, die dafür Sorge trägt, daß das Gemeinwohl der Kirche gewahrt bleibt.
>Das Neue Testament berichtet davon, daß selbst unter denen, die Jesus nachgefolgt sind, Eifersucht, falscher Ehrgeiz, Kleingläubigkeit und Verrat vorgekommen sind. Auch in der Urgemeinde gab es schwere Verfehlungen gegen die Wahrheit und die Liebe. Die neutestamentlichen Briefe schildern die frühen christlichen Gemeinden mit Fehlern und Schwächen. Für eine judenchristliche Gemeinde ist im Neuen Testament eine Disziplinregel für einen sündigenden Bruder bezeugt. Zuerst soll eine brüderliche Zurechtweisung unter vier Augen erfolgen. Wenn der Sünder nicht darauf hört, sollen ein oder zwei Brüder hinzugezogen werden; wenn er auch darauf nicht hört, soll er vor die versammelte Gemeinde (die Ekklesia) gebracht werden; wenn er selbst dann hartnäckig bleibt, soll er aus der Gemeinde ausgeschlossen werden (Mt 18,15-17).
Auch Paulus sah sich in der heidenchristlichen Gemeinde von Korinth veranlaßt, gegen ein Gemeindemitglied vorzugehen, das sich durch eine schwere sittliche Schuld (Blutschande) versündigt hatte. Paulus fordert die Gemeinde auf, in Übereinstimmung mit seinem eigenen Urteil den Übeltäter aus der Gemeinde auszuschließen (1 Kor 5,1-13).
Diese neutestamentlichen Zeugnisse machen deutlich, daß die Freiheit der Kinder Gottes nicht "gesetzlos" ist. Die Verkündigung und Bezeugung des Glaubens, die Gestaltung des sittlichen Lebens und das Zusammenleben in der Gemeinschaft brauchen Regelungen.
Seit frühester Zeit gibt es in der Kirche die Festlegung von Glaubenswahrheiten sowie die Orientierung des christlichen Lebens in ethischen und rechtlichen Regeln. Diese Praxis der Kirche, neben Glaubenswahrheiten auch Orientierungen für das sittliche Verhalten festzustellen und Rechtsregeln aufzustellen, ist begründet im Lehr- und Hirtenamt.
Die Aufgabe, durch rechtliche Regelungen für das Gemeinwohl der Kirche Sorge zu tragen, legt der Kirche eine große Verantwortung auf. Sie hat auch für ihren Bereich jene Regel zu beachten, die das Zweite Vatikanische Konzil in der Erklärung über die Religionsfreiheit für jede Gesellschaft einschärft. Es "soll in der Gesellschaft eine ungeschmälerte Freiheit walten, wonach dem Menschen ein möglichst weiter Freiheitsraum zuerkannt werden muß, und sie darf nur eingeschränkt werden, wann und soweit es notwendig ist" (DH 7).
Wenn eine kirchliche Vorschrift ihren Sinn nicht mehr erfüllt und nicht mehr dem Aufbau der kirchlichen Gemeinschaft dient, ist sie - vorausgesetzt, daß sie nicht zur unaufgebbaren Substanz des Glaubens gehört - durch die zuständige Autorität zu ändern bzw. aufzuheben.
Wer sich kirchlichen Geboten und Weisungen versagt und meint, er könne sich eigenmächtig über sie hinwegsetzen, mißachtet nicht nur die der Kirche verliehene Vollmacht, sondern schadet ihrem Gemeinwohl.
4.3. Gebote der Kirche
Wie jede Gemeinschaft, muß auch die Kirche ihr Gemeinschaftsleben ordnen. Sie tut dies im Hinblick auf die Erfüllung ihrer Sendung. Unter den Weisungen und Normen des christlichen Lebens gibt es einige, die ein Mindestmaß der Teilnahme am Leben der Kirche sichern wollen. Aus Predigt, Katechese und Beichtpraxis haben sich seit dem Mittelalter die sogenannten "Gebote der Kirche" herausgebildet, die für alle Katholiken gelten. In ihnen werden Pflichten des Christen konkreter gefaßt und verbindlich vorgeschrieben. So wird zum Beispiel die allgemeine Verpflichtung zur Gottesverehrung durch das Sonntagsgebot näher bestimmt.
Der katholische Christ ist verpflichtet, den Sonntag als "Tag des Herrn" zu heiligen, indem er sich jener Tätigkeiten enthält, die den Gottesdienst, die dem Sonntag eigene Freude oder die Geist und Körper geschuldete Erholung stören (CIC, can. 1247; vgl. die Ausführungen zum dritten Gebot).
Die Eucharistiefeier ist die vornehmste Aufgabe der Kirche und jeder ihrer Gemeinden. Diese Grundverpflichtung kann die Kirche nur erfüllen, wenn ihre Mitglieder regelmäßig die sonntägliche Eucharistie mitfeiern. Darum sind die Gläubigen verpflichtet, am Sonntag und an den anderen gebotenen Feiertagen die heilige Messe mitzufeiern (vgl. CIC, can. 1247). Das Versäumen der sonntäglichen Eucharistiefeier ohne schwerwiegenden Grund ist eine ernsthafte Verfehlung vor Gott und der Gemeinde. Wer sich ohne Grund immer wieder der sonntäglichen Eucharistiefeier entzieht, steht in schwerem Widerspruch zu dem, was er der Kirche als getauftes und gefirmtes Mitglied schuldig ist, und er weist damit zugleich undankbar das Angebot Gottes zurück (vgl. GL 67,2; vgl. das dritte Gebot).
Die Kirche hat die Aufgabe, die Gläubigen zur Nachfolge Jesu anzuleiten, der uns am Karfreitag durch sein Leiden und Sterben am Kreuz erlöst hat. Die Freitage des Jahres, auf die nicht ein hohes Fest fällt, sollen darum besonders im Hinblick auf Jesu Tod durch ein Freitagsopfer ausgezeichnet werden. Dazu schreiben die Deutschen Bischöfe in der Ordnung zur kirchlichen Bußpraxis vom 24. 11. 1986: "Alle Freitage des Jahres sind im Gedenken an das Leiden und Sterben des Herrn kirchliche Bußtage, an denen der Christ zu einem Freitagsopfer verpflichtet ist. . . . Zum Freitagsopfer ist jeder Katholik vom vollendeten 14. Lebensjahr bis zum Lebensende verpflichtet. Das Freitagsgebot kann verschiedene Formen annehmen: Verzicht auf Fleischspeisen, der nach wie vor sinnvoll und angemessen ist, spürbare Einschränkung im Konsum, besonders bei Genußmitteln, Dienste und Hilfeleistungen für den Nächsten." In ähnlicher Weise sollen die Gläubigen die jährliche Fastenzeit, auch österliche Bußzeit genannt, begehen, indem sie sich durch Werke der Buße und der Nächstenliebe auf das Osterfest vorbereiten. Der Aschermittwoch und der Karfreitag sind als Bußtage besonders hervorgehoben. Die Gläubigen fasten an diesen Tagen und halten Abstinenz, das heißt, sie verzichten auf Fleischspeisen. "Das Abstinenzgebot verpflichtet alle, die das vierzehnte Lebensjahr vollendet haben; das Fastengebot verpflichtet alle Volljährigen bis zum Beginn des sechzigsten Lebensjahres" (CIC, can. 1252). Dies alles sind Zeichen unserer Verbundenheit mit dem leidenden Herrn und den leidenden Mitmenschen. Sie sind ein Weg zur Freiheit und zur Freude (GL 67,3). "Jeder Gläubige ist, nachdem er zur heiligsten Eucharistie geführt worden ist, verpflichtet, wenigstens einmal im Jahr die heilige Kommunion zu empfangen." Dies soll in der österlichen Zeit geschehen (CIC, can. 920). Denn an Ostern feiert die Kirche das große Fest der Erlösung: den Tod und die Auferstehung des Herrn, an denen wir durch die Sakramente Anteil erhalten. Darum soll der Christ wenigstens in der Osterzeit in voller Weise an der Eucharistiefeier teilnehmen, indem er auch zum Tisch des Herrn geht.
Nach einer guten Vorbereitung in der Fastenzeit soll jeder Christ, möglichst in der österlichen Zeit, die Vergebung der Schuld im Bußsakrament erbitten und sein Verhältnis zu Gott und den Menschen neu ordnen (GL 67,4).
Außer den Geboten der Kirche im strengen Sinn gilt die allgemeine Weisung: "Hilf der Kirche und deiner Gemeinde!" Dazu gehört auch, daß die Gläubigen je nach ihren Möglichkeiten das Leben und die Aufgaben der Kirche finanziell unterstützen (vgl. CIC, can. 222 1). Die kirchliche Autorität kann dazu um des Gemeinwohls und der gerechten Verteilung willen verbindliche Regelungen treffen (vgl. CIC, can. 1260 und 1262), wie dies in Deutschland durch die geschichtlich gewordene Kirchensteuer geschieht (vgl. CIC, can. 1263).
Der Christ, der seine Kirche liebt, sieht in kirchlichen Verlautbarungen, Stellungnahmen und Anordnungen keineswegs "Befehle von oben". Er ist nicht einfach Befehlsempfänger, sondern er ist zur Mitwirkung am Gemeinwohl der Kirche berufen und soll dabei kritisch und konstruktiv sein. Das entspricht der gemeinsamen Würde und Sendung aller Christen. Alle sind in der Communio der Kirche mit unterschiedlichen, aufeinander bezogenen Ämtern, Diensten, Charismen und Begabungen zu der einen Sendung der Kirche berufen, in der Kraft ihres Herrn dem Heil der Welt zu dienen und sie zu ihrer eschatologischen Vollendung zu führen.
Das Zweite Vatikanische Konzil ruft die Gläubigen dazu auf, diese unterschiedlichen Ausfaltungen der einen Sendung wahrzunehmen:
- "Mit der Freiheit und dem Vertrauen, wie es den Kindern Gottes und den Brüdern in Christus ansteht", sollen die Laien den geweihten Hirten "ihre Bedürfnisse und Wünsche" eröffnen. "Entsprechend dem Wissen, der Zuständigkeit und hervorragenden Stellung, die sie einnehmen, haben sie die Möglichkeit, bisweilen auch die Pflicht, ihre Meinung in dem, was das Wohl der Kirche angeht, zu erklären" (LG 37).
Kirchlichkeit als unverzichtbare christliche Grundhaltung schließt eine ganze Reihe unterschiedlicher, manchmal auch miteinander in einem Spannungsverhältnis stehender Einstellungen und Grundhaltungen ein. Kritik an der Kirche und Liebe zur Kirche sind nicht einfach Widersprüche. Kritik an der Kirche als "Geheimnis des Glaubens" kann es nicht geben, wohl aber an der Kirche als Gesellschaft. Dabei ist allerdings zu beachten, daß beide nicht voneinander getrennt werden können, sondern nach Gottes Willen eine "komplexe Wirklichkeit" darstellen. Immer gibt es Anlaß, die Kirche zu "reformieren". Immer aber ist die Kirche zugleich die Braut Christi, die durch den Beistand des Heiligen Geistes gewiß ist, daß sie nicht ihre Sendung verlieren kann, den Menschen den Zugang zum Heil in Jesus Christus offenzuhalten.
V. Fünftes Gebot: Du sollst nicht töten
Ich bin dein Gott, der dir Leben und Zukunft schenkt Du sollst nicht töten
Gott will, daß wir das Leben schützen und Leid abwenden.
1. Wert und Würde des menschlichen Lebens
1.1. Der Wortlaut des Gebotes
Der Wortlaut des fünften Gebotes ist in den beiden Textfassungen des Dekalogs gleich:
- "Du sollst nicht morden" (Ex 20,13; Dtn 5,17).
In den heutigen Katechismen weicht die Formulierung des fünften Gebotes von der Bibelübersetzung des alttestamentlichen Textes ab. Der Grund dafür, daß die Bibel von "morden" anstelle von "töten" spricht, ist darin zu sehen, daß das entsprechende hebräische Wort nicht "töten" im Sinne von Tötung überhaupt meint, sondern rechtswidriges Töten. Es zielt in erster Linie auf den Mord, schließt aber auch die fahrlässige Tötung ein (vgl. zum Ganzen KKK 2258-2330).
1.2. Der Sinn des Gebotes
Im fünften Gebot spiegelt sich in Israel die Überzeugung wider, daß Leben etwas Wertvolles und Heiliges ist. Das gilt insbesondere für das menschliche Leben, denn der Mensch ist Abbild Gottes. Darin besteht sein Wert und seine Würde. Über ihn dürfen andere nicht eigenmächtig verfügen. Wer gegen das menschliche Leben verstößt, wird schwer bestraft: 5b>"Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut wird durch Menschen vergossen. Denn: als Abbild Gottes hat er den Menschen gemacht" (Gen 9,6). Das vorsätzliche Auslöschen des Lebens eines Mitmenschen wird als "zum Himmel schreiende" Sünde angesehen (Gen 4,10). Für sie wurde die Todesstrafe ausgesprochen, von der sich der Mörder durch keinerlei Ersatzleistung loskaufen konnte (vgl. Num 35,25). Gerade an dieser schweren Sanktion der Gemeinschaft wird die Achtung vor dem Gott des Lebens offenbar.
In der Frühzeit Israels wurde das Verbot des rechtswidrigen Tötens streng gehandhabt. Wer gegen dieses Verbot verstieß, mußte mit dem gleichen Maß an Vergeltung rechnen, wie das Maß des Verbrechens war. Das Verbot des Mordens hatte eine individuelle und eine soziale Bedeutung. Es wollte den Wert jedes einzelnen Menschenlebens in seiner Gottebenbildlichkeit herausstellen und zugleich die Erhaltung des sozialen Ordnungsgefüges schützen.
Als Israel zu einem festen seßhaften Verband und zu einem Staatswesen geworden war, wurde die strenge Handhabung des Gesetzes zum Teil aufgehoben. Es entstanden Unterschiede in der Bewertung der Reichen und der Armen, es gab Unterdrückte und Ausgebeutete, Freie und Sklaven. Die Rechtssprechung bewertete das menschliche Leben ungleich. Das Tötungsverbot verlor seine Geltung als Schutz für jeden einzelnen und wurde vielfach aufgeweicht. Der Grund für diese Entwicklung ist darin zu sehen, daß Israel den ursprünglichen Sinn des befreienden Heilshandelns Gottes an seinem Volk und an jedem einzelnen Menschen aus den Augen verloren hatte.
Die Propheten haben Israel - über den Buchstaben des Mordverbotes hinaus - mit dem "gottgewollten Geist" des Tötungsverbotes vertraut gemacht. Leben bedeutet biblisch mehr als bloßes Existieren, es meint ein menschenwürdiges Dasein.
Darum ist für die Propheten bereits jede Art von schwerer wirtschaftlicher Ausbeutung und rechtlicher und sozialer Unterdrückung von Menschen durch Menschen "Blutschuld" (vgl. Hos 4,2; Jes 1,15.17; Mi 3,10; Ez 9,9). Deshalb werden die "Leuteschinder" von Jerusalem und Juda mit den Worten angeklagt: "Sie fressen mein Volk auf, sie ziehen den Leuten die Haut ab und zerbrechen ihnen die Knochen. Sie zerlegen sie wie Fleisch für den Kochtopf, wie Braten für die Pfanne" (Mi 3,3).
Jede Handlung, die einen Mitmenschen zu einer verfügbaren Sache degradiert, liegt für die Propheten auf der Linie zum Mord an ihm. Wer tötet, stellt sich in den Dienst des Todes. Dadurch bringt er nicht nur menschliches Leben zu Tode, sondern vergeht sich gegen den lebendigen und lebenspendenden Gott, der allein Herr über Leben und Tod ist.
Dies lehrt an vielen Stellen auch das Neue Testament. Jeder Mensch ist in seinen Rechten, vor allem im Recht auf Leib und Leben, zu achten und zu schützen. Deutlicher wird das in der Fürsorge Gottes für die Schöpfung und hier besonders für die Menschen (Mt 6,24-32): Gott ist Herr und Erhalter des Lebens (vgl. Mt 10,29-31).
Mordgelüste steigen aus den Herzen der Menschen auf (Mk 7,21; Mt 15,19); solche Taten gehören zu den verwerflichen Handlungen, die von Paulus (Röm 1,29) verurteilt werden. Sie gehören zu den Zeichen der schrecklichen Zeit vor dem Ende, in der Gottlosigkeit und Mord herrschen (vgl. Offb 9,21).
Die Achtung vor dem leiblichen Leben des Menschen ist noch tiefer darin begründet, daß der Mensch zur Teilhabe am Leben Gottes berufen ist. Das Leben des Menschen steht für Jesus so hoch, daß das Sabbatgebot nicht nur in Todesgefahr, sondern schon bei einem körperlichen Leiden nicht mehr verpflichtet (Mk 3,4f). Das irdische Leben ist auf das Leben mit Gott hingeordnet (vgl. Mt 8,36f; Lk 12,19f), es kann in der Nachfolge Jesu geopfert werden (Mk 8,35 par.; Mt 10,28). Die Lebenszeit ist Zeit der Bewährung im Dienst an den Menschen und in guten Werken (Hebr 6,10; Jak 3,13; Offb 14,13). "Wie er, der euch berufen hat, heilig ist, so soll auch euer ganzes Leben heilig werden" (1 Petr 1,15).
Diese Einschätzung schließt - im Blick auf Gott als den "Gott der Lebenden" (Mk 12,27) - die Ehrfurcht vor dem Leben, das Recht auf Leben und den Schutz des Lebens ein.
1.3. Tötungsverbot und Liebesgebot
Auf den ersten Blick erscheint uns das Tötungsverbot als ein "Grenzgebot". Es gibt die Grenze an, die im Verhalten zum Mitmenschen nicht überschritten werden darf. Wer über diese Grenze hinausgeht, bringt den Tod und holt sich dadurch selbst den Tod: den Tod der Todsünde.
Der positive Sinn des fünften Gebotes ist das Ja des Menschen zum Mitmenschen, das im Ja des Menschen zu Gott und im Ja Gottes zum Menschen gründet.
Nach dem Alten Testament ist das "Ja zu Jahwe" nur dann ein vollgültiges Ja, wenn es sich mit Gott der Welt und den Menschen zukehrt. Ja zu Gott und Ja zum Menschen bilden das Fundament dessen, was die Bibel Liebe nennt. Darum faßt das Deuteronomium gleich nach der Verkündigung des Dekalogs (Dtn 5) die Grundforderung des "Ja zu Gott" in die Formel: "Höre, Israel! Jahwe, unser Gott, Jahwe ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft" (6,4f). Im Gebot der Gottesliebe ist auch die Nächstenliebe angesprochen (vgl. Dtn 5,14f; 14,28-15,7; 16,18-20; 19,16-21). Ihre ausdrückliche Formulierung lautet: "Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst" (Lev 19,18). Das gilt auch gegenüber den Fremden (vgl. Lev 19,33f). Diese Offenbarung des göttlichen Willens wird beim Propheten Micha so zusammengefaßt: "Es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet: Nichts anderes als dies: Recht tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott" (6,8). In dieser prophetischen Formulierung sind mitmenschliche Gerechtigkeit, Nächstenliebe und Gottesliebe aufs engste miteinander verbunden, und dies gerade in der Perspektive, die das Wort "Gerechtigkeit" für das fünfte Gebot eröffnet. Hier wird das Gebot auf das Mitdenken, Mitfühlen und Mithandeln mit den Mitmenschen hin gedeutet. "Liebe will ich, nicht Schlachtopfer, Gotteserkenntnis statt Brandopfer" (Hos 6,6).
Kennzeichnend für dieses Gottesgebot sind die Aussagen: "So spricht der Herr der Heere: Haltet gerechtes Gericht, jeder zeige seinem Bruder gegenüber Güte und Erbarmen; unterdrückt nicht die Witwen und Waisen, die Fremden und Armen, und plant in euren Herzen nichts Böses gegeneinander" (Sach 7,9f). "Nein, das ist ein Fasten, wie ich es liebe: die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, die Versklavten freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen, an die Hungrigen dein Brot auszuteilen, die obdachlosen Armen ins Haus aufzunehmen, wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden und dich deinen Verwandten nicht zu entziehen" (Jes 58,6f).
Was in den alttestamentlichen Geboten der Gottes- und Nächstenliebe (Dtn 6,4f; Lev 19,18) als Offenbarung des göttlichen Willens verkündet wird und was die Propheten auf das konkrete soziale Tun beziehen, wird in Jesus und seiner Botschaft eindrucksvoll bestätigt und überboten. Er, der die "Gerechtigkeit Gottes" ist und die Botschaft von der Gerechtigkeit Gottes als liebendes Erbarmen bringt, fordert, das Wort des Propheten Hosea (6,6) aufgreifend: "Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer" (Mt 9,13; 12,7).
Jesus spricht nicht nur deutliche Worte über den kaltblütigen Mord und die Ungerechtigkeit, über die Rücksichtslosigkeit des unbarmherzigen Schuldners (Mt 18,23-35) und über die Herzenshärte derer, die den Halbtoten am Straßenrand liegenlassen (Lk 10,29-37), sondern erweitert auch den allgemeinen Rahmen des Tötungsverbotes. Nicht erst im physischen Totschlag, sondern schon im Zorn und im bösen Wort ist der Tatbestand des Tötens erfüllt: "Ihr habt gehört, daß zu den Alten gesagt worden ist: Du sollst nicht töten; wer aber jemand tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch: Jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein" (Mt 5,21). Wer einen Mitmenschen haßt, setzt ihn in seinem Wert herab und mißachtet seine Würde: "Jeder, der seinen ruder haßt, ist ein Mörder, und ihr wißt: Kein Mörder hat ewiges Leben, das in ihm bleibt" (1 Joh 3,15).
Das Gebot, nicht zu töten, nicht zu zürnen, nicht zu hassen, hat seinen letzten Grund im Liebesgebot als dem einen Hauptgebot, an dem alle anderen Gesetze hängen:
- "Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den Propheten" (Mt 22,37-40).
Jesus dehnt dieses Gebot auf alle Menschen aus, auch auf die Feinde (Mt 5,44). Er fordert nicht nur die innere Gesinnung des Wohlwollens, sondern auch das konkrete Wohltun. Nächstenliebe äußert sich bei Jesus selbst in der besonderen Zuwendung zu den Armen, Schwachen, Benachteiligten und Kranken. Nach der Gerichtsrede Jesu (Mt 25) hängt die Entscheidung über Heil oder Unheil davon ab, ob wir diese Liebe in die Tat, in die "Werke der Barmherzigkeit" umgesetzt haben, von denen Jesus sagt, daß alle den Menschen erwiesene Barmherzigkeit ihm selbst erwiesen sei.
- "Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan . . . Was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan" (Mt 25,40.45).
1.4 Das fünfte Gebot in unserer Zeit
Seit der frühen Formulierung des fünften Gebotes im Dekalog, seiner Deutung in der Geschichte des Alten Bundes und seiner Überbietung in der christlichen Botschaft der Liebe ist das fünfte Gebot in immer neue sozio-kulturelle Verhältnisse hinein verkündet worden. Dementsprechend ist es auch ausgelegt und angewendet worden. Im Lauf der Geschichte gab es Auslegungen, die dem eigentlichen Sinn der christlichen Orientierung nicht entsprachen. Trotz solcher Fehldeutungen und Irrtümer hat die befreiende Botschaft von Gott als Gott des Lebens und von Jesus Christus als Erlöser zum Leben in der Geschichte der Menschheit wie ein Sauerteig gewirkt und das Bewußtsein der Menschen für den unvergleichlichen Wert und die Würde des Lebens bestärkt und vertieft.
In diesem Wachstumsprozeß ist immer stärker der positive Sinn des fünften Gebotes hervorgetreten. Das von allen Menschen anerkannte Gebot "Du sollst nicht töten" wandelt sich unter dem Einfluß der christlichen Verkündigung und unter der neuzeitlichen Wende zum Menschen in die Orientierung: "Bewahre das Leben." Diese positive Orientierung betrifft die Menschheit in der gewandelten Welt der Gegenwart in einer Dringlichkeit, wie sie in früheren Zeiten nicht in den Blick kommen konnte. Wissenschaftliche, technische, wirtschaftliche und politische Möglichkeiten haben die Größe, aber auch die Grenzen und Gefährdungen des menschlichen Lebens und seiner Welt deutlicher werden lassen als je zuvor. Die Verantwortung des Menschen erstreckt sich auf das eigene Leben in all seinen Bezügen, auf das Leben der anderen von Anfang bis Ende, auf das friedliche Zusammenleben in der Gesellschaft, der Nationen und der Völker und auf die Bewahrung der Schöpfung.
So ist das fünfte Gebot ein zugleich individuelles und soziales Gebot. Es ist nicht nur ein Ruf und eine kritische Anfrage an die Einstellungen und Haltungen jedes einzelnen Menschen, sondern auch an die von Menschen geschaffenen Strukturen, Organisationen und gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse. In alledem geht es um menschenwürdige und menschengerechte Bewahrung und Förderung des Lebens.
2. Entfaltung und Gestaltung des Lebens
2.1. Entfaltung des leiblich-geistigen Lebens
Unser Ja zum Leben, unsere Liebe zum Leben und unsere Ehrfurcht vor unserem Leben stellen uns immer wieder vor die Frage, wie wir das Leben entfalten und gestalten sollen. Manche Auffassungen vom Menschen werden der Verantwortung für das Leben nicht gerecht. Entweder überschätzen sie das Leiblich-Körperliche bis zur Leibvergötzung, oder sie würdigen es herab bis zur Leibverachtung.
In biblisch-christlicher Sicht ist der Mensch als leiblich verfaßte Existenz immer zugleich seelisch-geistige Wirklichkeit: personale Existenz. Der Mensch ist "in Leib und Seele einer" (GS 14). Wenn das Leben auch "nicht der Güter höchstes" ist, so ist es doch das fundamentalste aller Güter. Deshalb ist das leibliche Leben nicht freiverfügbarer Besitz des Menschen, sondern es ist ihm als gottgeschenktes Gut anvertraut: Wir sind für unser Leben und für die Förderung unserer leiblichen und seelisch-geistigen Kräfte mitverantwortlich.
2.2. Erhaltung und Förderung der Gesundheit
Ein wesentliches Moment dieser Verantwortung ist die Erhaltung und Förderung der Gesundheit. Gesundheit steht heute auf der Werteskala an hoher Stelle. Oft ist es erst die Erfahrung einer Krankheit, die uns den Wert der Gesundheit erkennen läßt; mehr und mehr aber sind es auch die Bedrohungen, die mit dem Verlust der Gesundheit auf uns zukommen: Schwinden der Leistungskraft, Verlust der Arbeitsfähigkeit, Abbruch sozialer Beziehungen und vieles mehr.
Die Bemühung um die Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung der Gesundheit ist eine wichtige Aufgabe des einzelnen wie der Gesellschaft. Doch müssen dabei das rechte Maß und die rechte Ordnung gewahrt werden. Körperpflege, Erholung, Freizeitgestaltung und Sport dienen der Erhaltung und Förderung der Gesundheit. Sie sind, sofern sie sinnvoll in das Leben eingeordnet werden, sittlich richtig und gut, denn die Gesundheit hat für die Persönlichkeitsentfaltung und für die Erfüllung der Aufgaben in der Welt hohen Wert.
Gesundheit ist aber nicht das höchste Gut des Menschen. Vielmehr geht es um das Glück des Menschen und das Gelingen seines Lebens als Ganzem - auch im Hinblick auf seine Beziehung zu Gott. Das ist jedem einzelnen auf seine Weise möglich: dem Gesunden, dem Kranken und Behinderten, der ganz der Zuwendung anderer anvertraut ist. Zu solchem Gelingen gehört nicht nur die Sorge um die körperliche Gesundheit, sondern auch das Bemühen, die gemüthaften und seelisch-geistigen Kräfte zu entfalten und sie in die religiöse Dimension einzubinden. Arbeit und Muße, Bildung und Kunst, aktives und beschauliches Leben, Feier und Kult sind so in das Ganze des Lebens einzuordnen, daß es zu einem humanen Lebensvollzug werden kann.
Die Überzeugung, daß letztlich nicht eigene Qualitäten, sondern Gottes Annahme und Berufung dem Menschen Gottebenbildlichkeit und dadurch seine Würde verleihen, muß sich gerade gegenüber dem behinderten Menschen bewähren. Körperliche, seelische und geistige Behinderungen sind ein Teil unserer Lebenswirklichkeit. Unsere Pfarrgemeinden sind im Gottesdienst, in der Caritas und in verschiedenen Gruppen Begegnungsort und Lebensfeld der Christen, zu denen sich alle eingeladen wissen dürfen. Am wenigsten sollten Behinderte und ihre Angehörigen sich als übersehen und ausgeschlossen erfahren. Es gehört zum Dienst einer christlichen Gemeinde, Behinderte und ihre Angehörigen anzunehmen und zu unterstützen.
In der heutigen Gesellschaft herrschen Leistungsdruck und Leistungszwang. Da können Gesundheit und Leistungsfähigkeit auch zu einer Forderung der Gesellschaft an den einzelnen werden. Durch Urlaub, Sport, Freizeit, Kuren, Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsfürsorge soll Gesundheit erhalten, Krankheiten vorgebeugt und zu neuer Leistung befähigt werden. Wo nicht der Mensch selbst im Mittelpunkt steht, kann Gesundheit zur geforderten Dienstleistung werden. Auch Sport kann zum Leistungs- und Spitzensport werden, in dem es weniger um Gesundheit als um Geld und Ansehen geht. Dabei wird manchmal die Gesundheit ruiniert, vor allem wenn Dopingmittel eingesetzt werden.
3. Gefährdung von Gesundheit und Leben
3.1. Medikamente, Alkohol, Drogen
In der Gesellschaft steigt die Zahl der Menschen, denen es nicht gelingt, sich mit der Wirklichkeit auseinanderzusetzen, Grenzen anzunehmen, Konfliktsituationen zu bewältigen und humane Wertvorstellungen zu verwirklichen. Befindlichkeitsstörungen, Druck der Umgebung, Wunsch nach Steigerung der Leistungs- und Erlebnisfähigkeit, Sehnsucht nach Ungebundenheit und Selbstverfügung, aber auch Gewöhnung und Verführung tragen dazu bei, daß sie von Medikamenten, Alkohol und Drogen abhängig werden. Dadurch suchen sie Leidensdruck zu vermindern, fehlenden Sinn durch Rausch zu ersetzen und in eine Traumwelt zu flüchten. Wer unter Drogeneinfluß steht, lebt in einer Scheinwelt. Die Folgen sind verheerend: Er wird abhängig von Beruhigungs- und Suchtmitteln, die sozialen Bezüge engen sich zunehmend ein, er wird einsam und kontaktlos, seine Persönlichkeit erleidet einen Abbau, und nicht selten ergibt sich, wenn finanzielle Beschaffungsprobleme entstehen, ein Zwang zu kriminellen Handlungen. Letztes Stadium des "Selbstmords auf Raten" durch "harte" Drogen ist die Selbstzerstörung. Rauschgiftkonsum beschert das Gegenteil von dem, was er verheißt.
In vielen Ländern sind Alkoholismus, Medikamenten- und Drogenabhängigkeit ein ungelöstes Dauerproblem. Es wird noch dadurch verschärft, daß gewissenlose Drogenhändler für die Verbreitung von Suchtmitteln sorgen.
Für die sittliche Bewertung des Umgangs mit Medikamenten, Alkohol und Drogen ist zu beachten, daß manche Genußmittel durchaus zur Förderung der Geselligkeit dienen und daß manche Drogen zur ärztlichen Behandlung von Kranken angewendet werden. In dem Maße jedoch, wie bestimmte Mittel denjenigen, der sie als Rauschmittel einnimmt, in einen Zustand versetzen, in dem er nicht mehr Herr über seine geistigen Fähigkeiten ist, ist ihr Genuß verwerflich. Auch bei Mitteln, die seelisch oder körperlich abhängig machen und zur Schwächung und Zerstörung der sittlichen Persönlichkeit und ihrer Freiheit führen, ist der Genuß oder die Anwendung sittlich nicht vertretbar. Es gehört zu den Voraussetzungen der Sinnerfüllung des Lebens, daß sich jeder bemüht, seine eigenen Grenzen zu sehen und Maßhaltung oder Verzicht zu üben.
Manchen, die abhängig geworden sind, gelingt es, sich aus einer Sucht (etwa Spiel-, Nikotin-, Eßsucht) mit eigener Kraft zu befreien. Andere suchen in Selbsthilfegruppen Erfahrungen auszutauschen, sich gegenseitig in dem Willen zur Abgewöhnung zu stärken oder bei Freunden Rat zu holen. Wieder andere nehmen eine unter ärztlicher Kontrolle durchgeführte Therapie auf sich. Doch bleibt auch eine große Zahl von Menschen immer abhängig oder wird nach einer Zeit der Abgewöhnung wieder rückfällig.
In der Vorbeugung gegen eine Gefährdung durch Alkohol, Nikotin und Drogen kommt in erster Linie der Familie große Bedeutung zu. Die beste Vorbeugung gegen Suchtprobleme ist ein Familienleben, in dem die Eltern für ihre Kinder Zeit haben, aufkommende Konflikte ehrlich austragen und eine vertraute Atmosphäre schaffen. Wo sie feststellen, daß ihre Kinder suchtgefährdet oder in eine schwere Abhängigkeit geraten sind, ist es nötig, sich helfen zu lassen, bei Fachleuten Rat zu holen und nötigenfalls einer Therapie zuzustimmen. Hierbei kann die Trennung vom Elternhaus und von der gewohnten Umgebung unausweichlich sein.
Ein geeigneter Raum für die Vorbeugung und Bekämpfung des Drogenproblems ist auch die Schule. Hier sind die Lehrenden von ihrem Bildungsauftrag her verpflichtet, sachliche Information über Drogen und Drogenmißbrauch zu bieten. Wo sie bei einem Jugendlichen eine Suchtgefährdung erkennen, sollen sie auf den Betroffenen zugehen, mit ihm über seine Probleme sprechen und sich für ihn einsetzen. Vielfach sind Jugendliche froh, wenn sie in einem Lehrer, zu dem sie Vertrauen haben, einen Ansprechpartner finden, der bereit ist, ihnen zu helfen.
Zur Aufgabe des Staates gehört es, das Zusammenleben in der Gesellschaft durch die Garantie der Grundfreiheiten und Grundrechte zu ermöglichen; darüber hinaus hat er auch sozialschädliches Verhalten zu verhindern. Da Drogenmißbrauch zu asozialem Verhalten, Arbeitsausfall, Kriminalität, Diebstahl und hohen Behandlungskosten führt, greift der Staat zu strafrechtlichen Maßnahmen. Er stellt Gewinnung, Herstellung, Beförderung, Verteilung, Verkauf und Erwerb von Rauschgiftsubstanzen unter Strafe. Da das sozialschädliche Verhalten der Händler wie der Konsumenten nicht allein durch Strafmaßnahmen beseitigt werden kann, muß sich die Aufmerksamkeit der Verantwortlichen in Staat und Gesellschaft verstärkt auf den Abbau der Ursachen des Drogenmißbrauchs richten. Das kann durch Bildungs- und Familienpolitik, durch Unterstützung der Suchtforschung und durch großzügige Förderung von Beratungs- und Therapieeinrichtungen geschehen.
Die christlichen Kirchen suchen dem Drogenproblem durch vielfache Aktivitäten zu begegnen. In Jugendgruppen, Familienkreisen, Begegnungen von Betroffenen und Beratungszentren werden nicht nur Informationen angeboten, sondern es werden auch die vielfachen Ursachen der Sucht angesprochen und Hilfen angeboten. Im christlichen Glauben kann eine Hoffnung vermittelt werden, die aus Angst, Verzweiflung und Scheitern befreit. Diese Hoffnung ist in Jesus Gestalt geworden. Wo lebendige Gemeinden sich am Evangelium und am Leben Jesu Christi orientieren, können Kinder und junge Menschen in ein Vertrauen zum Leben hineinwachsen. Christliche Gemeinden finden in der Begegnung mit Christus ein Gespür für die Zuwendung zu denen, die in der Gesellschaft leider als Außenseiter diskriminiert werden. Christliche Nächstenliebe nimmt sich in der Nachfolge Christi besonders derer an, die gestrauchelt oder gescheitert sind und selbst keinen Ausweg aus der Not finden. Sie erweist dem Abhängigen das, was er selbst in seinem Leben vielleicht nie erfahren hat: bedingungslose Liebe.
3.2. Aids
Eine neuartige Gefährdung von Gesundheit und Leben ist die durch Viren übertragene Immunschwäche Aids. Die Übertragung geschieht vorwiegend auf dem Weg geschlechtlicher Kontakte, durch von Immunschwäche-Viren infiziertes Blut, durch mehrfachen Gebrauch von Injektionsspritzen, die solche Viren enthalten, oder durch Übertragung von Viren von der schwangeren Mutter auf ihr ungeborenes Kind. Die nach kürzerer oder längerer Zeit ausbrechenden Krankheiten führen bei Infizierten, solange kein wirksames Gegenmittel zur Verfügung steht, zum Tod des Erkrankten.
Als Anfang der achtziger Jahre das verstärkte Auftreten von Aids bekannt wurde, entstand in der Öffentlichkeit eine breite Diskussion. Manche sehen in Aids eine Strafe Gottes für ein unmoralisches Leben. Jesus wehrt die Vorstellung ab, daß Krankheit Strafe Gottes sei (vgl. Joh 9,1-4). Es ist zwar richtig, daß die Immunschwäche Aids in vielen Fällen ihren Ursprung in einem unmoralischen Leben hat und insofern als Auswirkung dieses unmoralischen Lebens bezeichnet werden kann. Die Rede von Aids als Strafe Gottes kann aber mißverstanden werden und sogar von einem falschen Gottesbild ausgehen und dazu beitragen, daß Personen, die von Aids betroffen sind, diskriminiert und in die Isolierung getrieben werden.
In ethischer Hinsicht sind im Zusammenhang mit der Immunschwäche Aids mehrere Aspekte zu beachten. Die Immunschwäche Aids betrifft sowohl das verantwortliche Handeln des einzelnen wie der Gesellschaft.
- Für Personen, die nicht ausschließen können, daß bei ihnen möglicherweise eine Übertragung von Aids-Viren vorliegt, besteht die sittliche Verpflichtung, alles zu unterlassen, was zu einer möglichen Weitergabe einer Infektion führt.
- Besonders für Personen, bei denen eine Infektion feststeht, besteht die sittliche Verpflichtung, alles zu tun, um eine Ansteckung anderer zu verhindern. Dazu gehören verantwortungsbewußtes Handeln im sexuellen Bereich, Vermeidung der Übertragung durch Schwangerschaft und Unterlassung von Handlungen, durch die infiziertes Blut auf andere übertragen wird.
- Für Personen, bei denen bereits eine schwere Erkrankung ausgebrochen ist, besteht die Verpflichtung, dafür zu sorgen, daß nicht andere Menschen fahrlässig oder gewollt mit Aids-Viren infiziert werden.
- Für die Gesunden besteht zum einen die sittliche Pflicht, alle Handlungen zu unterlassen, wodurch sie sich eine Aids-Infektion zuziehen könnten. Sie sind zum andern dazu aufgerufen, Infizierten und Erkrankten nicht mit moralischer Ächtung oder Diskriminierung zu begegnen. Christliche Solidarität orientiert sich am Beispiel Jesu, der im Erbarmen mit den einzelnen Menschen auch bei Vorliegen von Schuld und Sünde sich aller erbarmt und ihnen beisteht.
- Angesichts der Gefahr einer Verbreitung von Aids besteht für die Gesellschaft die Verpflichtung, durch Vorsorge Schaden abzuwenden und den Kranken Hilfe und Schutz zu gewähren.
Außer dem individual- und sozialethischen Aspekt der Gefährdung von Gesundheit und Leben ist in der Aids-Problematik auch der sexualethische Aspekt zu beachten. Gegenwärtig wird Aids vor allem auf sexuellem Wege weitergegeben. Deshalb kann die Frage nach der verantwortlichen Gestaltung der Sexualität nicht ausgeklammert werden (vgl. zu diesem Aspekt von Aids die Ausführungen zum sechsten Gebot).
Im Hinblick auf die Gefahren und Bedrohungen, die mit Aids verbunden sind, sind alle Verantwortlichen in Gesellschaft und Kirche aufgerufen, die Öffentlichkeit richtig und vollständig über Aids zu informieren, auf den Ernst der Gefährdungen aufmerksam zu machen, aber andererseits auch unmotivierte Ängste im Umgang mit Infizierten und Erkrankten auszuräumen. Eltern, Lehrenden und Erziehern kommt die schwierige Aufgabe zu, in der Krise der Werte die Erziehung der Jugend so zu gestalten, daß die Jugendlichen in Fragen der Sexualität Einstellungen und Haltungen entwickeln können, die von der Achtung vor sich selbst und vor den anderen getragen sind. Die Jugendlichen selbst sind aufgerufen, verantwortliche Lebensstile und Formen der Solidarität mit dem Partner einzuüben, die der sittlichen Orientierung des sechsten Gebotes entsprechen.
Für alle Menschen, ob Jugendliche oder Erwachsene, gilt im Hinblick auf die Bedrohung durch Aids die Goldene Regel: "Was du nicht willst, daß man dir tu, das füg auch keinem andern zu!", sowie das Gebot der Nächstenliebe, das insbesondere zum Dienst an denen aufruft, die leiden. Solche Liebe kann denen, die an der Unabänderlichkeit ihres Schicksals leiden, ein Zeugnis der christlichen Hoffnung sein, daß das Leben letztlich über den Tod triumphiert. "Solange mir Gott die Stimme läßt, werde ich gegen den Lebenswandel, der zu Aids führt, auftreten, und solange mir Gott die Kraft gibt, werde ich die Aidskranken pflegen mit der Liebe, die er mir gibt" (Mutter Teresa).
3.3. Selbsttötung
Selbsttötung (lateinisch: suicidium) als Akt, durch den sich ein Mensch das Leben nimmt, gibt es bei allen Völkern und zu allen Zeiten. Immer stellte sich die Frage, ob es sittlich erlaubt sein kann, um höherer Güter willen das Übel der Lebensvernichtung nicht nur hinzunehmen, sondern es durch Selbsttötung direkt zu verursachen. Ist Selbsttötung in jedem Fall ein ethisch abzulehnender Selbstmord? Sind wir nicht grundsätzlich berechtigt, freiwillig aus dem Leben zu gehen?
Heute mehren sich die Stimmen, die vom Recht auf den Tod und von Freiheit zum Tod sprechen. Sie sagen: Der Mensch ist das Wesen der Freiheit. Er gehört sich selbst und ist folglich auch berechtigt, über sich selbst zu verfügen und sein Leben zu vernichten, wenn er auf diese Weise einem Leben ohne Würde, Menschlichkeit und Freiheit zu entrinnen vermag. Ähnlich wie in der Antike für die Stoiker, die den Suizid verherrlichten, wird auch heute wieder die Auffassung vertreten, der Freitod sei als höchster Akt der Freiheit anzusehen; er sei ein Triumph der Freiheit über jede Fremdbestimmung. - Ähnlichen Argumenten begegnen wir auch, wenn gesagt wird: Man hat mich nicht gefragt, als ich zur Welt kam, ob ich leben wollte; so hat mich auch niemand zu fragen, ob und wie lange ich in der Welt bleiben will.
Andere dagegen halten es nicht für möglich, ein sittliches Recht auf Totalverfügung über das eigene Leben zu rechtfertigen. Sie sagen, wer meine, er bringe in der Selbsttötung die Freiheit zu höchster Vollendung, verkenne, daß er dadurch ja gerade die Freiheit an ihr Ende bringe. Ein ethisches Abwägungsurteil führe zu der Konsequenz, daß länger gelebte Freiheit im Vergleich zu vorzeitig vernichteter Freiheit den Vorzug verdiene.
Gegen das Recht auf Selbsttötung gibt es Argumente unterschiedlicher Art. Das Argument der Freiheit besagt, daß die bewußt gewollte Selbsttötung als Akt der freien Entscheidung die Freiheit vorzeitig an ihr Ende bringt und dadurch in letzter Konsequenz das Andauern gelebter Freiheit und Selbstannahme verweigert. Das Argument der Geschöpflichkeit besagt, daß derjenige, der sich selbst tötet, sich gegenüber Gott, dem wir unser Leben verdanken, verweigert und selbstmächtig die Zeit abbricht, die Gott ihm als Heilschance zugedacht hat. So ist die Verweigerung gelebter Freiheit zugleich eine Verweigerung Gott gegenüber.
Bewußte und freiwillige Selbsttötung, auch wenn sie aus hohen Motiven geschieht, ist sittlich nicht gerechtfertigt. Frei gewollte Selbsttötung, durch die jemand bewußt seine Autonomie dokumentieren will, ist ihrer ganzen Natur nach eine Absage an das Ja Gottes zum Menschen. Sie ist auch eine Verneinung der Liebe zu sich selbst, zum natürlichen Streben nach Leben und zur Verpflichtung der Gerechtigkeit und Liebe gegen den Nächsten und gegen die Gemeinschaft.
Unser christlicher Glaube stellt der Verherrlichung der freiwilligen Selbsttötung eine im Glauben begründete Sicht des Lebens gegenüber. Unser Glaube läßt uns darauf vertrauen, daß Gott uns in jeder Situation unseres Lebens wieder einholen kann, sei diese Situation durch eigene Schuld oder durch mißlungene Beziehungen zur Umwelt entstanden.
Die philosophische Diskussion über die Freiheit und über die sittliche Berechtigung, sich in freier Entscheidung das Leben zu nehmen, setzt voraus, daß diese Freiheitsentscheidung auch konkret möglich ist. Das theologische Bemühen um die Erhellung dieses Phänomens hat eine solche Möglichkeit nicht grundsätzlich ausgeschlossen. In der pastoralen Praxis wurde deshalb in früherer Zeit Menschen, die sich das Leben genommen hatten, die kirchliche Beisetzung verweigert. In das neue Rechtsbuch der Katholischen Kirche (CIC) ist diese Anordnung nicht mehr aufgenommen worden, weil sich nicht nachweisen läßt, ob jemand in der Selbsttötung wirklich ein letztes Nein zu sich selbst und zu Gott gesprochen hat und weil die Kirche zwar die Sünde des Selbstmordes verurteilt, nicht aber den Menschen, von dem nicht sicher ist, ob er wirklich ein Selbstmörder ist.
In dieser Einstellung nimmt die Kirche die Ergebnisse der neueren Suizidforschung auf. Diese hat empirisch nachgewiesen, daß der Suizid oft am Ende einer Entwicklung steht, die mit einer starken Einengung der seelischen Selbststeuerung verbunden ist und Ausdruck einer unbewältigten Lebenskrise bzw. eines geminderten Selbstwertgefühls ist. Die meisten Menschen, die einen Suizid begehen, vollziehen darin nicht einen Akt der Freiheit, sondern sie befinden sich in einem außergewöhnlichen Zustand, in dem alles auf den Suizid hindrängt. Deshalb darf jemandem, der sich das Leben genommen oder den Versuch dazu unternommen hat, nicht von vornherein die volle Verantwortung für sein Tun zugeschrieben werden. Vielfach ist der Versuch der Selbsttötung ein Appell an die Mitwelt und ein verzweifelter Ruf nach Zuwendung durch die Mitmenschen. Menschen, die selber keinen Ausweg mehr sehen, bedürfen unserer Hilfe und unseres Mitgehens, damit sie aus der Verzweiflung zu einer Neuorientierung ihres Lebens finden können.
3.4. Fremde Gewalt, Folter, Todesstrafe
Gesundheit und Leben können nicht nur dadurch gefährdet werden, daß wir uns selbst an Leib und Leben Schaden zufügen, sondern sie können auch durch andere bedroht werden: durch mutwillige Verletzung oder durch ungerechte Angriffe auf das eigene Leben, auf das Leben anderer oder auf wichtige Güter und Werte. Gegenüber solchen Angriffen gibt es ein Recht auf Notwehr. Dieses unterliegt aber strengen Regeln. Sie besagen, daß eine Verteidigung nur erlaubt ist, wenn keine andere geeignetere Möglichkeit der Abwehr besteht als die Anwendung physischer Gewalt und wenn bei der Abwehr nicht die Absicht besteht, dem ungerechten Angreifer einen unverhältnismäßig großen Schaden zuzufügen oder gar ihn zu töten. Es muß somit eine wirkliche Notsituation bestehen, und es darf die Abwehr nicht vom Gedanken der Rache geleitet sein. Wo bei einer Notwehr, welche die genannten Bedingungen erfüllt, der Tod des Angreifers eintritt, handelt es sich nicht um eine gewollte Tötung, sondern um eine nicht-gewollte Folge der Verteidigungshandlung. Das Problem der erlaubten Notwehr gegen ungerechte Angriffe erhält über die individuelle Seite hinaus eine besondere Bedeutung, wo es sich um die Frage nach der sittlichen Erlaubtheit gerechter Verteidigung eines Volkes gegen den Angriff eines anderen Volkes handelt (vgl. S. 317-329).
Eine schwere Bedrohung des Lebens und der Würde des Menschen ist die Folter. Weder das Alte Testament noch die jüdische Tradition gestatten die Folter als Mittel, um ein Geständnis zu erzwingen. Im Neuen Testament beruft sich Paulus auf sein römisches Bürgerrecht, das die Folter verbietet (Apg 22,24ff). Die Kirche erklärt die Folter eindeutig als sittlich verwerflich. Die Folter steht in Widerspruch zur Würde des Menschen. Sie widerspricht der Menschlichkeit, sie bringt unzählige Übel hervor und dient in keiner Weise der Wahrheitsfindung. Das gilt auch für die seelische Folter wie Gehirnwäsche und Schwächung des Willens durch Drogen. Das Zweite Vatikanische Konzil betont, daß das, "was immer die Unantastbarkeit der menschlichen Person verletzt, wie Verstümmelung, körperliche oder seelische Folter und der Versuch, psychischen Zwang auszuüben", eine schändliche Tat ist, die zu jener Gruppe von Taten gehört, die "weit mehr jene entwürdigen, die das Unrecht tun, als jene, die es erleiden" (GS 27).
- "In früheren Zeiten wurden grausame Maßnahmen auch von rechtmäßigen Regierungen allgemein angewendet, um Gesetz und Ordnung aufrechtzuerhalten - oft ohne Mißbilligung durch die Hirten der Kirche, die in ihren eigenen Gerichten die Vorschriften des römischen Rechts in bezug auf die Folter übernahmen. Von diesen bedauerlichen Vorkommnissen abgesehen, trat die Kirche stets für Milde und Barmherzigkeit ein; sie verbot Klerikern, Blut zu vergießen. In neuerer Zeit setzte sich die Einsicht durch, daß solche grausame Handlungen weder für die öffentliche Ordnung notwendig sind noch den legitimen Menschenrechten entsprechen, sondern im Gegenteil zu schlimmsten Verirrungen führen. Man muß sich für ihre Abschaffung einsetzen. Für die Opfer, aber auch für ihre Peiniger, soll man beten" (KKK 2298).
In vielen Ländern gibt es die Todesstrafe. Immer wieder flammt die Diskussion darüber auf, ob die staatliche Autorität berechtigt ist, Todesurteile auszusprechen. In Israel bezog sich das fünfte Gebot nicht auf die Todesstrafe. Diese war gesetzlich erlaubt. Nach Paulus steht die staatliche Obrigkeit "im Dienst Gottes und verlangt, daß du das Gute tust. Wenn du aber das Böse tust, fürchte dich! Denn nicht ohne Grund trägt sie das Schwert. Sie steht im Dienst Gottes und vollstreckt das Urteil an dem, der Böses tut" (Röm 13,4). In der christlichen Tradition wird hieraus das Recht des Staates abgeleitet, das Todesurteil auszusprechen, wenn der Täter durch ein entsprechend strafwürdiges Verbrechen das Recht auf Leben verwirkt habe. Es wird der menschlichen Gerichtsbarkeit die Autorität zuerkannt, nach geschehenem Verbrechen für einen gerechten Ausgleich zu sorgen, das heißt, für Mord die Tötung des Mörders.
Die Zwecke, mit denen Todesurteile begründet werden, sind bis heute Vergeltung und Sühne für die Tat, Abschreckung anderer, Sicherung der Gesellschaft. Dagegen gibt es aber auch Bedenken. Was die Vergeltung betrifft, ist zu sagen, daß die Vergeltung nur auf die Tat, nicht aber auf den Täter als Menschen gerichtet ist. Der Abschreckungszweck, der darauf zielt, andere von gleichen Verbrechen abzuhalten, macht den einzelnen zu einem Mittel zum Zweck; auch ist nicht zu beweisen, daß andere tatsächlich durch die Todesstrafe von Verbrechen abgehalten werden.
Um dieses schwerwiegende Problem gab es von Anfang an ein nicht zu übersehendes Ringen. Gleichwohl schließt die christliche Tradition das Recht des Staates zur Verhängung der Todesstrafe als "ultima ratio" (letztes Mittel; nach KKK 2266: "in schwerwiegendsten Fällen") nicht aus.
Allerdings wird dieses Recht an strengste Bedingungen geknüpft. Ob die für die Todesstrafe aufgestellten Bedingungen erfüllt sind, ist eine schwere Gewissensfrage für die zuständige staatliche Autorität. Für unser Land wird man - wie auch aus dem Art. 102 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland hervorgeht - diese Bedingungen als nicht mehr gegeben ansehen.
Vom Glauben her werden Christen über alle staatliche Rechtsordnung hinaus daran erinnert, daß auch der schlimmste Verbrecher sich mit Gott versöhnen lassen kann, indem er die Gnade der Einsicht und Umkehr annimmt. Vor diesem Hintergrund hat sich die Überzeugung verstärkt, daß Christen - besonders in unseren Verhältnissen - keine Verfechter der Todesstrafe sein sollten.
3.5. Einsatz und Opfer von Gesundheit und Leben
Das fünfte Gebot verbietet das Töten und gebietet die Erhaltung und Förderung des Lebens, des eigenen wie das der anderen. Das Gebot lenkt unsere Aufmerksamkeit aber auch auf die unterschiedlichen Güter und Werte hin, die bei der sittlichen Gestaltung des Lebens zu beachten sind: materielle, biologische, ästhetische und geistige Güter sowie sittliche und religiöse Werte.
Wenn man die genannten Güter und Werte miteinander vergleicht, wird deutlich, daß sie in einer Rangordnung stehen. Den höchsten Rang nehmen sittliche und religiöse Werte ein. Sie dürfen niemals verletzt werden. Die anderen Güter sind zwar für das sittliche Handeln auch von großer Bedeutung; man darf sie deshalb auch nicht ohne Grund vernachlässigen oder verletzen, aber es handelt sich bei ihnen nicht um sittliche Werte im eigentlichen Sinn. Bei der Frage, welche Bedeutung dem Leben des Menschen zukommt, hat sich bereits beim Problem der Erlaubtheit der Notwehr gezeigt, daß das Leben ein hohes Gut ist; es ist ein fundamentales Gut, weil es die Voraussetzung für unser Handeln ist. Wir sind sittlich verpflichtet, das menschliche Leben zu schützen und zu bewahren.
So ist zum Beispiel heute ein Bereich besonderer Verantwortlichkeit der Straßenverkehr. Der Verkehrsteilnehmer muß bemüht sein, alles zu meiden, wodurch er sein eigenes oder das Leben anderer gefährdet (Übermüdung am Steuer, Alkoholgenuß, zu hohe Geschwindigkeit usw.). Die Fahrzeughersteller sind verpflichtet, nur solche Fahrzeuge zu produzieren, die Umweltschäden möglichst vermeiden; und der Gesetzgeber ist gehalten, für Verkehrsdisziplin zu sorgen.
In diesen und vielen anderen Bereichen ist die Verpflichtung zur Bewahrung von Gesundheit und Leben eindeutig; es kann aber auch Situationen geben, in denen wir sittlich berechtigt sind, unsere Gesundheit und sogar unser Leben um anderer Güter und Werte willen einzusetzen und zu opfern. Forscher, Ärzte, Politiker, Feuerwehrleute, Entwicklungshelfer, aber auch jede Mutter, die ein Kind empfängt und austrägt, jeder Vater, der um der Familie willen schwere Belastungen auf sich nimmt: sie alle entscheiden sich für Güter, deren Verwirklichung sie vor anderen Gütern den Vorrang geben oder für dringlicher ansehen. Wir achten Menschen, die für andere Menschen ihre Gesundheit oder ihr Leben einsetzen; wir bringen denen unsere Hochachtung entgegen, die um ihres Gewissens willen Nachteile, Verfolgung, Kerker und Tod ertragen; wir bewundern und verehren Frauen und Männer, die für ihren Glauben den Märtyrertod erleiden: "Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt" (Joh 15,13).
4. Schutz des menschlichen Lebens an seinem Anfang
4.1. Fragen und Probleme um den Beginn des menschlichen Lebens
Je weniger ein Mensch sein Leben selbst schützen kann, um so mehr bedarf er eines Schutzes durch die Mitmenschen und durch die Gesellschaft. Aus der Einsicht, daß jedes Menschenleben Würde und Wert besitzt, setzt sich die Kirche für das schwache und hilflose menschliche Leben ein.
Dieses Ja zur Unantastbarkeit und Unverletzlichkeit des Lebens ist in weiten Teilen der heutigen Gesellschaft gegenüber dem vorgeburtlichen menschlichen Leben nicht so eindeutig wie gegenüber dem geborenen. Kindestötung gilt zwar allgemein als Verbrechen, aber bezüglich der Tötung der noch nicht geborenen Kinder ist das durchaus nicht überall der Fall. Tagtäglich werden unzählige ungeborene Kinder durch Abtreibung getötet, und es werden auch immer wieder Gründe für eine vermeintliche Berechtigung dafür angegeben. Schon die Tatsache, daß gegenwärtig in vielen Ländern eine sehr hohe Zahl von Schwangerschaften durch Töten des ungeborenen Kindes beendet wird, deutet darauf hin, daß sich im Bewußtsein der Gesellschaft eine veränderte Einstellung zum Wert des vorgeburtlichen menschlichen Lebens ausbreitet. Viele meinen, das noch nicht geborene Kind habe nicht die gleiche unantastbare Würde wie das geborene; es habe darum auch nicht in gleicher Weise ein unverletzliches Recht auf Leben; es falle darum sittlich und rechtlich auch nicht in gleicher Weise unter das Tötungsverbot wie das geborene Kind.
Tatsächlich begegnet uns in der Frage nach dem Beginn des menschlichen Lebens und nach dem Recht auf Leben eine Vielfalt von Anschauungen. Es gibt Theorien, die behaupten, von Menschsein und von Recht auf Leben könne erst dann die Rede sein, wenn das Kind das Licht der Welt erblickt habe (Geburt), wenn es außerhalb des Mutterleibes lebensfähig sei (etwa 28. Schwangerschaftswoche) oder wenn die embryonale Entwicklung beendet sei (60 Tage nach der Empfängnis). Solche Festsetzungen sind willkürlich oder von bestimmten Interessen geleitet. Das trifft auch für solche Theorien zu, die dem ungeborenen Kind erst dann ein Recht auf Leben zugestehen wollen, wenn es von der Mutter bejaht oder von der Gesellschaft akzeptiert oder nach ärztlicher Untersuchung für "lebenswert" erklärt wird.
In der wissenschaftlichen Diskussion über das ungeborene Leben finden solche Theorien Beachtung, die innerhalb der embryonalen Entwicklung bestimmte Einschnitte und Teilschritte in Richtung auf die Entfaltung zum personalen Leben hin annehmen. Die Erkenntnisse der modernen Genetik und der Embryologie lassen aber keinen Zweifel daran, daß mit der Befruchtung menschliches Leben beginnt. Dieses ist somit weder "ein vormenschliches Etwas" noch "ein Teil der Mutter" noch "ein bloßes Implantationsprodukt" noch "ein werdendes Leben". Wir haben es von der Zeugung an mit dem Leben eines Menschen in seiner ersten Lebensgestalt zu tun, in der alle späteren Stadien angelegt sind.
- Dieses menschliche Leben ist ein Rechtsgut, das von Anfang an einen Anspruch auf Bewahrung und auf Schutz vor Vernichtung hat. "Abtreibung und Tötung des Kindes sind verabscheuungswürdige Verbrechen" (GS 51).
Damit ist eine klare sittliche Orientierung für den verantwortlichen Umgang mit dem ungeborenen Kind gegeben. Da ihm die gleiche Würde wie dem geborenen Kind zukommt, muß es auch die gleiche Bewertung erfahren. Nach kirchlichem Recht zieht sich derjenige, der eine Abtreibung vornimmt, mit erfolgter Ausführung die Tatstrafe der Exkommunikation zu (CIC, can. 1398).
Als Konsequenz daraus, daß menschliches Leben mit der Befruchtung beginnt, ergibt sich: Wer Mittel anwendet, die eine Einnistung der befruchteten Eizelle in die Gebärmutter verhindern, vernichtet menschliches Leben. Solche Mittel können ethisch nicht mit empfängnisverhütenden Mitteln auf eine Ebene gestellt werden. In der Verhinderung der Einnistung einer befruchteten Eizelle liegt in sittlicher Hinsicht die Absicht der Tötung eines ungeborenen Kindes. Diese Intention ist auch dann gegeben, wenn im Einzelfall keine Befruchtung zustande gekommen wäre oder das Einnisten der Eizelle in die Gebärmutter zum Beispiel durch Versagen von Präparaten mit diesem Wirkungsmechanismus nicht verhindert werden konnte.
Das Kriterium der Schutzwürdigkeit des menschlichen Lebens von der Empfängnis an spiegelt sich auch wider in der Überzeugung, daß die Eltern in der Weitergabe des Lebens mit der Liebe Gottes des Schöpfers mitwirken und seine Liebe in der Welt weitergeben (vgl. GS 50). Gott erschafft das Kind, das eine Frucht der Liebe von Mann und Frau ist, und schenkt ihm für immer seine Liebe. Er sagt ja zum Leben, das die Eltern gezeugt haben. Das ist gemeint, wenn wir sagen, das Kind sei ganz das Kind der Eltern und ganz das Kind des Schöpfergottes.
4.2. Bewahrung des menschlichen Lebens in Konfliktsituationen
Wie jedes andere Leben kann auch das ungeborene menschliche Leben in Konflikt mit anderen Gütern geraten. Manchmal sehen Eltern oder Frauen in der Tötung des ungeborenen Kindes das letzte Mittel, um in einem Konflikt Güter, die ihnen wichtig oder sogar unaufgebbar erscheinen, nicht aufgeben zu müssen. Wie kann man in solchen Konflikten zu verantwortbaren sittlichen Entscheidungen kommen?
Für die Klärung dieser Frage ist es wichtig, daß wir mit den Fakten wie mit den verwendeten Begriffen vertraut sind und zudem beachten, daß wir rechtliche Regelungen nicht mit sittlichen Urteilen gleichsetzen.
Im Zusammenhang mit dem Problem des Schwangerschaftsabbruchs begegnen wir immer wieder dem Begriff "Indikation". Viele verstehen darunter fälschlicherweise eine "Indikation zum Schwangerschaftsabbruch" und meinen, ein Schwangerschaftsabbruch sei sittlich gerechtfertigt, wenn eine Indikation vorliege. In Wirklichkeit ist eine Indikation zunächst einmal nichts anderes als ein "Anzeichen" oder "Hinweis" darauf, daß das empfangene Kind Probleme mit sich bringen kann, die für die Mutter bzw. für die Eltern eine mehr oder minder schwere Konfliktsituation darstellen.
Kriminologische (im Rechtsbereich auch ethische oder humanitäre) Indikation besagt, daß das Kind durch Vergewaltigung oder Notzucht rechtswidrig aufgezwungen worden ist.
Allgemeine (soziale) Notlagenindikation besagt, daß durch das empfangene Kind die Mutter oder die Familie in eine schwere soziale oder wirtschaftliche Notlage geraten kann, die von der Schwangeren als so schwerwiegend empfunden wird, daß sie bei ihr zu erheblichen psychischen Belastungen führen kann.
Medizinische Indikation besagt, daß das ungeborene Leben das Leben der Mutter (vitale Indikation) oder die Gesundheit der Mutter (prophylaktische Indikation) gefährdet.
Eugenische Indikation (unter Einbeziehung der embryopathischen) besagt, daß das ungeborene Kind nichtbehebbare Schädigungen aufweist, die vor, während oder kurz nach der Geburt zum Tod des Kindes führen oder während seines Lebens eine bleibende Behinderung zur Folge haben.
Alle diese Indikationen zeigen an, daß das Gut des ungeborenen Lebens in Konflikt mit anderen Gütern geraten kann. Sind diese anderen Güter von so großer Bedeutung und Vordringlichkeit, daß man sie dem fundamentalen Gut des ungeborenen Lebens vorziehen darf? Das ist die eigentliche ethische Frage.
Betrachten wir von dieser Frage her die kriminologische Indikation, so zeigt sich, daß eine Abwägung der hier in Frage stehenden Güter nicht zu einer sittlichen Rechtfertigung eines Schwangerschaftsabbruches führen kann. Auch das durch Vergewaltigung oder Notzucht empfangene Kind hat ein fundamentales Recht auf Leben, das Vorrang hat vor dem Selbstbestimmungsrecht der Mutter. Sicher sind mit einer solchen sittlichen Wertung nicht die vielen Probleme gelöst, die für die Schwangere aus einer aufgezwungenen Schwangerschaft entstehen, aber diese sind nicht dadurch zu lösen, daß das empfangene Kind getötet wird.
Das trifft auf andere Weise auch für die psychische Belastung der Mutter zu, von der die Notlagenindikation spricht. Seelische und soziale Notlagen sind große Übel, aber sie erlauben nicht, daß das empfangene Kind getötet wird; sie sind vielmehr durch Hilfen zu beseitigen, die der Mutter von anderer Seite her zu gewähren sind. Leider fallen für eine solche Hilfe oftmals gerade diejenigen aus, deren Aufgabe es am ehesten wäre, die Frau vor der Entscheidung zur Tötung ihres ungeborenen Kindes zu bewahren: der Vater des Kindes, die Familie und die engere Umwelt. Manchmal verstärken sie durch Druck noch die Not der Schwangeren und treiben sie zum Abbruch. Das gilt nicht weniger für die breite Öffentlichkeit, in der sich die Maßstäbe über den Wert des ungeborenen Lebens beträchtlich verschoben haben. Die allgemeine Mentalität drängt oft in Situationen, aus denen die Schwangere kaum noch einen anderen Ausweg weiß.
Schwierige Probleme kann die Findung des rechten sittlichen Urteils bei der medizinischen Indikation mit sich bringen. Allerdings können heute aufgrund medizinischen Fortschritts die meisten Risiken für die Gesundheit der Mutter (prophylaktische Indikation) so verringert werden, daß medizinisch gesehen lebensbedrohende Situationen selten geworden sind. Somit stellen sich bezüglich einer Güterabwägung bei medizinisch-prophylaktischer Indikation die ethischen Probleme heute im allgemeinen nicht mehr in solcher Schärfe, wie das früher der Fall war.
In seltenen, aber nicht auszuschließenden Fällen stehen sowohl das Leben der Mutter wie auch das Leben des Kindes auf dem Spiel (vitale Indikation). Hier wird die Situation so dramatisch, daß alle Beteiligten vor einem schweren persönlichen Konflikt stehen; hier scheinen auch die ethischen Kategorien über die Unantastbarkeit des Lebens kaum mehr zu greifen. Die ethische Forderung, in einem solchen Fall der Natur ihren Lauf zu lassen und beide, Mutter und Kind, sterben zu lassen, wird allgemein als unmenschlich empfunden. Man wird in diesem extremen Ausnahmefall aber auch das Argument derer beachten, die es ethisch für vertretbar halten, daß von zwei sonst unrettbaren Leben wenigstens eines gerettet werden dürfe, zumal das Ziel der Handlung die Rettung von Leben sei. Eine solche Abwägung ist jedoch auf keinen Fall mit jenen Eingriffen auf eine Stufe zu stellen, in denen ein ungeborenes Kind auch dann getötet wird, wenn es in keiner Weise mit einem gleichwertigen Gut in Konflikt gerät. Die Deutschen Bischöfe betonen: "Hier ist die sorgfältige Gewissensentscheidung des Arztes in der konkreten Situation gefordert. Einer solchen Entscheidung wird niemand die Achtung vorenthalten" (Zur Novellierung des § 218 vom 7. 5. 1976, 7).
Da die eugenische oder genetische bzw. kindliche (embryopathische) Indikation eigene Probleme aufwirft, soll sie im Zusammenhang mit der genetischen Beratung und vorgeburtlichen Untersuchung behandelt werden.
4.3. Genetische Beratung und vorgeburtliche Untersuchung
Die weitaus größte Zahl der Kinder kommt gesund zur Welt. Medizinische Wissenschaft und ärztliche Kunst, Ernährungswissenschaft und Hygiene, Schwangerenberatung und Vorsorgeuntersuchung tragen viel dazu bei, daß Komplikationen während der Schwangerschaft erheblich herabgemindert werden. Trotzdem sind auch heute nicht alle Risiken der Schwangerschaft beseitigt. Oft zeigen sich bei Kindern Schäden, die auf genetische Ursachen bzw. auf Stoffwechselstörungen während der Zeit der Schwangerschaft zurückgehen.
Die Sorge darum, daß aus ihrer Ehe möglicherweise Kinder hervorgehen, die genetisch bedingte Schäden aufweisen, stellt manche bereits vor der Zeugung vor schwerwiegende Entscheidungen. Junge Menschen, die eine Ehe eingehen möchten und feststellen, daß einer oder beide Partner oder auch Mitglieder ihrer Familie genetisch bedingte Erbschäden oder Mißbildungen aufweisen, stehen vor der Frage, ob sie überhaupt eine Ehe eingehen sollen, ob sie es in einer Ehe verantworten können, Kinder zu zeugen, und ob sie bereit wären, auch ein geschädigtes Kind anzunehmen und aufzuziehen. Ähnlich stehen Eltern, aus deren Ehe bereits ein krankes oder mißgebildetes Kind hervorgegangen ist, vor der Frage, ob sie wegen der möglicherweise zu erwartenden erblichen Schädigung die Zeugung eines weiteren Kindes verantworten können.
Moderne Methoden der genetischen Diagnostik (Genanalyse) und Beratung bieten solchen Ratsuchenden die Möglichkeit, Auskunft über die Wahrscheinlichkeit erbkranken Nachwuchses zu erhalten. Ziel der genetischen Beratung ist in erster Linie die Information; die Entscheidung darüber, ob sie ein Kind verantworten können, müssen die Partner selber fällen.
Vom ethischen Standpunkt her ist es höchst angemessen, daß bei familiären erblichen Belastungen bereits vor der Heirat um eine genetische Diagnostik nachgesucht wird. Das Wissen um ein hohes Risiko kann zu dem verantwortbaren Entschluß führen, trotzdem eine Ehe einzugehen. Er darf dann aber nicht die Entscheidung enthalten, ein in dieser Ehe empfangenes Kind nur dann auszutragen, wenn keine Schädigungen festgestellt werden.
Ebenso ist die genetische Beratung für Eltern zu empfehlen, aus deren Ehe bereits ein geschädigtes Kind hervorgegangen ist und die sich ein weiteres, gesundes Kind wünschen. Eltern, die mit der Möglichkeit einer Schädigung auch bei weiteren Kindern rechnen müssen, dürfen aber das Austragen der Schwangerschaft nicht von der Bedingung abhängig machen, daß das Kind auch wirklich gesund ist.
Diese sittliche Orientierung gründet darin, daß jedem menschlichen Leben, auch dem geschädigten und behinderten, der Lebenswert von Gott her zukommt und nicht in die Verfügung des Menschen gestellt ist.
Gelten ähnliche sittliche Orientierungen auch für die Bewertung der vorgeburtlichen Untersuchung (pränatale Diagnostik)? Hierbei handelt es sich um medizinische Methoden, mit denen festgestellt werden kann, ob und in welchem Ausmaß ein bereits empfangenes Kind Schädigungen aufweist.
Die positiven Aspekte der pränatalen Diagnostik sind nicht zu übersehen. Bei den weitaus meisten Fällen, in denen Schwangere eine Untersuchung vornehmen lassen, stellt sich heraus, daß ein gesundes Kind zu erwarten ist. Das bedeutet für die Schwangere eine große Entlastung, die sich vorteilhaft auf das Gesamtbefinden von Mutter und Kind auswirkt. - Die vorgeburtliche Untersuchung hat auch einen lebenserhaltenden und geburtenfördernden Aspekt, denn Schwangere, die sonst vielleicht zu einem Schwangerschaftsabbruch bereit gewesen wären, sehen sich gar nicht erst vor eine solche Konfliktsituation gestellt.
Andererseits sind aber auch die negativen Seiten der vorgeburtlichen Untersuchung zu bedenken. Häufig werden nämlich solche Untersuchungen schon mit der Absicht vorgenommen, ein behindertes oder krankes Kind gar nicht erst auszutragen. Hier besteht die Gefahr, daß die pränatale Diagnostik unter die Zielsetzung des Schwangerschaftsabbruchs gerät. Eine solche Zielsetzung zeigt sich, wenn in Kliniken schon vor der Untersuchung die Zustimmung der Mutter eingeholt wird, bei Feststellung einer nichtbehebbaren Schädigung einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen. Hier wird die vorgeburtliche Untersuchung zu einem Druckmittel gegen Schwangere, ein geschädigtes Kind auf jeden Fall töten zu lassen.
Daraus ergibt sich, daß zur Vornahme einer vorgeburtlichen Untersuchung eine sittlich vertretbare Begründung vorliegen muß und daß immer auch die Zielsetzung zu beachten ist. Sittlich verwerflich ist sie, wenn sie mit dem Ziel der Abtreibung vorgenommen wird. Nur jene Form von vorgeburtlicher Untersuchung ist sittlich erlaubt, die von der positiven Wertung jedes menschlichen Lebens ausgeht und auf die Bewahrung des ungeborenen Kindes ausgerichtet ist.
Wo sich bei einer vorgeburtlichen Untersuchung herausstellt, daß bei dem ungeborenen Kind eine genetisch bedingte Schädigung vorliegt, ist das ein Hinweis darauf, daß hier die Eltern des Kindes, besonders die Mutter, aufgerufen sind, ihre Entscheidung für das Kind, nicht gegen es zu treffen und ihm ihre gesamte Zuwendung zu schenken.
Oft begegnet man hiergegen dem Einwand, das Austragen und Aufziehen eines schwer geschädigten Kindes sei für die Eltern nicht zumutbar. Andere meinen, ein Kind, das mit einer schweren Mißbildung oder mit einer unbehebbaren Behinderung leben müsse, habe kaum eine echte Chance zu einer humanen Selbstverwirklichung. Deshalb müsse es im Interesse aller liegen, daß das Kind erst gar nicht geboren werde. Ein mongoloides Kind, das auch als Erwachsener nie über die Intelligenzstufe eines fünf- bis sechsjährigen Kindes hinausgelange, sei zwar nicht unglücklich, aber es werde nie selbständig und bleibe immer auf die Eltern angewiesen. Oft überlebe es sogar die Eltern. Wer solle dann für es sorgen? Wäre es nicht besser, ein solches Kind im Mutterleib zu töten?
Wer so denkt, muß sich fragen lassen, welche Geisteshaltung er einnimmt und welche Konsequenzen sie mit sich bringt. Was sollen Eltern dazu sagen, die ein schwer behindertes Kind mit großer Liebe betreuen? Bedeuten ihre Opfer nichts? Und sollen die heute lebenden Behinderten denken, sie hätten eigentlich gar nicht geboren werden dürfen? Haben sie nur Glück gehabt, daß es zu der Zeit, als sie im Mutterleib heranwuchsen, noch keine vorgeburtliche Untersuchung gab? Womit rechtfertigt man bei einer solchen Mentalität eigentlich das Lebensrecht der geborenen Behinderten, wenn man es den ungeborenen abspricht? Auch Zuckerkrankheit, Kurzsichtigkeit, Farbenblindheit und Gicht sind erblich bedingte Behinderungen.
Der Wert eines Menschen gründet nicht in seiner Gesundheit, in seiner Glücksfähigkeit, in seiner Nützlichkeit, in seinem Geschlecht, in seinem Angenommensein durch die Eltern, sondern in seinem Menschsein, in seiner Gottebenbildlichkeit, in seinem Angenommensein von Gott und in seiner Berufung auf eine ewige Zukunft hin. Deshalb ist die eugenische oder genetische Indikation kein Hinweis darauf, daß geschädigtes oder krankes Leben beseitigt werden soll, vielmehr wird uns zugemutet, in wahrhaftem Sinne human zu sein. Deshalb gilt als ethisch verbindliches Prinzip, daß jedes menschliche Wesen als Person geachtet und behandelt werden muß. Deshalb muß auch das geschädigte menschliche Leben im Rahmen der medizinischen Möglichkeit versorgt und betreut werden. Daraus ergibt sich, daß sich ein Arzt einer moralisch unerlaubten Beihilfe schuldig machen würde, wenn er beim Durchführen der Diagnose und beim Mitteilen des Ergebnisses absichtlich dazu beitrüge, eine Verbindung zwischen vorgeburtlicher Diagnose und Abtreibung herzustellen (vgl. zum Ganzen KKK 2274 sowie die Instruktion der Kongregation für die Glaubenslehre über die Achtung vor dem beginnenden menschlichen Leben und die Würde der Fortpflanzung vom 10. 3. 1987, I, 2).
4.4. Das Gesetz des Staates und der Schutz des ungeborenen Lebens
Jede Gesellschaft hat die Pflicht, das menschliche Leben als fundamentales Rechtsgut zu schützen. Dieser Schutz gilt in besonderer Weise denen, die sich selbst nicht schützen können, und unter ihnen vor allem den ungeborenen Kindern als den schwächsten Gliedern der Gesellschaft. Deshalb muß das ungeborene menschliche Leben auch unter dem besonderen Schutz des Staates stehen.
Die Tötung ungeborenen menschlichen Lebens verletzt die Unantastbarkeit des Lebens und die schutzwürdigen Grundlagen der menschlichen Rechtsgemeinschaft.
Wenn Raub, Diebstahl, Vergehen im Straßenverkehr und vieles mehr mit Strafe belegt werden, dann ist das ungeborene Kind ein so hohes Rechtsgut, daß seine vorsätzliche Tötung nicht außerhalb des rechtsstaatlichen Schutzes gestellt werden darf.
Der Staat kann weder den gesamten Bereich des Sittlichen durch Gesetze schützen, noch kann er alle Vergehen gegen die sittliche Ordnung bestrafen. Da aber das ungeborene menschliche Leben ein sehr hohes Rechtsgut ist, muß der Staat, selbst wenn er unter bestimmten Umständen von Strafverfolgung absieht, die Tötung des ungeborenen menschlichen Lebens rechtlich mißbilligen.
In sittlicher Hinsicht ergeben sich aus der Verpflichtung, das ungeborene menschliche Leben zu schützen, folgende Orientierungen:
Erstens: Die konkrete staatliche Rechtsordnung ist weder eine ausreichende Begründung für eine sittliche Erlaubtheit des Schwangerschaftsabbruchs, noch darf sie ein Recht darauf einschließen. Ein Recht auf Schwangerschaftsabbruch gibt es nicht.
Zweitens: Die Rechtsordnung darf Ärzte und medizinische Mitarbeiter sowie Krankenhausträger nicht verpflichten, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen oder unmittelbar daran mitzuwirken.
Ungeborenes menschliches Leben nicht anzutasten ist nicht nur ein christliches, sondern ein allgemein menschliches Gebot. Schon im 5. Jahrhundert v. Chr. ließ Hippokrates, den man den Vater der Heilkunde nennt, seine Schüler schwören: "Ich werde niemandem ein tödlich wirkendes Gift verabreichen, auch auf Verlangen nicht. Ich werde auch keinen solchen verwerflichen Rat erteilen. Ebensowenig werde ich einer Frau ein Mittel zur Vernichtung keimenden Lebens geben." Diese Haltung spiegelt sich auch wider in der Erklärung des Weltärztebundes von Oslo (1970): "Der oberste moralische Grundsatz, der dem Arzt auferlegt ist, ist die Achtung des menschlichen Lebens, so wie es in einem Satz des Genfer Gelöbnisses ausgedrückt ist: ,Ich will höchste Achtung vor dem menschlichen Leben von dem Zeitpunkt der Empfängnis an wahren."
Drittens: Die Kirche kann weder allein durch moralische Appelle noch der Staat allein durch Gesetze die in der Gesellschaft schwindenden Werte schützen. Appelle und Gesetze müssen ergänzt werden durch konkrete Hilfen, besonders durch Wertvermittlung, durch Beratung in Konfliktsituationen und durch gesetzlich festgelegte Sozialmaßnahmen.
Viertens: Wo eine Beteiligung der Kirche in gesetzlichen Schwangerenberatungsstellen aus moralischen Gründen nicht vertretbar ist, stellt sich für die Kirche die Aufgabe, nach eigenen Wegen der Beratung zu suchen, deren Ziel die Erhaltung des ungeborenen menschlichen Lebens und wirksame Hilfe für die schwangere Frau ist.
Eine Beratung kann in vielen Fällen dazu führen, daß Frauen, die ursprünglich einen Abbruch vornehmen lassen wollten, ihre Absicht ändern und sich für das Leben des Kindes entscheiden. Um diesem Ziel dienen zu können, ist es nötig, daß ein ausreichendes Netz von kirchlichen Beratungsstellen sowie genügend personelle und materielle Hilfen einer Begleitung vorhanden sind. Hierbei soll auch die Verantwortung des Vaters mit ins Spiel kommen.
Vollkommen konfliktfreie Lösungen gibt es nicht. Die Bewahrung des Lebens kann in Konfliktfällen Lasten auferlegen und Opfer verlangen. Frauen, die sich unter großen Opfern für ihr Kind entscheiden, geben ein wichtiges christliches Zeugnis für das Leben und verdienen besondere Hochachtung. Wie schwer solche Opfer sind, können jeweils nur die Betroffenen selbst ermessen. Mitdenken und Mitfühlen, Raten und praktische soziale Hilfen können Not lindern und die Entscheidung für das Leben fördern. Zu solcher Hilfe sind jeder einzelne und die gesamte Gesellschaft in die Pflicht genommen.
4.5. Genforschung und Gentechnologie
Die moderne Biologie hat zu einem tiefgreifenden Wandel unseres Weltbildes beigetragen. Viele ihrer Erkenntnisse sind auch in anderen Gebieten von weitreichender Bedeutung. In jüngster Zeit hat sie Erkenntnisse gewonnen, die zu den revolutionärsten in der Erforschung des Lebens und der Lebensvorgänge gehören. Mit der Gentechnik, die auf Erkenntnisse der Biologie, Biochemie und Genetik aufbaut, kann man die Erbanlagen von Lebewesen einschließlich des Menschen feststellen, isolieren, gezielt beeinflussen, verändern und neu kombinieren.
Ein erstes Anwendungsgebiet ist die uns umgebende Natur und die Umwelt. Mit Hilfe gentechnologischer Verfahren können Rohstoffe erschlossen, chemische Grundstoffe hergestellt, giftige Metalle aus Klärschlamm isoliert, Ölteppiche auf Meeren beseitigt und Bakterien entwickelt werden, durch die Giftstoffe in der Natur abgebaut werden.
Ein zweites Anwendungsgebiet ist die Pflanzentechnologie. In kürzester Zeit können neue Getreidearten gezüchtet werden, die hohe Erträge bringen, weniger anfällig sind, auf kargen Böden wachsen, eventuell ohne Dünger auskommen, weil sie den Stickstoff direkt der Luft entziehen und somit eine verbesserte Nahrungsqualität haben. Forscher versichern, daß eine Reihe dieser Projekte in nächster Zeit realisiert werden.
Als drittes Gebiet ist die Tierzucht zu nennen. Hier können neue Arten entwickelt werden, die größeren Nutzen bringen oder für die Tierhaltung besser geeignet sind. Die bisherigen Techniken stützen sich wesentlich auf zellbiologische Verfahren. Durch künstliche Besamung wurde ausgewähltes Erbmaterial übertragen. Inzwischen ist es aber gelungen, Körperzellen in entkernte Eizellen einzubringen und Keimlinge in einem Stadium, in dem sie noch für eine Vielzahl von Entwicklungen offen sind, zu teilen und so genetisch identische Mehrlinge zu produzieren. Beide Verfahren nennt man Klonieren (künstliche Herstellung von genetisch identischen Mehrlingen). Inzwischen können auch durch Übertragung von Wachstumshormonen weitaus größere Tiere produziert werden oder sogar sogenannte Chimären aus zwei verschiedenen Tierarten hervorgebracht werden.
Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die Herstellung von Medikamenten. Auf diesem Gebiet werden schon seit einiger Zeit Technologien eingesetzt, die es erlauben, billigere und verträglichere Medikamente herzustellen.
Ein letztes Anwendungsgebiet schließlich ist der Mensch selbst. Das entscheidende Anwendungsgebiet ist hier die Gentherapie. Dabei müssen wir zwischen zwei Arten von Gentherapie streng unterscheiden.
Zum einen gibt es die Gentherapie an Körperzellen. Durch sie ist es grundsätzlich möglich, Erbkrankheiten zu behandeln, die entweder auf das Fehlen eines einzigen Gens zurückzuführen oder durch eine größere Anzahl von Genen bedingt sind. Zur Zeit konzentriert sich die Forschung auf die Genübertragung, bei der einem defekten Gen ein gesundes eingefügt wird. Bei Erbkrankheiten, die durch mehrere Gene bedingt sind, steht die Forschung noch ziemlich am Anfang. Beim Gentransfer in Körperzellen wird die korrigierte Eigenschaft nicht an die Nachkommenschaft vererbt.
Zum anderen gibt es die Gentherapie an Keimbahnzellen. Hierdurch soll zwar auch primär die Heilung einer Erbkrankheit erreicht werden, aber es geht nicht nur um die Heilung des Erkrankten selbst, sondern auch um die Nachkommen, an welche die Krankheit vererbt wird. Eine Krankheit soll dadurch nicht vererbt werden, daß gesunde Gene in die Zellen von Embryonen im frühesten Entwicklungsstadium übertragen werden. Durch diesen Transfer werden alle Zellen verändert, und der veränderte Genbestand wird an die künftige Generation weitergegeben.
Diese Methode ist bereits erfolgreich an Tieren durchgeführt worden. Weite Kreise der Bevölkerung, aber auch bedeutende Wissenschaftler vertreten die Auffassung, der Mensch habe mit den neuen technologischen Möglichkeiten die Grenzen dessen, was er machen darf, überschritten. Sie betonen, die Natur sei Lehrmeisterin und Norm. Albert Schweitzer hat das Prinzip der "Ehrfurcht vor dem Leben" aufgestellt. Seitdem fordern viele eine größere Achtung vor dem Leben und den Gesetzen der Natur. Sie verweisen vor allem darauf, daß mit den neuen Möglichkeiten der Genmanipulation zu viele Gefahren für die Natur verbunden seien. So etwa die Ausmerzung von Pflanzen- und Tierarten, die Entstehung krankheitserregender Keime, die nicht unter Kontrolle gehalten werden und eine mögliche Umweltverseuchung bewirken können. Noch größer sei die Gefahr für den Menschen durch Experimente mit Embryonen und durch Eingriffe in die natürliche Zeugung, etwa durch Klonierung. Auf Grund dieser Gefahren sei es sittlich nicht gerechtfertigt, die wissenschaftlichen Vorhaben der Gentechnologie weiterzuführen, zumal sie auch die Gefahr der Züchtung von neuen Menschen heraufbeschwören.
Die Befürworter der Gentechnologie dagegen gehen davon aus, daß die Natur für verantwortliches menschliches Handeln offen ist. Sie verweisen auf Erfolge im medizinisch-gesundheitlichen Bereich (Bekämpfung von Erbkrankheiten und von Krebs), auf die Erhöhung landwirtschaftlicher Erträge, auf die Verbesserung der Ernährungslage der Welt, auf die Bekämpfung von Umweltbelastungen und auf die Sicherung von Arbeitsplätzen.
Was können wir von einer theologisch begründeten Ethik her zu den Grundfragen der Genforschung und Gentechnologie sagen? Alle Überlegungen, die im Zusammenhang mit dem Bereich der Natur und des Lebens stehen, müssen immer wieder von dem zweifachen Auftrag Gottes an den Menschen ausgehen, die ihm vertraute Erde zu bebauen und zu behüten (Gen 2,15) und sich die Erde untertan zu machen (Gen 1,27f). Bewahrung der Natur und Gestaltung der Natur sind uns als sittliche Aufgabe zugewiesen.
Von diesem Auftrag her haben wir keinen Grund, zur Erforschung der Erde und des Menschen ein grundsätzliches Nein zu sagen. Zwar wissen wir, daß der Mensch seine Herrschaft über die Erde mißbrauchen kann, aber der mögliche Mißbrauch schließt den verantwortlichen Gebrauch nicht aus. Das Eingreifen der Menschen in Natur und Umwelt ist Auftrag Gottes; es ist nicht nur sittlich vertretbar, sondern es ist auch sittlich verpflichtend, denn die Natur existiert ja nicht als solche noch als bloß heile und bewahrende und ernährende Natur, sondern sie ist in vieler Hinsicht auch zerstörende und vernichtende Natur mit Naturkatastrophen, Krankheiten, Epidemien und vielen anderen Erscheinungen. Dem Menschen aber geht es um das Überleben, um die Erhaltung oder Wiedererlangung der Gesundheit und um die Kultivierung der Natur. Sein Naturauftrag ist Kulturauftrag. Aus dieser Verantwortung für das Leben ergeben sich für die Genforschung und deren Anwendung in der Gentechnologie von seiten der Methoden, der angestrebten Ziele und der voraussehbaren Folgen sittliche Konsequenzen.
Betrachten wir die Methoden, die in der Gentechnologie zur Anwendung kommen, so stellen wir fest, daß zwischen den herkömmlichen Methoden und den direkt in die Erbsubstanz eingreifenden Methoden ein tiefgreifender Unterschied besteht. Manche vertreten deshalb die Auffassung, schon mit der Anwendung dieser Methoden selbst überschreite der Mensch eine grundsätzliche Grenze, denn es gehöre nicht zum Kulturauftrag des Menschen, direkt in die Natur einzugreifen und sie zu steuern. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, daß im Unterschied der Methode als solcher noch keine Begründung dafür gegeben ist, die Gentechnologie generell sittlich zu verwerfen.
Wie steht es nun um die Ziele der Genforschung und Gentechnologie? Wie sind sie ethisch zu bewerten?
Die Anwendung in der Pflanzen- und Tierzüchtung sowie in der Pharmakologie richtet sich auf die Verbesserung der Lebensbedingungen und auf die Herstellung wirtschaftlich und therapeutisch wichtiger Produkte. Von dieser Zielsetzung her kann man die Gentechnologie in diesen Bereichen nicht als sittlich verwerflich ansehen.
Weitaus problematischer ist die Anwendung der Gentechnologie auf den Menschen. Der Mensch ist Person, und deshalb kann er niemals nur Objekt des Handelns sein. Selbst als Objekt ist er immer Subjekt, und als solches darf er niemals nur Mittel zum Zweck sein. Jeder Eingriff, der am Menschen vorgenommen wird, muß das Recht des Menschen auf leibliche Integrität und auf personale Identität achten. Sofern diese gewahrt werden und die Gentechnologie in therapeutischer Zielsetzung vorgenommen wird, ist die Gentherapie an Körperzellen sittlich erlaubt. Im Prinzip handelt es sich hier um eine Therapie, die ethisch wie eine Gewebetransplantation zu bewerten ist. Voraussetzung für die Anwendung ist allerdings, daß die Methode erfolgversprechend ist, daß das nicht unerhebliche Risiko in Betracht gezogen wird und daß der vorher informierte Patient freiwillig seine Zustimmung gibt.
Das schwierigste ethische Problem ist der gentechnologische Eingriff in Keimbahnzellen. Wenn diese Methode bisher auch beim Menschen noch nicht möglich ist, so muß doch befürchtet werden, daß entsprechende Versuche unternommen werden. In Deutschland ist die künstliche Veränderung menschlicher Keimbahnzellen nach dem seit dem 1. Januar 1991 geltenden Embryonenschutzgesetz ausdrücklich verboten.
Eine sittliche Bewertung jedes nur denkbaren Eingriffs ist freilich nicht möglich. Nach Auffassung vieler Ethiker wäre grundsätzlich ethisch nichts dagegen einzuwenden, eine genetisch bedingte Anomalie in einem menschlichen Embryo auf gentechnologischem Wege zu korrigieren. Beim heutigen Wissensstand wird man jedoch zu jeder Art von gentechnologischem Eingriff, somit selbst zur Korrektur einer genetisch bedingten Anomalie, ein eindeutiges Nein sagen müssen. Der Grund dafür ist dieser: Selbst wenn es eines Tages gelingen sollte, den Ausfall eines Gens, also eine genetische Anomalie, gentechnologisch zu korrigieren, so würden schon für die zur Erreichung dieses Zieles notwendigen Versuche eine Vielzahl von Experimenten mit menschlichen Embryonen erforderlich sein. Das aber kann niemals ethisch erlaubt sein. Hinzu kommt, daß sich auch nicht vorhersagen läßt, ob ein eingepflanztes Gen nicht neue Defekte hervorruft, die ja dann an die nachfolgende Generation weitergegeben werden.
Als weiteres ist schließlich zu fragen, welcher Krankheitsbegriff denn einer solchen Therapie zugrunde gelegt werden soll. Was ist Krankheit, was ist Gesundheit? Das vermag niemand genau zu definieren. Gehört nicht zur je einmaligen Individualität des Menschen auch seine Unvollkommenheit? Entscheidendes Kriterium für die sittliche Bewertung der Therapie an Keimbahnzellen ist das Recht des Embryos und seiner Nachkommen auf körperliche Integrität und auf personale Identität. Beides würde durch den Eingriff in den menschlichen Embryo auf das schwerste verletzt. Von daher versteht es sich von selbst, daß auch alle anderen weiteren Experimente an Embryonen, wie etwa die Versuche zur Menschenzüchtung und der asexuellen Vermehrung (Klonierung), grundsätzlich abzulehnen sind.
Nehmen wir schließlich noch das dritte Element der sittlichen Bewertung, nämlich die Folgen, in den Blick, so ist festzustellen, daß es heute außerordentlich schwer ist, die mittel- und langfristigen Folgen der Gentechnologie exakt vorauszusagen. Wir wissen noch nicht, ob sich die Gentechnologie nicht auch negativ auf die Pflanzen- und Tierwelt auswirkt und möglicherweise zu einer schweren Störung im ökologischen Gleichgewicht beiträgt. Es ist nicht auszuschließen, daß ganze Pflanzenarten verschwinden und daß bei einer reinen Kosten-Nutzen-Kalkulation nur noch Tierrassen gezüchtet werden, die ökonomische Vorteile mit sich bringen, wodurch das breite Spektrum von Tierarten verschwinden würde. Zu alledem kommt, daß man den Gedanken der Mitgeschöpflichkeit beachten muß. Dieser gebietet nicht nur, daß wir gegenüber der nicht-menschlichen Kreatur barmherzig sind und sie nicht quälen, sondern mehr noch, daß wir ihr Fürsorge, Hege und Pflege angedeihen lassen.
Es ist immer wieder unsere Aufgabe, außer auf die großen Chancen und voraussehbaren Folgen der Gentechnologie auch auf ihre noch nicht absehbaren Folgen und besonders auf die möglichen Zwänge hinzuweisen, die mit der Forschung verbunden sind. In einer Gesellschaft, in der es keine ausreichende Übereinstimmung über Werte mehr gibt, kann es leicht dazu kommen, daß man fordert, alles, was machbar ist, auch tatsächlich zu machen.
5. Sorge um kranke und sterbende Menschen
5.1. Krankheit, Sterben und Tod im christlichen Leben
Alles irdische Leben ist endlich und vergänglich. Unsere Lebenszeit ist "gestundete Zeit" (Ingeborg Bachmann). Daran erinnern uns die Erfahrungen von Schmerz, Krankheit und Leid wie auch das Abschiednehmen, der Verlust und die Trennung von Menschen. Der Tod eines geliebten Menschen entreißt unserem Leben Unwiederbringliches. Zugleich konfrontiert er uns mit dem eigenen Sterbenmüssen.
Schmerzen, Krankheit und Leid sind Erfahrungen, die den Menschen unausweichlich treffen und betroffen machen. Ihre Ursachen können verschieden sein. Krankheit kann eine Störung der körperlichen oder psychischen Funktionen sein; sie kann uns als plötzlich eintretendes Schicksal (Krebs, Unfall) überfallen; wir können sie durch unsere eigene Lebensweise selbst verursacht haben. Krankheit betrifft als Kranksein immer den ganzen Menschen. Sprache, Gebärden, Gang, Denkungsart und Verhältnis zur Umgebung werden anders, wenn der Mensch leidet. Bei körperlichem Schmerz oder seelischem Kummer ändert sich die Einstellung zu den täglichen Dingen des Lebens. Der Kranke erfährt in der Beeinträchtigung und Bedürftigkeit die verschiedenen Beziehungen, die ein Leben schön und sinnvoll machen, gestört oder gar zerstört: die Beziehung zu sich selbst, zur Umgebung, zu den Mitmenschen und oftmals auch zu Gott. Er fühlt sich aus dem normalen Leben ausgegliedert, isoliert, untauglich und überflüssig. Krankheit und Leid stellen nicht nur vor die Frage nach dem "Woher", sondern auch nach dem "Warum", nach der Sinnhaftigkeit des Leidens, ja des Lebens überhaupt. Sie sind ein Schrei nach Hilfe und Heilung, nach Leben, Gesundheit und Heil. Sie können zur Krise werden und in Verzweiflung stürzen, wenn Heilung aussichtslos ist; sie können eine Chance zu Besinnung und Einkehr sein; sie können zu einem Anruf an die Mitmenschen um Zuwendung und Begleitung werden; und sie können ein Prüfstein für das Verhalten der Mitmenschen zu kranken, alternden und sterbenden Menschen sein. Krankheit und Leiden erinnern an die Endlichkeit allen irdischen Lebens, an Sterben und Tod.
Aus der inneren Verflochtenheit von Leben, Krankheit und Tod war im christlichen Bewußtsein früherer Jahrhunderte die Überzeugung lebendig, daß der Mensch stets seines Todes eingedenk sein solle: Momento mori - Bedenke, daß du sterben wirst! Im Werden und Vergehen der Natur, in Geburt und Tod, in Feiern der Kirche begegnete der Christ dem Anruf an sein eigenes Leben und Sterben; und wenn er selber starb, geschah es zumeist in der Geborgenheit der Familie, die so wiederum selber mit Sterben und Tod vertraut wurde.
In der Neuzeit ist diese Erfahrung weithin verlorengegangen. Sterben und Tod sind mehr und mehr aus der Öffentlichkeit und aus den Familien verbannt worden. Mehr als zwei Drittel aller Menschen sterben in Krankenhäusern, Alters- und Pflegeheimen.
Heute begegnet die Verdrängung und Tabuisierung des Todes wachsendem Widerstand. Ein neues Nachdenken über Krankheit, Sterben und Tod setzt ein. Dahinter steht die Suche nach Sinn und Identität, die in der modernen Leistungsgesellschaft nicht mehr unmittelbar aufleuchten. Mit diesem Suchen nach Sinn verbindet sich die Forderung nach einem menschenwürdigen Sterben als Recht, den eigenen Tod sterben zu dürfen. "O Herr, gib jedem seinen eigenen Tod!" (Rainer Maria Rilke).
Können wir Sterben und Tod überhaupt verstehen? Stehen wir nicht stumm, hilflos und manchmal auch verbittert da vor dem Sterben eines Kindes, das, kaum geboren, wie ein Licht verlöscht? Versagt nicht unsere Einsicht vor den vielfachen Weisen von Tod durch Hunger, Katastrophen, Krieg, Unfall oder Krankheit?
Auf alle diese Fragen haben Menschen von jeher versucht Antworten zu finden. Von der Antike bis in die Gegenwart gibt es die Antwort, die sich beim Philosophen Epikur findet: "Das schauerlichste Übel also, der Tod, geht uns nichts an; denn solange wir existieren, ist der Tod nicht da, und wenn der Tod da ist, existieren wir nicht mehr" (Brief an Menoikeus). Eine andere Antwort lautet: "Mit dem Tod ist mein Leben zu Ende. Ich lebe weiter in meinen Kindern, in meinen Werken und in der Erinnerung anderer." Es begegnet uns heute aber auch das Nachdenken darüber, daß der begrenzte und endliche Mensch das Wesen der unbegrenzten Offenheit ist. Alles den Menschen innerweltlich Umgebende ist nicht das im letzten Sinngebende, und Sterben und Tod können nicht das Letzte und Endgültige sein. Will nicht jeder Mensch auf irgendeine Weise Ewigkeit?
Gläubiges Nachdenken über den Tod geht davon aus, daß Gott lebt, daß er als Schöpfer des Lebens das Leben seiner Geschöpfe liebt und an seiner Liebe zu uns auch im Tod festhält, denn "zum Dasein hat er alles geschaffen" und "hat keine Freude am Untergang der Lebenden" (Weish 1,14.13).
Davon, daß Gott seine Liebe zu uns durchhält, spricht das Alte Testament immer wieder. Der Gott des Bundes gibt sein Volk nicht auf. Er ist ihm verborgen in allem gegenwärtig, er weiß um die Not, die Bitterkeit und die Dunkelheit des Leides und des Todes. Gott läßt das Leid zu, aber er hört auch die Klage und sogar die Anklage der Menschen. Er nimmt nicht den Schmerz und den Tod aus der Welt hinweg, aber er läßt auch die Menschen, die ihn anrufen, nicht allein. Durch seine Nähe gewinnen sie Stärke, so daß sie das Leid zu tragen vermögen und letzte Grenzen in Frieden annehmen können. Die großen Beter des Alten Testamentes erfahren die Lebens- und Leidensgeschichte der Menschen so mit Gott verwoben, daß sie ihn als den mit den Menschen mitgehenden Gott verstehen.
Die Geschichte dieses Mitleidens Gottes findet ihren Höhepunkt und ihre Vollendung im Mitleiden und in der Hingabe Jesu für uns zu unserer Errettung von Sünde und Tod. Jesu Sterben und Tod ist nicht die Bejahung des Todes, sondern seine Überwindung.
- "Durch Christus und in Christus wird also das Rätsel von Schmerz und Tod hell, das außerhalb seines Evangeliums uns überwältigt. Christus ist auferstanden, hat durch seinen Tod den Tod vernichtet und uns das Leben geschenkt" (GS 22).
Auch in der tiefsten Dunkelheit und Ohnmacht am Kreuz steht Gott zu Jesus und bestätigt sein Ja zum Leben in der Auferweckung Jesu, die als Verheißung auch an uns Menschen ergeht. In dieser Verheißung liegt die kühnste Hoffnung für unser Sterben und unseren Tod. Sie nimmt uns nicht unsere Angst vor dem Tod, sie erspart uns nicht das bittere Durchleben der Phasen unseres Sterbens, aber sie gibt uns Gewißheit, daß Gott im Tod auch zu uns steht, daß wir nicht ins Nichts fallen, sondern in die Arme Gottes. Aus dieser Gewißheit beten und singen wir im großen Lobgesang, im "Te Deum":
- "Auf dich, o Herr, habe ich meine Hoffnung gesetzt.
- In Ewigkeit werde ich nicht zuschanden"
- (vgl. auch Gotteslob, Nr. 257, Strophe 11).
Aus dem glaubenden "Verstehen" des Todes wird für den Christen das "Bestehen" des Todes zur christlichen "ars moriendi", zur Kunst des Sterbens als vertrauendem Festhalten an Gott und Loslassen von uns selbst.
Im Sterben wird unser Glaube vor eine letzte Bewährungsprobe gestellt: vor die Bewährung des Glaubens als Festhalten an Gott, auf den wir vertrauen, daß er in seiner Treue zu uns steht und uns Zukunft und Leben schenkt, auch wenn der Augenschein dagegen spricht. Je mehr wir in den Anfechtungen des Lebens gelernt haben, in glaubendem Vertrauen an Gott festzuhalten, um so mehr werden wir auch in den Anfechtungen des Sterbens vertrauend zu Gottes Treue ja sagen können.
Mit diesem Festhalten an Gott verbindet sich das Loslassen von allen Bindungen und Sicherheiten des irdischen Lebens. Loslassen bedeutet, daß wir uns loslösen, leidend Verlust auf uns nehmen und nicht mehr festhalten an dem, woran wir im Leben gefesselt waren. Loslassen ist auch Abschiednehmen von Wünschen und unerfüllten Hoffnungen. Vom Glauben her gewinnen wir so die Freiheit, im Loslassen des Irdischen die Geborgenheit anzunehmen, die Gott uns schenkt, und uns tief verbunden zu wissen mit Christus, der für uns den Weg des Leidens und Sterbens gegangen ist. Wir dürfen teilhaben an diesem Weg (vgl. Kol 1,24), der zur Auferstehung führt. Solch eine Glaubenshaltung schenkt uns die Hoffnung und gibt dem Leiden einen Sinn. Die christliche Frömmigkeit hat von alters her diese Einstellung zu Leid und Tod auch als Aufgabe gesehen, die wir immer im Blick haben sollen:
- "Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinem Leiden; sein Tod soll mich prägen" (Phil 3,10).
5.2. Dienst an Kranken und Sterbenden
Krankheit, Sterben und Tod sind nicht nur ein Anruf, uns im Leben des Todes bewußt zu sein und uns in ein christliches Sterben einzuüben, sondern sie konfrontieren uns auch mit ethischen Problemen.
Wir wissen uns verantwortlich für die Erhaltung des Lebens, für die Förderung der Gesundheit, für die Bekämpfung und Heilung von Krankheit sowie für die Begleitung und Hilfe beim Sterben. Diesem Ziel dient auch das ärztliche und pflegerische Tun, dessen oberster Grundsatz das Wohl des Kranken im umfassenden Sinne ist. Im Christentum gilt der Dienst an den Kranken und Sterbenden seit jeher als "Werk der Barmherzigkeit".
In neuerer Zeit hat die Medizin in vielen Bereichen große Fortschritte erzielt. Alle diese Erfolge der modernen Medizin faszinieren uns. Kaum jemand möchte, wenn er krank wird, auf ihre Vorteile verzichten. Sofern sie eine Heilung und eine sinnvolle Lebensverlängerung bewirkt, ist sie auch sittlich zu bejahen.
Mehr und mehr kommen aber auch die möglichen Gefahren in den Blick, die mit der Anwendung der Technik in Kliniken und Krankenhäusern verbunden sein können.
Die Faszination des Machbaren kann eine gefährliche Veränderung in der Einstellung zum ärztlichen Können wie auch zum Sinn des Lebens und des Todes zur Folge haben. Wer unbegrenztes Vertrauen in die Technik setzt, wird das ärztliche Handeln als Reparatur oder als Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit von Organen verstehen und fordern, daß er behandelt wird, ohne zu fragen, ob die Behandlung zu einer sinnvollen Heilung oder Lebensverlängerung führt. Für ihn ist der Tod der ärgste Feind, der mit allen Mitteln und unter allen Umständen bekämpft und bis zum unausweichlichen Ende hinausgeschoben werden muß, sogar dann, wenn das nur um den Preis einer menschenunwürdigen Leidensverlängerung zu erreichen ist. Eine weitere Gefahr der Anwendung der gesamten Apparatemedizin besteht darin, daß dem Patienten, der dem ganzen Einsatz von Apparaten ausgesetzt ist, die Möglichkeit genommen werden kann, menschenwürdig seinen eigenen Tod zu sterben. Hier kann die Apparatemedizin inhuman werden.
Trotz der möglichen Gefahren, die der Einsatz der Technik in der Medizin mit sich bringen kann, wäre es aber unrealistisch und unredlich, diesen Einsatz von vornherein zu verwerfen. Die modernen Methoden der Untersuchung und Behandlung von Krankheiten haben für die Heilung und Erhaltung menschlichen Lebens unschätzbaren Wert.
Die eigentliche ethische Frage, die sich bei den modernen Möglichkeiten der Medizin stellt, lautet: Darf der Arzt, was die Medizin kann? Muß Leben unter allen Umständen erhalten und verlängert werden? Was ist am Ende des Lebens sittlich erlaubt, und was ist sittlich verboten?
Alle Versuche, auf diese und andere Fragen sittlich vertretbare Antworten zu geben, müssen davon ausgehen, daß über menschliches Leben, in welchem Stadium auch immer, nicht verfügt werden darf und daß der Mensch einen Anspruch auf ein menschenwürdiges Sterben hat. Daraus ergibt sich für den Umgang mit Kranken und Sterbenden in der letzten Lebensphase die Verpflichtung zur Hilfe beim Sterben und die Verpflichtung, menschliches Leben nicht zu töten.
In der öffentlichen Diskussion, im wissenschaftlichen Sprachgebrauch und in der Rechtssprache, aber auch in kirchlichen Dokumenten begegnet uns, wenn es um Sterbehilfe und Sterbebeistand geht, immer wieder der Begriff "Euthanasie".
Das Wort "Euthanasie" (eu-thanasia) bedeutet dem Wortsinn nach "sanfter Tod". In der Antike wurde der Begriff zunächst einfach im Sinne von "Hilfe zu einem guten Tod" aufgefaßt. In späterer Zeit verstand man darunter die absichtliche Verkürzung des Sterbeprozesses. Der Sterbende erfährt nicht eine Hilfe bei seinem Sterben, sondern sein Sterben wird durch Tötung abgekürzt. Im Nationalsozialismus verstand man unter Euthanasie die "Vernichtung lebensunwerten Lebens" und ordnete im "Euthanasieprogramm" die Tötung von Zehntausenden geisteskranker Menschen an. Es ging nicht um die Tötung Sterbender, sondern um die Vernichtung lebensfähiger Menschen.
Heute begegnen uns häufig die Begriffe "passive" und "aktive" Euthanasie. Unter passiver Euthanasie versteht man den Verzicht auf Anwendung von Mitteln, die bei einem Sterbenden zu einer kurzzeitigen Lebensverlängerung führen, aber eigentlich nur eine Leidensverlängerung bedeuten würden. Da es sich hierbei um Sterbenlassen, nicht aber um aktives Töten handelt, wird passive Euthanasie im allgemeinen als sittlich erlaubt angesehen. Allerdings wird ein Verzicht auf Anwendung von Mitteln zu einer aktiven Euthanasie, wenn es sich um eine schuldhafte Unterlassung handelt, in der die Absicht enthalten ist, das Leben vorzeitig zu beenden. - Aktive Euthanasie dagegen ist das direkte Eingreifen in den Sterbeprozeß durch Tötung des Patienten, auch wenn diese auf Wunsch des Patienten geschieht ("Tötung auf Verlangen"). Die Erklärung der Kongregation für die Glaubenslehre zur Euthanasie (1980) versteht unter Euthanasie "eine Handlung oder Unterlassung . . ., die ihrer Natur nach oder aus bewußter Absicht den Tod herbeiführt, um so jeden Schmerz zu beenden". Euthanasie findet sich also sowohl auf der Ebene der Intention als auch der angewandten Methoden (AAS 72, 1980, 542-555).
Um Mißverständnisse und Fehldeutungen zu vermeiden, sollte der Begriff Euthanasie nur im Sinne der aktiven Euthanasie als direkte Tötung eines Sterbenden (oder unheilbar Kranken) und als schuldhafter Verzicht auf eine geforderte Lebenserhaltung verwendet werden. In allen anderen Fällen sollte immer nur von Hilfe beim Sterben, von Sterbebeistand oder Sterbebegleitung die Rede sein.
Sterbehilfe als Sterbebeistand oder Sterbebegleitung will einem Sterbenden das Sterben erleichtern und ihm helfen, seinen eigenen Tod sterben zu können. Man könnte hier deshalb auch von Lebenshilfe für Sterbende sprechen. Eine solche Hilfe kann in mehrfacher Weise gewährt werden.
Viele Menschen sterben im hohen Alter ohne dramatische Operationen und Intensivtherapien. Für sie vollzieht sich das Sterben als Prozeß des Nachlassens der Kräfte, der Einengung der Erlebnisfähigkeit und des allmählichen Versagens der lebenserhaltenden organischen Funktionen. Sterbebeistand kann hier sinnvollerweise nur in der Anwendung von Mitteln bestehen, die schmerzlindernd wirken. In einer solchen Situation wäre es sinnlos, mit dem Einsatz aller verfügbaren Mittel ein Leben über seinen natürlichen Tod hinausschieben zu wollen. Der Respekt vor dem unausweichlichen Ende verlangt ein Zurücktreten und ein Annehmen des Todes. Über die normale ärztliche Hilfe hinaus ist der Sterbebeistand immer auch pflegerische Betreuung, personale Zuwendung und Begleitung, die dem Sterbenden die letzte Lebenszeit erleichtert und ihm ein christliches Sterben ermöglicht. Beistand oder Begleitung sucht heute die caritative Hospizbewegung durch Institutionen oder durch ambulante Gruppen zu bieten.
Ähnliches gilt auch für Situationen, in denen der Prozeß des Sterbens schon ganz auf das allmähliche Verlöschen der biologischen Funktionen eingeengt ist und dann noch plötzliche Komplikationen (zum Beispiel Lungenentzündung) hinzukommen, die den Sterbeprozeß verkürzen. Hier ist der Arzt in der Regel nicht verpflichtet, die Komplikationen zu bekämpfen, um nach kurzzeitiger Erhaltung des Lebens den Sterbenden erneut in die Not des Sterbens fallen zu lassen.
Häufig stellt sich die Frage, was zu tun erlaubt ist, wenn ein Kranker in der letzten Lebensphase schwere Schmerzen leidet, die nur durch Mittel zu bekämpfen sind, die neben der Schmerzstillung bei längerer Behandlung eine mögliche Verkürzung des Lebens zur Folge haben können. Diese Möglichkeit dürfte bei der heutigen Entwicklung von schmerzstillenden Medikamenten selten sein, ist aber nicht grundsätzlich auszuschließen. Dürfte ein Arzt, der um eine solche mögliche Nebenwirkung weiß, trotzdem solche Mittel verabreichen? Als eine Gruppe von Ärzten diese Frage an Papst Pius XII. richtete, antwortete er: "Wenn andere Mittel fehlen und dadurch den gegebenen Umständen entsprechend die Erfüllung der übrigen religiösen und moralischen Pflicht in keiner Weise verhindert wird, ist es erlaubt" (UG III, 5536). Es handelt sich hier nicht um eine absichtliche Tötung, sondern um ein Inkaufnehmen der Verkürzung des Lebens als Nebenwirkung der Schmerzlinderung.
Manchmal steht jemand, der an einem unheilbaren Leiden erkrankt ist und nach ärztlicher Diagnose und Prognose nicht mehr lange zu leben hat, vor der Frage, ob er sich noch einer Operation unterziehen soll, die den Tod zwar noch auf kurze Zeit hinausschieben könnte, aber auch schwere körperliche und geistige Beschwerden mit sich bringt. Wenn der Kranke sich bewußt und frei gegen die Operation entscheidet, ist die Entscheidung zu respektieren, denn der Kranke entscheidet anstelle einer sinnlosen Leidensverlängerung für ein bewußtes, menschenwürdiges Sterben (vgl. Die Deutschen Bischöfe: Das Lebensrecht des Menschen und die Euthanasie, 5).
Besondere Probleme bringen heute die medizinisch-technischen Möglichkeiten der Intensivtherapie mit sich. Ethisches Prinzip für die Findung des sittlich richtigen Urteils über den konkreten Einsatz von Intensivtherapien ist das Prinzip der Verhältnismäßigkeit (Proportionalität). Es besagt, daß eine richtige Abwägung der Mittel nur gelingen kann, "wenn die Art der Therapie, der Grad ihrer Schwierigkeiten und Gefahren, der benötigte Aufwand sowie die Möglichkeiten ihrer Anwendung mit den Resultaten verglichen werden, die man unter Berücksichtigung des Zustandes des Kranken sowie seiner körperlichen und seelischen Kräfte erwarten kann" (Erklärung der Kongregation für die Glaubenslehre zur Euthanasie vom 25. 5. 1980, 11).
Aus diesem Prinzip ergeben sich für das sittlich vertretbare Handeln in der Intensivtherapie wichtige Konsequenzen: Wenn ein Kranker Aussicht hat, durch Intensivtherapie die Gesundheit wiederzuerlangen, ist der Einsatz einer solchen Therapie sittliche Pflicht. Wenn dagegen jede Hoffnung auf Besserung ausgeschlossen ist und nur das Sterben künstlich verlängert würde, ist ein Verzicht auf diese Therapie keine ungerechtfertigte Verfügung über das Leben. In einer solchen Entscheidung wird die Sterblichkeit des Menschen und die von Gott gesetzte Frist geachtet. Für den Arzt setzt eine solche Entscheidung freilich die Zustimmung des Patienten oder, wenn das nicht mehr möglich ist, das Einverständnis der Angehörigen voraus. Die Achtung vor dem menschenwürdigen Sterben schließt auch die sittliche Erlaubtheit ein, eine künstliche Beatmung nicht mehr weiterzuführen, wenn es sich nur noch um die Erhaltung biologischer Funktionen handelt.
Bezüglich der absichtlichen Tötung eines unheilbaren Kranken oder eines Sterbenden stellt sich die Frage, ob extreme Situationen nicht Maßstäbe fordern, die über den Grundsatz der Unverfügbarkeit hinausgehen. Könnte es nicht mit dem christlichen Glauben vereinbar sein, einem Menschen, dessen qualvolles Leiden sinnlos zu sein scheint, auf dessen Wunsch die erlösende Spritze zu geben? Die christliche Ethik lehnt ein solches Vorgehen ab. Der Grund dafür ist die Überzeugung, daß das Leben als gottgeschenktes Leben in jedem Augenblick bis zu seinem irdischen Ende und darüber hinaus von Gott getragen und auf Gott verwiesen ist. Die aktive Beendigung des Lebens wäre eine unzulässige Totalverfügung. Überdies hat die moderne Medizin enorme Fortschritte in der Schmerzbekämpfung gemacht, so daß es nur noch ganz wenige Fälle gibt, in denen Schmerz als unerträglich empfunden wird.
Von dieser christlichen Sicht her gibt es kein Recht auf Tötung, wohl aber einen Anspruch auf ein menschenwürdiges Sterben. Das kann heute weithin dadurch gewährleistet werden, daß schmerzstillende Mittel verabreicht werden, die den physischen Schmerz erträglich machen. Das schließt freilich nicht aus, daß für einen Sterbenden die psychische Belastung so groß sein kann, daß sie ihn beinahe überfordert und so in ihm den Wunsch entstehen läßt, es möchte doch alles ein Ende haben. Eine solche Äußerung ist ein Anruf und eine Bitte um Hilfe. Auch dürfen wir nicht übersehen, daß in einer Gesellschaft, in der das schwache, kranke und sterbende Leben nicht mehr in die Leistungs- und Konsumwelt paßt, bei Kranken und Sterbenden leicht das Gefühl entsteht: Ich bin nichts mehr wert, ich lade den anderen nur Lasten, Kosten und Arbeit auf.
Es ist höchste Zeit, uns wieder bewußt zu werden, daß kein einziges menschliches Leben seinen Wert und seine Würde verlieren kann, wie elend und scheinbar nutzlos es auch sein mag. Krankheit, Leid und Hinfälligkeit gehören zu unserem Leben. Wir würden diese Wahrheit mißachten, wenn wir das Leid aus unserem Leben wegleugnen wollten und nicht mehr bereit wären, es auszuhalten.
Eine gesetzliche Freigabe der aktiven Tötung würde unabsehbare Folgen haben. Sie würde dem Mißbrauch Tür und Tor öffnen; sie würde bei Kranken in Kliniken und Krankenhäusern zu äußerster Verunsicherung führen; und sie würde das Vertrauen in die Ärzteschaft von Grund auf erschüttern. Ziel des ärztlichen Handelns ist die Heilung, die Schmerzlinderung und die personale Zuwendung, nicht aber die Verfügung über Leben und Tod. Deshalb ist es dem Arzt ethisch wie rechtlich nicht gestattet, einen Menschen zu töten, auch wenn dieser darum bittet. Wenn auch das Gesetz einen Arzt, der auf Wunsch ein todbringendes Mittel verschafft, das sich der Patient dann selber verabreicht, nicht bestraft, so ist doch ein solches Handeln als aktive Beihilfe zur Selbsttötung sittlich unerlaubt.
In manchen Krankenhäusern werden Formulare ausgeteilt, die als "Patienten-Testament" oder als "Patienten-Brief" bezeichnet werden. Diese sehen vor, daß Kranke nach ihrer Einlieferung, aber auch Gesunde, durch Unterschrift des Formulars ihren ausdrücklichen Willen über den Einsatz außergewöhnlicher medizinischer Mittel äußern. Durch ihre Unterschrift wird für den Fall der Bewußtlosigkeit die Zustimmung zu solchen ärztlichen Eingriffen verweigert, die nichts als eine Sterbens- und Leidensverlängerung bewirken.
Nicht wenige äußern grundlegende Bedenken gegen ein solches "Patienten-Testament". Sie verweisen darauf, daß die Situation, in der eine solche Unterschrift gegeben werde, nicht mit der zu vergleichen sei, die eintrete, wenn der Patient tatsächlich in einem Zustand sei, wie ihn das "Patienten-Testament" beschreibe. Hier könne der Wille möglicherweise ganz anders sein als der frühere. Sie lehnen deshalb eine Willenserklärung durch Unterschreiben eines "Patienten-Testamentes" ab.
Jedenfalls sollte, wer ein "Patienten-Testament" unterschreiben will, vorher genau prüfen, was unter Lebens- bzw. Leidensverlängerung zu verstehen ist. Wenn es sich um die Verlängerung des Sterbevorgangs handeln würde, der durch intensiv-therapeutische Maßnahmen technisch überfremdet wird, wäre das Recht des Unterzeichners sicherlich unbestritten, seine Zustimmung zu verweigern. Wenn es sich dagegen darum handeln würde, Leid überhaupt zu vermeiden, ginge es gar nicht um die Ermöglichung von menschenwürdigem Sterben, sondern um die Vermeidung von zugemutetem Leid. Hier wäre eine Unterschrift sittlich bedenklich, denn Leiden muß nicht von vornherein schon sinnlos sein. Durch Leiden kann der Christ zu einer tieferen Solidarität mit Christus heranreifen, der uns durch sein Leiden erlöst hat.
Christen bezeugen ihren Glauben durch ihre Liebe zu den Kranken und Gebrechlichen. Wo immer Menschen leiden, muß die christliche Hilfe sie suchen und ihnen in der Hilfe die Hoffnung und das Vertrauen auf die bleibende Liebe Gottes schenken. Im Sakrament der Krankensalbung spricht die Kirche den Kranken wirksam Heil und Heilung in Christus zu. In der tätigen Krankensorge widmet sie sich der leiblichen Betreuung von Kranken und Sterbenden. Die imponierende Geschichte der christlichen Caritas ist ein sichtbares Zeugnis christlichen Glaubens, der in der fürsorgenden Liebe wirksam wird.
5.3. Tod und Bestattung
Sterben und Tod gehören zum Leben. Sie sind das Ende der irdischen Pilgerschaft. Aus dem christlichen Glauben an die Auferstehung von den Toten ist in der Kirche seit früher Zeit das Gedächtnis der Toten und die Ehrfurcht vor dem toten Leib erwachsen. Diese christliche Haltung der Pietät führte dazu, daß in der Gesellschaft die kirchliche Beerdigung allgemein üblich wurde. Da die Menschen früher zumeist zu Hause starben, wurden die Verstorbenen dort bis zur liturgischen Feier der Einsegnung und Beerdigung aufbewahrt. So hatten die Trauernden Zeit, den Verstorbenen noch eine Weile bei sich zu haben, Abschied nehmen und ihre Trauer jeweils auf eigene Weise "verarbeiten" zu können.
Heute ereignet sich der Tod weitaus weniger in der Familie; er geschieht oftmals in Krankenhäusern und Altersheimen, unter Ausschluß der Öffentlichkeit. Wie Sterben und Tod in die gesellschaftliche Anonymität verbannt sind, so mehren sich auch die Beisetzungen in Grabfeldern ohne Namen und genaue Kennzeichnung der Lage des Grabes.
Die Gründe für diesen Wandel in der Einstellung zu Tod und Begräbnis sind verschieden. Sie können darin liegen, daß die christliche Sinngebung von Sterben und Tod, von Totengedenken und von Hoffnung auf ewiges Leben im Bewußtsein vieler Menschen schwinden; sie können aus der Erwägung erwachsen, daß oftmals keine Angehörigen mehr da sind, die am Grab beten oder die Grabpflege übernehmen könnten; und es spielen, besonders in den Großstädten und Ballungszentren, auch gesellschaftliche und ökonomische Überlegungen eine Rolle. Für viele ist die Urnenbeisetzung eine Selbstverständlichkeit geworden.
Bis zum Jahr 1964 war katholischen Christen nach kirchlichem Recht die Feuerbestattung untersagt. Das Verbot gründete weniger in dogmatischen Erwägungen als in einer Gegenreaktion gegen bestimmte Vereinigungen, in denen die Leichenverbrennung als Leugnung des Glaubens an die Auferstehung progagiert worden war. Heute ist die Feuerbestattung katholischen Christen erlaubt, wenn dadurch der christliche Glaube nicht ausdrücklich geleugnet werden soll.
Christen schmücken die Gräber ihrer Verstorbenen zum Zeichen des Gedenkens und der Liebe. Bei der Segnung der Gräber an Allerheiligen und Allerseelen bezeugen die Gemeinden ihre Verbundenheit mit den Verstorbenen in besonderer Weise. Tod und Trauer werden im Licht der Botschaft Jesu von der Auferstehung gesehen; gemeinsam bekennen sich die christlichen Gemeinden zur Hoffnung auf die Auferstehung.
Christen halten auch den Friedhof in hohen Ehren. Er ist der "Gottesacker", auf dem die Leiber der Gläubigen begraben sind, die in diesem Leben Tempel des Heiligen Geistes waren. Anlage und Ausstattung des Friedhofs sollen den christlichen Glauben an die Auferstehung bekunden (vgl. "Benedictionale" von 1979).
5.4. Organspende zur Rettung von Leben
In den weiten Bereich des Dienstes am Leben gehört auch die Möglichkeit, durch Übertragung von Gewebe und Organen anderen Menschen die Wiederherstellung der Gesundheit zu ermöglichen oder ihr Leben zu retten.
Den Anfang solcher Transplantationen bildete gegen Ende des vorigen Jahrhunderts die Übertragung der Hornhaut des Auges. Später wurde auch die Verpflanzung anderer Gewebe (Haut, Ohrenknorpel) möglich. In der Mitte des 20. Jahrhunderts setzte die Übertragung von Organen (Niere) vom lebenden Spender ein. Heute ist es möglich, auch andere Organe (Herz, Leber) von verstorbenen Spendern zu verpflanzen. Weniger erfolgreich ist bisher die Verpflanzung von Lunge und Bauchspeicheldrüse.
Eine wesentliche Steigerung der Zahl von Übertragungen und der Verbesserung der Ergebnisse gelang erst Mitte der achtziger Jahre, als wirksame Mittel eingesetzt werden konnten, mit deren Hilfe die körpereigene Abwehr gegen fremde Organe unterdrückt werden kann.
Die Möglichkeit, Organe zu übertragen, bringt Fragen und Probleme mit sich. Diese betreffen in unterschiedlicher Weise die Organübertragung von einem lebenden und von einem soeben verstorbenen Spender.
Eine Lebendspende ist ethisch allenfalls vertretbar, wenn es sich um Organe handelt, die, wie zum Beispiel die Niere, doppelt vorhanden sind. Außerdem kommt sie nur in Betracht, wenn das Leben und die Gesundheit des Spenders mit Sicherheit nicht gefährdet sind und mit Sicherheit davon ausgegangen werden kann, daß der Spender auch sonst keinen substantiellen oder irreparablen Schaden für das eigene Leben, die eigene Gesundheit oder seine Arbeitsfähigkeit davonträgt. Auf der anderen Seite muß für den Empfänger eine begründete Hoffnung bestehen, daß sein Leben durch die Organspende verlängert oder sein Gesundheitszustand nachhaltig verbessert werden kann. Schließlich muß die Organtransplantation die einzige Möglichkeit zur Rettung des Lebens des Empfängers sein. Eine weitere Voraussetzung ist, daß das Motiv der Spende die Liebe zum Nächsten ist und der Spender seine Einwilligung in voller Freiheit und nach reiflicher Überlegung und umfassender Aufklärung getroffen hat. Heute wird in der Medizin weithin auf Organverpflanzung von lebenden Spendern verzichtet. Sie kann nur in seltenen Grenzfällen unter dem Gesichtspunkt eines außergewöhnlichen persönlichen Opfers in Betracht kommen. Zu einem solchen Opfer darf niemand durch moralischen Druck veranlaßt werden.
Von anderer Art sind die Probleme, die sich bei der Verpflanzung von Organen soeben Verstorbener auf einen Empfänger ergeben, für den die Übertragung des Organs (Niere, Herz, Leber) lebensrettend oder lebensverlängernd ist.
Bei vielen Menschen bestehen tiefsitzende Ängste und Vorbehalte dagegen, nach dem Tod als Organspender zu dienen oder diese Entscheidung für einen verstorbenen Angehörigen zu übernehmen. Manche meinen, die Ehrfurcht vor dem toten Leib verbiete einen Eingriff in die körperliche Integrität des Verstorbenen. Andere befürchten, man könne als sterbenskranker Mensch vorschnell für tot erklärt werden.
Da eine Organentnahme von Verstorbenen nur dann sittlich erlaubt sein kann, wenn mit Sicherheit feststeht, daß der Organspender tot ist, erweist es sich als notwendig, den Eintritt des Todes einwandfrei festzustellen. Das Erlöschen wahrnehmbarer Lebenszeichen (der letzte Atemzug oder der letzte Herzschlag) zur Feststellung des Todes wird den Anforderungen der modernen Medizin nicht mehr gerecht, denn Kreislauf und Atem können auch künstlich aufrechterhalten werden. Viele setzen an die Stelle der früheren Todesdefinition (klinischer Tod) die Definition des "Hirntodes". Dieser besteht im vollständigen und unwiederruflichen Zusammenbruch der Gesamtfunktion des Gehirns. Die Feststellung des Hirntodes ist ein sicheres Anzeichen dafür, daß der Zerfall des ganzmenschlichen Lebens nicht mehr umkehrbar ist. Es ist von diesem Zeitpunkt an vertretbar, Organe für eine Organverpflanzung zu entnehmen.
Die Möglichkeit, den endgültigen Tod eines Menschen festzustellen, kann die Angst ausräumen, daß Organe entnommen werden, ehe der Mensch tot ist. Darüber hinaus ist die Entnahme von Organen Verstorbener an bestimmte Bedingungen gebunden, denn sie ist ein Eingriff in die Integrität des toten Leibes. Staatliche Gesetze regeln deshalb die Bedingungen für die Erlaubtheit der Organentnahme. Bedeutsam ist die vor dem Tod gegebene Einwilligung des Spenders oder bei Verstorbenen die Zustimmung der Angehörigen. "Organverpflanzung ist sittlich unannehmbar, wenn der Spender oder die für ihn Verantwortlichen nicht im vollen Wissen ihre Zustimmung gegeben haben" (KKK 2296). Nur in dringenden Fällen, in denen eine unmittelbare Organübertragung das einzige Mittel zur Rettung eines anderen Menschen ist, kann die Sorge für die Rettung dieses Lebens Vorrang vor dem Anspruch auf Wahrung der Integrität des toten Leibes haben. Staatliche Regelungen und ärztliche Richtlinien sollen dazu beitragen, daß Mißbrauch verhindert wird, zum Beispiel auch, daß Organe von lebenden wie von verstorbenen Menschen grundsätzlich nicht verkauft oder gekauft werden dürfen.
Die christlichen Kirchen sehen insgesamt in der Organspende eine Möglichkeit, über den Tod hinaus Nächstenliebe zu praktizieren, treten aber zugleich für eine sorgfältige Prüfung der Organverpflanzung im Einzelfall ein (vgl. "Gott ist ein Freund des Lebens. Herausforderungen und Aufgaben beim Schutz des Lebens", Gemeinsame Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz und des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, VI, 4: Organverpflanzung). Ein Spenderausweis kann nicht befohlen werden; die Einwilligung muß frei und gewissenhaft gefällt und vom Motiv der Liebe getragen sein.
6. Verantwortung für den Frieden
6.1. Das "Evangelium vom Frieden" (Eph 6,15)
Das fünfte Gebot verbietet den Mord und fordert den Frieden zwischen einzelnen Menschen sowie zwischen Gruppen, Völkern und Staaten. Wenngleich in der Perspektive des Alten Testaments das fünfte Gebot nicht auf die Tötung im Krieg bezogen wurde, liegt doch der Sinn dieses Gebotes darin, das friedliche Zusammenleben aller Menschen zu wahren und zu fördern.
Kaum ein anderes Wort ist heute so sehr in aller Mund wie das Wort Frieden. Im Ruf nach Frieden spricht sich die Sehnsucht nach einer Welt aus, in der die Feindschaften abgebaut sind und alle Menschen in Freiheit und Gerechtigkeit zusammenleben können.
Wir erfahren unsere Zeit als Zeit der Kriege wie als Zeit konfliktgeladener Abwesenheit von Krieg, als Zeit der Bürgerkriege, revolutionärer Aufstände und sozialer Unruhen. Wo Spannungen und Konflikte überhandnehmen, zögern wir, auch wenn kein Krieg ist, von wirklichem Frieden zu sprechen.
Als Christen sind wir trotz dieser Erfahrungen davon überzeugt, daß Frieden möglich ist, weil Gottes Bundestreue die Menschen seit Abraham begleitet und uns im "Evangelium vom Frieden" (Eph 6,15) schon anfanghaft der "Friede Gottes" geschenkt wurde, "der alles Verstehen übersteigt" (Phil 4,7). Darum denken wir den Gedanken des Friedens von dem größeren und umfassenderen Frieden her, der in der Verheißung Gottes gründet, in Jesus Christus schon begonnen hat und am Ende der Zeiten in der Fülle der Gottesherrschaft vollendet wird. Dieser Frieden ist Grundlage und Voraussetzung des Friedens mit uns selbst und des Friedens unter den Menschen. "Der irdische Friede ist Abbild und Frucht des Friedens Christi. . . . Durch sein am Kreuz vergossenes Blut hat er ,in seiner Person die Feindschaft getötet` . . ., die Menschen mit Gott versöhnt und seine Kirche zum Sakrament der Einheit des Menschengeschlechts und dessen Vereinigung mit Gott gemacht" (KKK 2305).
Das alttestamentliche Gottesvolk gründet seine ganze Existenz in der gnadenhaften Auserwählung Gottes. Im "Bund des Friedens" (Num 25,12; Jes 54,10; Ez 34,35) erfährt Israel sein Heil als Geborgenheit und Sicherheit (Ps 91; vgl. Ps 57,2; 36,8; 63,8). Gott hält seine Hand über das Volk. "Ich gehe in eurer Mitte; ich bin euer Gott" (Lev 26,12). Er gewährleistet Frieden als Frieden mit Gott, als Frieden im Volk und als Wohlergehen des Volkes in Freiheit, Gerechtigkeit und Sicherheit. Diesen Frieden meinen die Menschen, wenn sie einander "Schalom" wünschen. Schalom als Friede ist Gabe Gottes und zugleich Aufgabe der Menschen; Schalom ist "Werk der Gerechtigkeit" (Jes 32,17), Einhalten der Lebensordnung Gottes, Halten seiner Gebote, die er seinem Bund als Ordnung des Rechts und der Sittlichkeit eingestiftet hat. Schalom gipfelt in der Forderung: "Meide das Böse, und tu das Gute; suche Frieden, und jage ihm nach!" (Ps 34,15).
Israel, das als "Zeuge für die Völker" (vgl. Jes 52,7) den Frieden weitergeben sollte, hat in dieser seiner Bestimmung immer wieder versagt, indem es sich auf die eigene Stärke verließ, statt auf Gott zu vertrauen (Jes 7,1-9; 30,1-4; Jer 37,10). Aber trotz der Untreue des Volkes hält Gott an seiner Verheißung fest.
- "Am Ende der Tage wird es geschehen", daß alle Völker zum Berg des Herrn ziehen. Dann spricht er "Recht im Streit der Völker, er weist viele Nationen zurecht. Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen. Man zieht nicht mehr das Schwert, Volk gegen Volk, und übt nicht mehr für den Krieg" (Jes 2,2-4; vgl. Mi 4,3).
Die Friedensvision der Propheten verbindet sich mit der Erwartung eines königlichen Heilbringers, mit dem Gott ein Zeitalter des Friedens einleiten wird (vgl. Jes 9,3f). Er erhält u.a. den Titel "Fürst des Friedens" (Jes 9,5), "eines Friedens ohne Ende" (Jes 9,6). Seine Ära wird (Jes 11,6-9) mit dem Bild vom endzeitlichen "Tier-Frieden" vergegenwärtigt. Er selbst wird "der Friede" (Mi 5,4) sein.
Das neutestamentliche Evangelium vom Frieden klingt schon im Engelsgesang auf dem Hirtenfeld in Betlehem auf: "Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade" (Lk 2,14). Der Friede, der im Alten Testament ersehnt wird, erfüllt sich jetzt im Kommen des Retters, des Messias Jesus (Lk 2,11). Dieser Friede ist ein Gnadengeschenk Gottes, das Jesus den Menschen vermitteln will. Dazu gehört zuerst die von Gott gewährte Versöhnung (vgl. 2 Kor 5,18), die Befreiung von Sünde und Schuld (Lk 7,50), doch darüber hinaus alles, was mit der hereinbrechenden Herrschaft Gottes unter den Menschen Wirklichkeit wird und werden soll. Jesus ist der Friedensbringer (Eph 2,14), der die bisher getrennten Menschheitsgruppen (Juden und Heiden) mit Gott und untereinander versöhnt hat (Eph 2,17f). So soll sich der von Christus gebrachte Friede in der Menschheit auswirken. Jesus preist die Friedensstifter selig; denn sie werden Söhne Gottes genannt werden (Mt 5,9). Wer Gott in seinem Friedenswillen nachahmen will, muß bereit sein, sich mit dem Gegner zu versöhnen (vgl. Mt 5,25), auf Gewalt zu verzichten (Mt 5,43-48), ja die Feinde zu lieben und für die Verfolger zu beten (Mt 5,43-48).
Die Urkirche sah diese Forderungen Jesu auf höchste Weise in ihm selbst erfüllt, der "geschmäht wurde, aber nicht schmähte, der litt, aber nicht drohte" (1 Petr 2,23). Dem Beispiel seines Herrn folgend, betet Stephanus, der erste Blutzeuge, für seine Verfolger (Apg 7,59f). Die Friedensgesinnung, die sich in Taten der Versöhnung und Liebe erweisen soll, hat sich der Urkirche als Vermächtnis Jesu tief eingeprägt.
Der Utopie eines irdischen, in der Geschichte erreichbaren universalen Friedensreiches, als könnten Menschen ein solches schaffen, ist die Urkirche nicht erlegen. Aber sie wollte im Geist Jesu, nach seiner Weisung und seinem Vorbild alle Kraft darauf verwenden, den Frieden Gottes unter den Menschen und in der Völkergemeinschaft zu verbreiten. Die in der Botschaft Jesu liegende Verheißung eines "Friedens auf Erden" wird sich erst in der kommenden Welt Gottes ganz erfüllen, wenn die Gewalten des Bösen endgültig besiegt sind und das Reich Gottes in seiner Herrlichkeit erscheint (vgl. Offb 21).
Als Glaubende wissen wir, daß mit dem Kommen Jesu Christi der Friede Gottes als "Gerechtigkeit Gottes" schon gegenwärtig ist. Wenn wir uns durch den "Dienst der Versöhnung" (2 Kor 5,18) mit Gott versöhnen lassen und so in seinem Frieden leben, können wir das "neue Gesetz" der Liebe und die "neue Gerechtigkeit" erfüllen. Wir sollen in der Nachfolge Christi und im Geist der Brüderlichkeit Friedensstifter sein.
6.2. Friedensförderung: Wahrung der Gerechtigkeit und Achtung der Rechte
Heute rückt das Wort vom Frieden als "Werk der Gerechtigkeit" (Jes 32,17) und "Frucht der Liebe" (GS 78) in den Mittelpunkt:
- "Der feste Wille, andere Menschen und Völker und ihre Würde zu achten, gepaart mit einsatzbereiter und tätiger Brüderlichkeit - das sind unerläßliche Voraussetzungen für den Aufbau des Friedens" (GS 78).
Wo immer Ungerechtigkeit die Beziehungen zwischen Staaten belastet, ist der Frieden bedroht. "Um den Frieden aufzubauen, müssen vor allem die Ursachen der Zwietracht in der Welt, die zum Krieg führen, beseitigt werden, an erster Stelle die Ungerechtigkeiten" (GS 83).
Friedensförderung, die der Ungerechtigkeit und der Verletzung elementarer Rechte der Menschen und Völker weltweit entgegenwirkt, behebt so entscheidende Ursachen, die immer wieder in der Geschichte zu Kriegen führten. Sie bildet die zentrale Aufgabe von Kirche in der Treue zu Gott, der sich als Befreier der Unterdrückten und Anwalt der Armen offenbart und Gerechtigkeit gegenüber dem Nächsten fordert. Friede wird dann auch politisch als ein Prozeß verstanden, in dem universale Rechtsverwirklichung an die Stelle der Waffengewalt tritt und diese erübrigt. Das friedliche Zusammenleben der Menschen und Völker soll so "auf die Achtung vor den Rechten aller und auf die Anerkennung des menschlichen Gemeinwohls in Frieden und Gerechtigkeit" gegründet werden (GF 37).
Vorrangiges Feld solcher Friedensförderung ist die Achtung und Wahrung der individuellen, politischen und sozialen Menschenrechte. Wir sind aufgerufen, immer und überall dafür einzutreten, daß Menschenrechtsverletzungen eingestellt werden, Unrechtssysteme sich wandeln und die Rechte aller Anerkennung finden.
- "Um bei der wachsenden gegenseitigen Abhängigkeit aller Menschen und aller Völker auf dem ganzen Erdkreis das allgemeine Wohl der Menschheit auf geeignetem Weg zu suchen und in wirksamer Weise zu erreichen, muß sich die Völkergemeinschaft eine Ordnung geben" (GS 84).
Das Recht jedes einzelnen auf Leben und Entfaltung (PP 15) wird in Frage gestellt und verletzt, solange die Lebens- und Entfaltungschancen so ungleich verteilt sind. Entwicklung ist "der neue Name für Friede" (Papst Paul VI.). Sie ist nicht nur Sache des einzelnen und der Gemeinschaft, in der er lebt: "Die allseitige Entwicklung des Einzelmenschen muß Hand in Hand gehen mit der Entwicklung der gesamten Menschheit: beide müssen sich wechselseitig unterstützen" (PP 43). Die Förderung internationaler Gerechtigkeit gehört darum zu den vorrangigen Friedensaufgaben; sie ist eine "Schicksalsfrage der Menschheit". Am dringendsten ist die Bekämpfung der Armut, unter der viele Millionen Menschen leiden. Das Ausmaß der Verschuldung vieler Entwicklungsländer fordert darüber hinaus eine Änderung in den weltwirtschaftlichen Beziehungen:
- "Dieser Friede kann auf Erden nicht erreicht werden ohne Sicherheit für das Wohl der Person und ohne daß die Menschen frei und vertrauensvoll die Reichtümer ihres Geistes und Herzens miteinander teilen" (GS 78).
6.3. Friedenssicherung: Sicherheit für alle
Nächstenliebe und Menschenrechte sowie die Forderung nach Überwindung der Gewalt in den Beziehungen der Staaten fordern, Arme, Unterdrückte und Entrechtete wirksam gegen ihre Unterdrücker zu schützen, dem Unrecht zu wehren, Recht und Gerechtigkeit zu verteidigen.
Wer soll diesen Schutz leisten? Er ist Aufgabe der staatlichen Gewalt, die sich dafür im Interesse des Gemeinwohls unter Berücksichtigung der Angemessenheit im äußersten Fall auch staatlicher Machtmittel bedient. Staatliche Gewalt, die im Staat selbst das Recht auf der Basis der Menschenrechte wahrt und Unschuldige gegen Unterdrückung schützt, steht "im Dienst Gottes" (Röm 13,4).
Auch in ihren Außenbeziehungen haben die Staaten die Pflicht, friedliche Beziehungen zu den anderen Staaten zu entwickeln sowie durch Abmachungen, Verträge und die Fortentwicklung internationaler Institutionen dafür zu sorgen, daß Konflikte auf der Basis des Völkerrechts gewaltfrei gelöst werden. Dennoch sind Androhung und Anwendung kriegerischer Gewalt zwischen Staaten aus der politischen Praxis auch heute nicht auszuschließen. So stehen Politiker immer wieder vor der Frage, wie der Frieden wirksam gesichert werden kann.
Was sagt die Kirche zu dieser Aufgabe der Friedenssicherung? Ist es verantwortbar, Frieden notfalls auch mit militärischen Mitteln zu sichern? Die Antwort orientiert sich heute an dem Ziel, eine Friedensordnung für alle Völker auf der Basis eines allgemein anerkannten und verbindlichen Völkerrechts unter Beachtung der Menschenrechte zu schaffen (vgl. GS 84). Dabei stellte sich die Frage der sittlich erlaubten Gewaltanwendung für die Christen zu jeder Zeit neu.
Für die Christen der ersten drei Jahrhunderte stand diese Frage zunächst unter dem dreifachen Aspekt der Einstellung zum damaligen heidnischen Staat, der Teilnahme am heidnischen Opferkult, zu dem Soldaten als Zeichen der Loyalität gegenüber dem Kaiser verpflichtet waren, und der Teilnahme an Militärdienst und Krieg. In der Spannung zwischen Loyalität zum Staat als Ordnungsmacht und der Weigerung, am heidnischen Kult teilzunehmen sowie Menschen zu töten, kam es noch zu keiner einheitlichen Haltung.
Zu Beginn des 4. Jahrhunderts wurde die Frage neu aufgeworfen, als die Christen im Staat selbst politische Verantwortung zu übernehmen hatten. Die Synode von Arles (314) erklärte, daß ein Soldat den Dienst in Friedenszeiten nicht verlassen dürfe, aber im Krieg nicht zum Töten verpflichtet sei.
Als erster entwickelte Augustinus (+ 430) eine christliche Lehre vom Frieden, in der er sich auch mit der Frage befassen mußte, ob Kriege, da sie ein schweres Übel für die Menschen sind, überhaupt sittlich gerechtfertigt werden können. Nach Augustinus kann ein Krieg nur als "gerecht" angesehen werden, wenn er dem Frieden dient, sich gegen begangenes Unrecht richtet, von der legitimen Autorität angeordnet wird und die Kriegsführung sich auf das unbedingt erforderliche Maß an Gewalt beschränkt.
Im Mittelalter baute Thomas von Aquin (+ 1274) diese Lehre aus. Er betont, daß es Situationen gibt, in denen sich der Fürst für den Krieg entscheiden muß. Doch auch dann bleibt der erlaubte Krieg stets an folgende drei Bedingungen geknüpft: Erstens an die Vollmacht des Regierenden, auf dessen Befehl hin der Krieg geführt werden muß. Zweitens muß ein gerechter Grund vorliegen. Drittens müssen die Kriegführenden die rechte Absicht haben (S. th. II II q. 40, art. 1). Außerdem kann ein Krieg nur sittlich erlaubt sein, um einen besseren Frieden zu erreichen, der die durch schweres Unrecht gestörte Ordnung wiederherstellt oder schweres Unrecht abwehrt.
In der Neuzeit hat Francisco de Vitoria (+ 1546) angesichts der Entdeckung Amerikas und der entstehenden souveränen Staaten das Völkerrecht als gemeinsame Rechtsbasis für alle Völker, Staaten und Kulturen grundgelegt. Gerecht kann nur der Krieg sein, der, nachdem alle friedlichen Mittel ausgeschöpft sind, im Interesse des weltweiten Gemeinwohls mit angemessenen Mitteln das Völkerrecht wahrt, indem geschehenes Unrecht abgewehrt oder drohendes Unrecht verhindert wird.
In der Folgezeit ist die "klassische" Lehre vom gerechten Krieg in der Völkerrechtswissenschaft selbständig behandelt und entscheidend umgewandelt worden. Die Frage nach dem gerechten Grund eines Krieges wurde ausgeklammert, da sie niemand mehr allgemeinverbindlich beantworten konnte. Der Krieg wurde zum Mittel absolut-souveräner staatlicher Politik, dessen sich eine Regierung nach Belieben bedienen durfte, wenn er nur den Interessen des eigenen Volkes diente.
In den Bemühungen um das Völkerrecht konnte es nur noch darum gehen, Regeln der Kriegsführung aufzustellen, um wenigstens seine Folgen zu mildern. Die großen Kriegsschäden der beiden Weltkriege unseres Jahrhunderts, mehr noch der Einsatz von Massenvernichtungsmitteln, führten zu der Einsicht, daß es "sinnlos" und "wider die Vernunft" ist, "den Krieg als geeignetes Mittel zur Wiederherstellung verletzter Rechte zu betrachten" (PT 127). Es wurde nötig, "die Frage des Krieges mit einer ganz neuen inneren Einstellung zu prüfen" (GS 80).
Am Beginn dieser Entwicklung steht die Forderung Papst Pius' XII. nach absoluter Ächtung des Angriffskrieges. Das Zweite Vatikanische Konzil nennt als grundlegendes Ziel christlichen Friedenshandelns eine Friedensordnung, die die Institution des Krieges abschafft und dem allgemeinen Wohl der Menschheit dient (vgl. GS 84).
Der politische Prozeß auf eine Friedensordnung der Völkergemeinschaft hin kann aber auch heute noch durch einen Bruch völkerrechtlichen Kriegsverbots gefährdet werden. So ist die Völkergemeinschaft als ganze betroffen, wenn das Kriegsverbot gebrochen und ein Staat oder Volk angegriffen wird.
- "Solange die Gefahr von Krieg besteht und solange es noch keine zuständige internationale Autorität gibt, die mit entsprechenden Mitteln ausgestattet ist, kann man, wenn alle Möglichkeiten einer friedlichen Regelung erschöpft sind, einer Regierung das Recht auf sittlich erlaubte Verteidigung nicht absprechen" (GS 79).
Jede Form der Gewaltanwendung ist ein schweres Übel. Doch behält innerhalb einer umfassenden Friedensethik der Kerngehalt der Lehre von der "gerechten Verteidigung" eine bis jetzt unersetzliche Funktion, nämlich "im Hinblick auf den Grenzfall einer fundamentalen Verteidigung des Lebens und der Freiheit der Völker, wenn diese in ihrer elementaren physischen und geistigen Substanz bedroht oder sogar verletzt werden" (GF 41).
Das Verteidigungsrecht gilt nicht unbegrenzt, es unterliegt vielmehr erheblichen, sittlich verpflichtenden Einschränkungen:
- Schon im Vorfeld eigentlicher Gewaltanwendung steht die Forderung: Nur solche und so viele militärische Mittel dürfen bereitgestellt werden, wie zur Verteidigung unbedingt erforderlich sind (Prinzip der Hinlänglichkeit). Ein Wettrüsten widerspricht diesem Prinzip. Darum hat das Zweite Vatikanische Konzil das Wettrüsten ausdrücklich gebrandmarkt.
- Verteidigung mit militärischen Mitteln darf erst als letztes Mittel (ultima ratio) angewendet werden, nachdem alle gewaltfreien Maßnahmen der Konfliktlösung ausgeschöpft sind.
- Da Verteidigung nur zur Abwehr und Verhinderung von Gewalt sittlich erlaubt ist, gibt es für die direkte Gewaltanwendung gegen die Zivilbevölkerung keine Begründung, sie ist verboten (Prinzip der Unterscheidung). Daher erklärt das Zweite Vatikanische Konzil: "Jede Kriegshandlung, die auf die Vernichtung ganzer Städte oder weiter Gebiete und ihrer Bevölkerung unterschiedslos abstellt, ist ein Verbrechen gegen Gott und den Menschen, das fest und entschieden zu verurteilen ist" (GS 80).
- Sittlich erlaubt ist die Verteidigung, die das geringere Übel darstellt. Daher ist zwischen den Übeln, die durch die Verteidigung bewirkt werden, und den Übeln, die ohne Verteidigung zugelassen werden, abzuwägen (Prinzip der Verhältnismäßigkeit). "Wenn die Schäden, die er (ein Krieg) nach sich zieht, unvergleichlich größer sind als die der ,geduldeten Ungerechtigkeit`, kann man verpflichtet sein, die ,Ungerechtigkeit auf sich zu nehmen`" (Papst Pius XII., UG 2366).
Nach dem offiziellen Ende des kalten Krieges, der Beendigung der gegenseitigen Abschreckung und der Wende im gesamten Bereich des früheren "Ostblocks" war die Hoffnung entstanden, daß die Phase der gegenseitigen Bedrohung überwunden sei und sich neue Möglichkeiten in Richtung auf eine umfassende Weltfriedensordnung eröffnen würden.
Ungeachtet dieser hoffnungsvollen Entwicklung sind neue Gefahren entstanden: Die heute mögliche Solidarität aller Völker in der einen Völkergemeinschaft, der Ausbau des verbindlichen Völkerrechts und der rechtssichernden Institutionen werden auch durch neuen Nationalismus und durch innere Ungefestigtheit vieler Staaten eingeengt. Umweltzerstörungen, sich ausbreitende Armut und Hungerkatastrophen bringen zudem immer neue Flüchtlingsströme hervor. Der ungebremste Waffenhandel und die Weiterverbreitung neuer Technologien zur Herstellung von wissenschaftlich hochentwickelten Waffen bergen die Gefahr, daß regionale Konflikte gewaltsam ausgetragen werden und sich ausweiten. Die Mißachtung der Rechte von Minderheiten und Volksgruppen trägt den Keim des Bürgerkriegs in sich.
Diesen weltweiten Gefährdungen des Friedens kann die Völkergemeinschaft nur in gemeinsamer Anstrengung begegnen. Sie verdeutlichen die Notwendigkeit der Friedensförderung, damit auch durch unser Verschulden nicht neue, vermeidbare Kriegsursachen entstehen. Wir müssen uns mit einer ganz neuen Einstellung der Friedensaufgabe stellen.
Was kann die Kirche tun, damit in dieser Zeit, in der eine neue internationale Ordnung noch nicht geschaffen ist, der Frieden gesichert und gefördert wird?
Gerade unter den veränderten weltpolitischen Bedingungen betont die Kirche, daß die Bekämpfung der Kriegsursachen und die Kriegsverhütung die primären Zielsetzungen aller Friedenssicherung bleiben. Sie sind nur in internationaler Solidarität zu erreichen. Auch wenn den einzelnen Staaten, solange eine wirksame Weltautorität diese Aufgabe nicht übernimmt, nach wie vor das Recht auf Verteidigung in den Grenzen des Völkerrechts und der politischen Ethik eingeräumt werden muß, sind sie streng verpflichtet, alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Instrumente gewaltfreier politischer Konfliktregelung und Streitbeilegung weiter auszubauen, zu stärken und bei Bedarf anzuwenden.
Über den Vorschlag des Zweiten Vatikanischen Konzils hinaus, "eine von allen anerkannte öffentliche Weltautorität" einzusetzen, "die über wirksame Macht verfügt, um für alle Sicherheit, Wahrung der Gerechtigkeit und Achtung der Rechte zu gewährleisten" (GS 82; GF 48), haben die Deutschen Bischöfe vorgeschlagen, zur Durchsetzung des internationalen Rechts einen "Weltgerichtshof einzurichten, dessen Entscheidungen bindend sind und mit entsprechender Sanktionsgewalt durchgesetzt werden können" (GF 48). Solange das Ziel einer wirksamen Weltfriedensordnung noch nicht erreicht ist, müssen Zwischenlösungen gesucht werden, um den Frieden zu sichern. Die einzelnen Staaten müssen bereit sein, einerseits auf Souveränitätsrechte zu verzichten, andererseits eigene, auch militärische Beiträge zu dieser internationalen Aufgabe zu leisten. "Wir sind aufgerufen . . . zu tätiger Solidarität . . . mit der Völkergemeinschaft in der Verteidigung einer gerechten internationalen Ordnung" (Wort der Deutschen Bischöfe zum Golfkrieg vom 21. 2. 1991, 100).
Was das Zweite Vatikanische Konzil und die Päpste seitdem für den Aufbau der internationalen Gemeinschaft fordern, gewinnt neue Dringlichkeit, aber auch größere Chancen der Verwirklichung: internationale Anerkennung und Durchsetzung der Menschenrechte, Förderung der Demokratie, verstärkte internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, Bekämpfung der Armut. Auch die verschiedenen internationalen katholischen Organisationen können auf vielfache Weise zum Aufbau einer friedlichen und brüderlichen Völkergemeinschaft beitragen.
6.4. Friedenshoffnung: Gewaltverzicht und Nächstenliebe
Die erste und wichtigste Aufgabe der Kirche bei der Bezeugung des Evangeliums vom Frieden besteht darin, die Weisungen der Bergpredigt im Bewußtsein der einzelnen wie der Völker wachzuhalten. Sie dürfen von niemand abgeschwächt werden. Das Ethos der Bergpredigt ruft uns in eine neue Existenz, die sich nicht vom Gedanken der Vergeltung leiten läßt. Dieses Ethos soll nicht nur innere Gesinnung sein, sondern auch im konkreten Leben und in der Politik wirksam werden. Wer für gewaltfreie Lösungen von Konflikten eintritt, handelt im Geist der Bergpredigt. Sie lädt uns ein, Gefahren und Bedrohungen als Herausforderung zu mutigem Handeln zu begreifen, das sich mit dem bestehenden Zustand nicht zufriedengibt. Wir sind aufgerufen, "Verhaltensweisen und Lebensformen zu entwickeln, die Gottes größere Gerechtigkeit schon hier und jetzt bezeugen: Wir müssen schon jetzt jene Ordnung des Friedens vorbereiten, die zu ihrem Schutz keiner Androhung von Gewalt bedarf, sondern auf wechselseitiges Vertrauen und auf Gerechtigkeit gegründet ist" (GF 57).
Völkerrecht und politische Ethik fordern, die Androhung und Anwendung von Gewalt aus den internationalen Beziehungen auszuschließen oder wenigstens allmählich zu vermindern. Das ergibt sich auch als Konsequenz aus dem christlichen Ethos der Gewaltlosigkeit. So kann man in konsequenter Kriegsächtung auch einen Schritt sehen, wie die Gewaltlosigkeitsforderung der Bergpredigt auch in der Außenpolitik wirksam werden kann und muß.
Die eigene Sicherheit ist heute nur noch zusammen mit der Sicherheit der anderen zu haben. Ihre Erfahrungen und Interessen, Erkenntnisse und Wertungen müssen in die eigenen Überlegungen einbezogen werden. Wer im anderen einen ihm gleichwertigen Menschen zu sehen vermag, wird immer neu auf ihn zugehen und auf seine Vorstellungen und Absichten hören. Er wird auch die Politik nach der Goldenen Regel der Bergpredigt ausrichten: "Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen" (Mt 7,12) (vgl. GF 19,41).
Auf diese Weise sollen die Forderungen Jesu zu Gewaltlosigkeit und Nächstenliebe auch in den gesellschaftlichen und politischen Strukturen zur Geltung kommen. Heute wird diese Orientierung an den Weisungen der Bergpredigt erleichtert, weil biblische Botschaft und Erfordernisse der Gegenwart deutlicher als früher in die gleiche Richtung weisen (vgl. Gemeinsame Synode, Beschluß: Entwicklung und Frieden 2.2.1; GF 20).
6.5. Erziehung zum Frieden, Dienst am Frieden
In der Geschichte des Christentums begegnen uns große Gestalten, die im Geist der Bergpredigt als Friedensstifter gewirkt haben: Papst Leo der Große, Hildegard von Bingen, Franz von Assisi, Niklaus von Flüe, Thomas Morus, Charles de Foucauld und viele andere Männer und Frauen, deren Namen oftmals nicht in den Geschichtsbüchern stehen. Sie lebten den Gedanken der radikalen Liebe beispielhaft vor und wurden in einer Weise zu Zeugen der Botschaft Jesu, die viele andere in ihren Bann zieht. Heute steht jeder einzelne Christ vor der Frage nach dem konkreten Friedenshandeln in seiner Lebenswelt. Viele, insbesondere junge Christen sehen in der von Christus geschenkten "Freiheit zur Liebe", die keine Parteilichkeit kennt und niemand von der Liebe ausschließt, die entscheidende Grundkraft ihres Friedensdienstes. Liebe, die den anderen als Bruder und Schwester anerkennt, überbietet eigene wie fremde Rechtsansprüche; sie durchbricht Aggressivität und Feindschaft; sie sucht Konflikte und Konfrontationen mit friedlichen Mitteln zu lösen und die anderen für Frieden und Versöhnung zu gewinnen. Daraus ergeben sich für jeden einzelnen wichtige Konsequenzen.
Eine erste Konsequenz ist die Einübung friedlicher Einstellungen und Verhaltensweisen in der heutigen Lebenswelt: in der Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz, im Freundeskreis, in Gruppen und Organisationen, in der Kirche:
- Bereitschaft, den anderen Menschen unvoreingenommen zu sehen, andere Gruppen und Völker kennenzulernen und sie in ihrem Anderssein anzunehmen;
- Rücksicht auf fremde Bedürfnisse und Klärung der eigenen;
- Abbau von Vorurteilen und Feindbildern;
- Änderung von friedensgefährdenden Einstellungen und Verhaltensweisen;
- Fähigkeit zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit und zum Kompromiß;
- Parteinahme zugunsten Benachteiligter, auch im Hinblick auf die Not in der dritten Welt;
- Mitwirkung bei der Überwindung von Unrechtszuständen.
Eine weitere Konsequenz ist die Mitwirkung in Initiativen, Gruppen und Diensten. Darum engagieren sich Christen in der Ausländer- und Asylantenarbeit oder in Dritte-Welt-Gruppen und Menschenrechtsgruppen.
Einzelne oder Gruppen geben oft beispielhaft Zeugnis für die Liebe zu allen Menschen. In der Haltung der Gewaltlosigkeit suchen sie den Mechanismus der Gewaltanwendung zu durchbrechen. Sie verstehen ihr Handeln als radikales Zeugnis des Pauluswortes: "Vergeltet niemand Böses mit Bösem! Seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht! Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden . . . Laß dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute" (Röm 12,17-18.21).
In besonderer Weise sehen sich junge Wehrpflichtige mit der Frage konfrontiert, welche Folgerungen sie aus der Bergpredigt für ihr Handeln ziehen sollen. Sie sehen sich vor die Entscheidung gestellt, ob sie den Wehrdienst leisten oder ihn aus Gewissensgründen verweigern sollen, um dann Zivildienst zu leisten.
In beiden Fällen haben die jungen Menschen, wenn sie eine verantwortete Entscheidung fällen, Anspruch auf Achtung und Solidarität (vgl. Beschluß: Entwicklung und Frieden 2.2.4). Die Kirche stellt dem einzelnen dabei ethische Gesichtspunkte vor Augen, die für eine solche Entscheidung maßgebend sind.
Zum Dienst des Soldaten erklärt das Zweite Vatikanische Konzil: "Wer als Soldat im Dienst des Vaterlandes steht, betrachte sich als Diener der Sicherheit und Freiheit der Völker. Indem er diese Aufgabe recht erfüllt, trägt er wahrhaft zur Festigung des Friedens bei" (GS 79). Zu den ethischen Fragen, die sich für Soldaten stellen, erklären die Deutschen Bischöfe: "Wenn und solange die Sicherheitspolitik ethisch zulässige, ja verpflichtende Ziele - Verhinderung des Krieges, Verteidigung der sittlich-politischen Wertordnung gegen totalitäre Bedrohung, Ermöglichung von Abrüstung - verfolgt und sich dabei ethisch annehmbarer Methoden und Mittel bedient, ist der Dienst des Soldaten unverzichtbar und ethisch gerechtfertigt" (GF 69).
Viele kommen zu der sittlichen Überzeugung, daß für sie persönlich ein Dienst mit der Waffe nicht in Betracht kommt. Die Gemeinsame Synode erklärt dazu, daß auch diejenigen der Sicherung und Förderung des Friedens dienen, die in verantworteter Entscheidung den Dienst mit der Waffe ablehnen und zum Einsatz in einem Zivildienst bereit sind. Nicht selten gehen gerade von Zivildienstleistenden und Kriegsdienstverweigerern schöpferische Anstöße zu friedensfördernden Verhaltensweisen aus (Beschluß: Entwicklung und Frieden 2.2.4.3). Wer bereit ist, diesen Weg zu gehen, darf weder als verantwortungslos bezeichnet werden, noch darf man ihm ein irriges Gewissen unterstellen.
Die Kirche fordert alle Gruppen dazu auf, einander nicht abzuwerten, jeder Verurteilung des anderen entgegenzutreten und im fortgesetzten Dialog gemeinsam nach immer besseren Lösungen für die anstehenden Probleme zu suchen.
Das alles kann aber nur im Zusammenhang eines umfassenden Friedensethos Geltung haben, das auf gewaltlose Konfliktaustragung drängt und die großen Aufgaben der Friedensförderung vor Augen stellt. Dies setzt ebenso Verständnis für Andersdenkende und Bereitschaft zu Dialog und Versöhnung wie beharrliches Eintreten für weltweite Gerechtigkeit voraus. Auf allen diesen Gebieten muß unser Dienst am Frieden, unser Einsatz für den Frieden und unsere Erziehung zum Frieden ansetzen. Wenn wir das Wort des Herrn: "Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen" (Mt 7,12), als "Goldene Regel" unseres Verhaltens ansehen, dann dürfen wir nicht immer zuerst von den anderen erwarten, daß sie auf uns zukommen, sondern dann sind wir aufgefordert, von uns aus auf sie zuzugehen, und zwar so, daß wir in der Weise anfangen, wie es uns in einem Gebet im Geist des heiligen Franziskus überliefert ist (vgl. GL 29,6):
- "Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens,
- daß ich liebe, wo man haßt;
- daß ich verzeihe, wo man beleidigt;
- daß ich verbinde, wo Streit ist;
- daß ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist;
- daß ich Glauben bringe, wo Zweifel droht;
- daß ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält;
- daß ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert;
- daß ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.
- Herr, laß mich trachten,
- nicht, daß ich getröstet werde, sondern daß ich tröste;
- nicht, daß ich verstanden werde, sondern daß ich verstehe;
- nicht, daß ich geliebt werde, sondern daß ich liebe.
- Denn wer sich hingibt, der empfängt;
- wer sich selbst vergißt, der findet;
- wer verzeiht, dem wird verziehen;
- und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben
7. Verantwortung für die Schöpfung
7.1. Die ökologische Krise
Durch viele Jahrhunderte wurde die Verantwortung, die sich für die Menschen aus dem fünften Gebot ergibt, nur im Verhältnis der Menschen zueinander gesehen. Es ging darum, menschliches Leben nicht willkürlich zu töten, sondern es zu schützen und zu bewahren. Heute wird mehr und mehr bewußt, daß sich der Auftrag des fünften Gebotes auch auf die ganze Schöpfung ausweitet.
Seit einiger Zeit sprechen wir von schwerwiegenden Krisen in unserem Verhalten zu unserem Lebensraum und zu unseren Lebensbedingungen: Umwelt-, Energie- und Rohstoffkrise, Bevölkerungs- und Wachstumskrise, Wirtschafts- und Gesellschaftskrise. Alle diese Krisen bilden zusammen eine umgreifende Krise ganz neuer Art, die mehr und mehr zu einer Überlebenskrise der Menschen und ihrer Lebenswelt zu werden droht. Erstmalig in der Geschichte sind davon nicht nur eine begrenzte Zahl von Menschen und ein bestimmtes Gebiet der Erde betroffen, sondern alle Menschen und die ganze Erde.
Bei nicht wenigen Menschen führt das Gefühl der Bedrohung zu einer Neubesinnung auf humane Werte und zu einer höheren Wertschätzung des Lebens und der Umwelt. Sie ziehen daraus auch Konsequenzen für ihren persönlichen Lebensstil in solchen Bereichen wie Ernährung und Wohnung, Energie- und Wasserverbrauch, Gesundheitsversorgung und Umweltschutz.
7.2. Mensch und Welt im Licht des Glaubens
Die ökologische Krise der Gegenwart stellt auch den Christen vor neue Fragen. Die Zerstörung unserer Lebenswelt ist nicht ein Problem, das uns nur am Rande betrifft. Es geht um uns selbst und um unsere Erde.
Den Christen muß es vor allem um die Frage gehen, ob und in welcher Weise sich vom Glauben her Zugänge zum Verständnis des Menschen und seiner Welt eröffnen.
Das Glaubensbekenntnis beginnt: "Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde." Alles auf Erden und die Erde selbst verdankt sich der schöpferischen Liebe Gottes. Die ganze Welt ist Geschenk und Gabe dieser Liebe, die ins Dasein ruft und im Dasein erhält.
Der Glaube an Gott als Schöpfer schließt ein ganz neues Verständnis der Welt ein. Die Natur ist Kreatur. Sie ist weder aus sich selbst da, noch hat sie mythische, magische oder göttliche Kraft. Auch der Mensch ist weder sein eigener Gott, noch kann er sich zum Gott über die Welt machen; auch er ist Kreatur, geschaffenes Dasein.
Nach den Aussagen der Bibel gehören zum Verhältnis des Menschen zur Schöpfung zwei Aspekte: seine Gottebenbildlichkeit und seine Mitgeschöpflichkeit. Sie machen seine Würde vor Gott und seine Verantwortung für die Schöpfung aus. Sie verwehren dem Menschen nicht, Eingriffe in die Schöpfung vorzunehmen. Um seine Grundbedürfnisse abdecken zu können, muß der Boden erschlossen, die Landschaft kultiviert und sowohl pflanzliche wie auch tierische Nahrung beschafft werden. So schließt auch der rechte Gebrauch der Dinge immer schon ein gewisses Maß an Zerstörung ein. Der Mensch kann nur überleben, indem er in Leben eingreift.
Aber die Geschichte der Bestimmung des Menschen, für sich und andere verantwortlich Sorge zu tragen, ist von Anfang an bis heute auch eine Geschichte des Versagens, des Irrtums und der Schuld, durch die auch die nichtmenschliche Schöpfung mitbetroffen ist. Doch durch die Katastrophe der Sünde und der Verderbnis hindurch offenbart sich Gott als der getreue Gott, der im Bund mit Noach (Gen 9,8-11), mit Abraham (Gen 17) und mit seinem Volk (Ex 19-27) den Menschen und der Schöpfung eine neue Hoffnung verheißt. Diese wird im Neuen Bund durch Jesus Christus noch überboten, so daß der heilige Paulus sagen kann: "Auch die Schöpfung soll von der Sklaverei und der Verlorenheit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, daß die gesamte Schöpfung bis auf den heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt" (Röm 8,21f).
So wird in Christus selbst die alttestamentliche Verheißung eingelöst, zusammengefaßt und überboten. Jesus Christus "ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm wurde alles erschaffen im Himmel und auf Erden . . .; alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Er ist vor der Schöpfung, in ihm hat alles Bestand" (Kol 1,15-17). In ihm kommt die Schöpfung zur Vollendung. Er ist das Ziel der ganzen Schöpfung. In ihm sind auch wir eine neue Schöpfung geworden. In ihm kommen wir mit der ganzen Schöpfung zur Vollendung (vgl. auch 1 Kor 10,26; 2 Kor 5,17f; Eph 1,10.20.23; 4,10).
7.3. Christlicher Glaube und Umweltethos
Kritiker des Christentums haben immer wieder behauptet, der christliche Glaube habe Wissenschaft und Fortschritt gehemmt. Heute wird der Kirche vorgeworfen, jüdisch-christliches Denken habe die Schöpfungserzählung des Alten Testamentes falsch ausgelegt, indem sie dem Menschen eine unbegrenzte Herrschaft über die Schöpfung zugesprochen und so einer hemmungslosen Ausbeutung der Natur, einem überzogenen Wachstumsdenken und einem ungezügelten Fortschrittsglauben Vorschub geleistet habe. Alle modernen Fehlentwicklungen seien die gnadenlosen Folgen des Christentums. - Diese Vorwürfe übersehen, daß erst in der neuzeitlichen Loslösung des Menschen von Gott und der Degradierung der Natur zum bloßen Material ein Prozeß in Gang gekommen ist, der zur willkürlichen Ausbeutung der Natur und zur Umweltzerstörung geführt hat. Daß daran auch Christen Anteil haben, ist nicht zu leugnen. Das alles stellt uns vor die Frage, welche Bedeutung dem christlichen Verständnis von Welt und Mensch für ein christlich geprägtes Umweltethos zukommt.
Die Tatsache, daß Gott die Welt erschaffen hat, vermittelt uns die Einsicht in den Eigenwert auch der nichtmenschlichen Schöpfung. Sie weist uns darauf hin, daß unser Umweltverhalten sich nicht allein vom Gedanken der Brauchbarkeit der nichtmenschlichen Schöpfung für den Menschen leiten lassen darf. Unsere Mitgeschöpflichkeit läßt uns erkennen, daß wir die wechselseitige Beziehung zwischen Mensch und nichtmenschlicher Schöpfung anzunehmen und zu respektieren haben. Die Sonderstellung des Menschen in der Schöpfung schließlich zeigt uns, daß wir für die Erhaltung und Gestaltung der Schöpfung verantwortlich sind. Nur der Mensch kann und soll bewußt und frei die Schöpfung zu einer würdigen Wohnung für alles Leben machen. Unter den heutigen Gegebenheiten, in denen weniger die Natur zur Bedrohung des Menschen als der Mensch zur Bedrohung der Natur geworden ist, ergibt sich die Forderung nach einer Vertiefung und Verstärkung unserer Verantwortung für die Gestaltung und Bewahrung der Schöpfung.
Gefordert ist eine Ehrfurcht vor der Natur und den ihr von Gott gegebenen Sinngestalten und Ordnungsstrukturen (vgl. GS 36); ein geschärftes Gespür für die Mitgeschöpfe und für alles Lebendige; eine größere Weitsicht bezüglich der Schäden, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können; eine kritischere Einstellung zu Konsum und Verschwendung; und schließlich eine Spiritualität der Begrenzung, die auf den Vorrang des Habens vor dem Sein verzichtet; denn "der Wert des Menschen liegt mehr in ihm selbst als in seinem Besitz" (GS 36).
Gott hat die Welt durch seinen Sohn neugeschaffen. Dies zeigt uns, wie kostbar in den Augen Gottes die ganze Schöpfung ist. Sie ist Schöpfung in Christus, und sie ist von der Art, daß sich in ihr Jesus Christus zeigen kann: im Wasser der Taufe, im Brot und Wein der Eucharistie, im Öl der Salbung.
- "Als von Christus erlöst und im Heiligen Geist zu einer neuen Schöpfung gemacht, kann und muß der Mensch die von Gott geschaffenen Dinge lieben. Von Gott empfängt er sie, er betrachtet und schätzt sie als Gaben aus Gottes Hand. Er dankt seinem Wohltäter für die Gaben; in Armut und Freiheit des Geistes gebraucht und genießt er das Geschaffene; so kommt er in den wahren Besitz der Welt als einer, der nichts hat und doch alles besitzt. ,Alles gehört euch; ihr aber gehört Christus und Christus Gott` (1 Kor 3,22-23)" (GS 38; vgl. 1 Kor 10,23.31; Röm 14; Kol 2,16-23; 1 Tim 4,1-5).
So erweist sich christliche Verantwortung als Liebe, die alles Geschaffene in das Ja zu Jesus Christus selbst einbringt:
- "Würdig bist du, daß wir dich feiern
- zu allen Zeiten mit heiligen Liedern,
- Christus, Sohn Gottes, Bringer des Lebens:
- dich lobpreise die ganze Erde"
- (Vesperhymnus aus dem Stundengebet
- am Donnerstag der 4. Woche im Jahreskreis).
Gott will die Welt vollenden im neuen Himmel und in der neuen Erde. Das erlaubt uns die Haltung des gelassenen Vertrauens und Wartens.
- "Den Zeitpunkt der Vollendung der Erde und der Menschheit kennen wir nicht, und auch die Weise wissen wir nicht, wie das Universum umgestaltet werden soll" (GS 39). Doch "darf die Erwartung der neuen Erde die Sorge für die Gestaltung dieser Erde nicht abschwächen . . ., sondern muß sie im Gegenteil ermutigen". Denn wir wissen: "Die Liebe wird bleiben wie das, was sie einst getan hat" (ebd.). Daraus ergibt sich für unser Handeln in der Welt die Forderung: "Alle guten Erträgnisse der Natur und unserer Bemühungen nämlich, die Güter menschlicher Würde, brüderlicher Gesinnung und Freiheit, müssen im Geist des Herrn und gemäß seinem Gebot auf Erden gemehrt werden . . ." (ebd.).
Gelassenes Vertrauen und Warten einerseits und wachsame Sorge für die Erde andererseits sind jene Einstellungen und Haltungen, die sich aus der Verkündigung Jesu ergeben.
7.4. Christlich geprägte Umweltethik
Im Gottesglauben werden wir auf die doppelte Verpflichtung zum Beherrschen und Behüten der Schöpfung verwiesen (vgl. Gen 1,26; 2,15). In der heutigen Bedrohung der Schöpfung durch den Menschen motiviert uns der Schöpfungsauftrag in besonderer Weise zu solchen Einstellungen und Grundhaltungen, die es ermöglichen, Leben zu erhalten und zu fördern, Leid zu vermeiden oder zu vermindern und Zerstörung zu begrenzen oder zu verhindern.
Freilich lassen sich aus diesem Auftrag nicht unmittelbar konkrete Handlungsnormen oder gar Programme für den jeweils richtigen Einsatz von Technik, Wirtschaft und Umweltpolitik ableiten. Seine Bedeutung liegt vielmehr darin, daß das Verständnis der Welt als Schöpfung Gottes und des Menschen als Höhepunkt der Schöpfung in die Begründung einer Umweltethik eingeht. In ihr werden humane Einsichten bestätigt, einseitige Wege kritisch hinterfragt und korrigiert. Technik, Wirtschaft und Ökologie sind innere Momente der umgreifenden Individual- und Sozialethik. Sie sind Ausdruck und Auftrag des Menschen. Sie sollen so gestaltet werden, daß sie nicht unsere eigenen Lebensgrundlagen zerstören.
Hiermit verweist uns die christliche Ethik auf unsere Einsicht, auf unsere Vernunft und auf unsere Sensibilität. Wir sind aufgefordert, auf der Grundlage einer Rangordnung von Werten und Gütern Abwägungsurteile darüber zu fällen, welchen Werten und Gütern unter den heutigen Voraussetzungen jeweils der Vorrang zu geben ist, damit personale Identität, mitmenschliche Solidarität und mitgeschöpfliche Teilhabe sinnvoll verwirklicht werden können.
In vielen Bereichen sind solche Abwägungsurteile leicht zu finden. Wir können in unserem persönlichen Lebensstil vieles tun, um Umweltbelastungen zu verringern und Schäden zu vermeiden. Angesichts der Müllberge, der Verknappung der Rohstoffe, der Verschmutzung des Wassers und der Luft und der Verseuchung der Landschaft, des übersteigerten Konsums und des Überangebotes von Gütern kann jeder einzelne etwas tun. "Das wenige, das du tun kannst, ist viel" (Albert Schweitzer).
Die Diskussion um Tierexperimente hat das Bewußtsein dafür gestärkt, daß die bedrohte Tierwelt mehr geschützt werden muß. Tierversuche dürfen nur in dem Maße vorgenommen werden, wie das angestrebte sittlich vertretbare Ziel mit anderen Methoden nicht zu erreichen ist. Vom ethischen Standpunkt her lassen sich Tierversuche zur Erprobung von Kosmetika nicht rechtfertigen. Auch Tierversuche nur zum Zweck der Lehre sollten möglichst ersetzt werden. Manchem mag es als romantische Übersteigerung erscheinen, daß ein Heiliger wie Franziskus von Assisi die Tiere seine Brüder und Schwestern nennt, aber darin kommt zum Ausdruck, daß die Tierwelt in der Schöpfung einen besonderen Rang einnimmt und daß in der christlich geprägten Kultur das Wissen um die Solidarität alles Geschaffenen tief verankert ist. Darum dürfen Tiere nicht gequält und nicht mißbraucht werden. Sie sollen in ihrer Eigenbedeutung für heute und morgen erhalten bleiben.
Auf viele Fragen finden wir keine eindeutige Antwort. Wie steht es um die Kernenergie und andere Energiearten? Großtechnische Energiegewinnung bringt Gefahren und unerwünschte Folgen mit sich. Gegner der Kernenergie sehen in deren Gewinnung, Nutzung und Entsorgung eine so große Gefahrenquelle, daß sie ein Verbot der Kernenergie fordern. Andere scheuen davor zurück, ein bedingungsloses Nein oder Ja zur Kernenergie zu sagen. Sie halten eine Antwort, die ein für allemal gültig sein soll, beim heutigen Wissensstand nicht für möglich. Die Erklärung der Deutschen Bischöfe zu Fragen der Umwelt und der Energieversorgung geht von dem übergeordneten Prinzip aus: "Die Erlaubtheit der Gewinnung und Nutzung von Kernenergie steht unter denselben Bedingungen wie die anderen Energiearten" (Zukunft der Schöpfung - Zukunft der Menschheit, 18). Da alle Technologien Gefahren und unerwünschte Folgen haben, muß versucht werden, diese einzugrenzen und beherrschbar zu machen.
"Andererseits darf aber keine Art von Energiegewinnung vorangetrieben werden, bei welcher eine ernstliche Gefahr für das Leben der Menschheit durch mögliche Unfälle oder künftige Nebenwirkungen drohte" (ebd., 19). Hier erfolgt weder ein eindeutiges Ja noch ein entschiedenes Nein zur Kernenergie; es wird in Erwägung gezogen, daß "sittlich verantwortbare Wege zur Bereitstellung und Nutzung von Atomenergie gefunden werden"; doch auch dann noch "bleibt es bedenklich, sich in der Großplanung auf nur eine Energieart festzulegen" (ebd.). Somit ist für die Zukunft eher eine andere Energieart zu bevorzugen als die Kernenergie. In der Frage, welche alternative Energiearten das sein können und innerhalb welchen Zeitraumes diese bereitzustellen sind, kann die christliche Ethik keine Kompetenz beanspruchen; sie kann nur Rahmenbedingungen aufzeigen, innerhalb derer Experten beurteilen müssen, ob sie erfüllt sind. Die Tatsache, daß es Kernkraftwerke gibt, besagt nicht, daß sie vertretbar sind. Eine eindeutige ethische Rechtfertigung, in der auch die Frage der Entsorgung und der Folgen für die kommenden Generationen mitentscheidend ist, dürfte heute kaum gegeben werden können.
Am Beispiel der Kernenergie wird deutlich, daß ethische Urteile über konkrete Probleme der Ökologie schwerer zu finden sind, als es den Anschein hat. Schon in der Analyse der Situation, in der Bewertung der Risiken heutiger Technik und in der Entscheidung über Methoden zur Herbeiführung eines Ausgleichs von Ökonomie und Ökologie kommen Wissenschaftler oft zu ganz unterschiedlichen Urteilen. Brauchen wir eine neue Weltwirtschaftsordnung? Ist für die Zukunft mehr oder weniger an Technik erforderlich? Wie sind die negativen Folgen von Wirtschaft und Technologie zu verringern? Häufig spielen bei Entscheidungen über das Verhältnis von Ökonomie und Ökologie auch wirtschaftliche Notlagen, politische Theorien, Ideologien und Interessen von Verbänden und Gruppen eine große Rolle. Dazu kommt, daß auch die Frage nach dem Sinn von Menschsein unterschiedlich beantwortet wird. In alledem zeigt sich, daß wir auf dem Weg zu einer Ethik, die weltumspannend ist, noch ziemlich am Anfang stehen.
Als Christen sind wir aufgerufen, unser christliches Verständnis der Wirklichkeit in die Diskussion einzubringen und nicht nachzulassen, mit allen Menschen guten Willens nach Lösungen zu suchen, die sinnvolles Menschsein in einer menschenwürdig gestalteten Schöpfung ermöglichen. Dabei können und dürfen Christen trotz gleicher Gewissenhaftigkeit zu unterschiedlichen Urteilen über konkrete Lösungen kommen.
VI. Sechstes und neuntes Gebot: Du sollst nicht ehebrechen, Du sollst nicht begehren, deines Nächsten Frau
Ich bin dein Gott, der dir Leben und Zukunft schenkt
Du sollst nicht ehebrechen, Du sollst nicht begehren, deines Nächsten Frau
Gott will, daß wir in Liebe und Ehe die Treue wahren.
1. Kontinuität und Wandel im Verständnis von Geschlechtlichkeit und Ehe
1.1. Der Wortlaut des sechsten und neunten Gebotes
Der Dekalog enthält als Orientierung zum Bereich von Geschlechtlichkeit und Ehe zwei Gebote, das sechste und das neunte (vgl. dazu KKK, in dem das neunte Gebot in einem eigenen Artikel behandelt wird). Der Text der beiden Gebote ist in den Büchern Exodus und Deuteronomium gleichlautend:
- "Du sollst nicht die Ehe brechen" (Ex 20,14; Dtn 5,18).
- "Du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen" (Ex 20,17; Dtn 5,21).
Beim neunten Gebot fällt auf, daß es im Rahmen des Dekalogs im Buch Exodus an anderer Stelle steht als im Buch Deuteronomium. Im Buch Exodus ist das Verbot, nach der Frau des Nächsten zu verlangen, in das Verbot, nach dem Besitz des Nächsten zu verlangen, eingebunden. Der Text lautet:
- "Du sollst nicht nach dem Haus deines Nächsten verlangen. Du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen, nach seinem Sklaven oder seiner Sklavin, seinem Rind oder seinem Esel oder nach irgend etwas, das deinem Nächsten gehört" (Ex 20,17).
Im Buch Deuteronomium dagegen steht das Verbot, nach der Frau des Nächsten zu verlangen, vor dem Verbot, nach dem Besitz des Nächsten zu verlangen, und ist ein eigenes Verbot des Dekalogs. Der Grund für die unterschiedliche Stellung des Verbots, die Frau des Nächsten zu begehren, ist wohl darin zu sehen, daß in der Frühzeit Israels die Frau noch zu den Besitztümern des Mannes zählte und deshalb im Buch Exodus in das Verbot, nach dem Besitz des Nächsten zu verlangen, einbezogen wurde. Im Buch Deuteronomium dagegen kommt in der Eigenstellung des Verbotes, nach der Frau des Nächsten zu verlangen, wohl der Wandel im Verständnis der Frau und ihrer Bedeutung zum Ausdruck. Vom Inhalt her ist hier das Verbot, nach der Frau des Nächsten zu verlangen, insofern mit dem Verbot, den Besitz des Nächsten zu begehren, verwandt, als es sich bei beiden Geboten um sogenannte "Begehrungsverbote" handelt, die sich auf die innere Einstellung und auf alle Versuche beziehen, die Frau oder das Hab und Gut des Nächsten in seinen Besitz zu bringen. Nicht erst die Tat des Ehebruchs und Diebstahls, sondern schon das Begehren wird verworfen.
1.2. Sinn und Bedeutung der beiden Gebote in Geschichte und Gegenwart
Die Gebote "Du sollst nicht ehebrechen" und "Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau" weisen auf die Grenzen und den Rahmen hin, außerhalb derer die sittliche Ordnung des Geschlechtlichen und der Beziehung von Mann und Frau nicht gewahrt ist. Nach dem Wortlaut der Gebote geht es vor allem um Einstellungen und Verhaltensweisen, die sich auf die Ehe im Rahmen der sozialen Ordnung beziehen. Die soziale Ordnung sollte den Bestand von Familien (bzw. Sippen) und das Lebensrecht von Frauen und Kindern absichern. Darüber hinaus haben die beiden Gebote aber auch grundlegende Bedeutung für die sittliche Orientierung der beiden Geschlechter überhaupt, unabhängig von der Ehe.
Ethische Weisungen, die das Verhalten von Mann und Frau zueinander betreffen, gibt es bei allen Völkern und Kulturen. Für Israel als Gottesvolk haben diese Orientierungen eine theologische Dimension. Die Weisungen des Dekalogs, die von der geschlechtlichen Bezogenheit zwischen Mann und Frau handeln, werden in Israel als Lebensordnung verstanden, die Gott in Schöpfung und Bund eingestiftet hat. Das Gottesvolk weiß sich in dem Maß im Bund mit Gott, in dem es sich an diese Weisung hält. In der Auslegung dieser Lebensordnung gibt es in Israel einen Wandel, der von der anfänglich bestehenden Polygamie allmählich zur Monogamie und zur größeren Hochschätzung der Ehe führt.
Im Neuen Bund wird die Lebensordnung Gottes für Mann und Frau bestätigt und überboten. Mann und Frau sind von Gott geschaffen; sie haben vor Gott gleiche Würde und übernehmen je auf ihre Weise im gemeinsamen Bemühen Verantwortung für ihre Ehe und ihr eheliches Leben, in welchem sie zu bleibender Treue verbunden sind und darin Gottes Gnade und Beistand erfahren. Darin spiegelt sich die Einsicht von Glaube und Vernunft wider, daß bleibende und unwiderrufliche Treue zutiefst der menschenwürdigen Beziehung der Geschlechter entsprechen.
Die gegenseitige Liebes- und Treuebindung schließt Geschlechtsbeziehungen und sexuelle Verhaltensweisen, die nicht den umfassenden Zielen der menschlichen Geschlechtlichkeit entsprechen, aus.
In der heutigen Gesellschaft ist diese christliche Lehre vielfacher Kritik ausgesetzt. Zwar ist die Ehe für die Mehrzahl der Bevölkerung auch unter den heutigen Lebensverhältnissen noch ein hohes und erstrebenswertes Gut, aber sie wird von vielen nicht mehr als einzig gültige Form des Zusammenlebens von Mann und Frau angesehen. Ein Anzeichen für diese gewandelte Einstellung ist die wachsende Zahl von nichtehelichen Lebensgemeinschaften. Sie werden in zunehmendem Maß von der Gesellschaft akzeptiert. Die von der Kirche verkündeten Orientierungen zu Geschlechtlichkeit und Ehe geraten unter Ideologieverdacht oder werden als sexualfeindlich und repressiv abgelehnt.
Die Ursachen und Hintergründe dieser gewandelten Einstellung zu Ehe und Sexualität sind vielschichtig. Eine große Rolle spielen unterschiedliche Weltanschauungen, die Verabsolutierung des wissenschaftlichen Selbstverständnisses des Menschen, veränderte Vorstellungen über Werte und Normen sowie neuere Gesellschaftstheorien, nach denen die überkommenen Leitbilder und Moralvorstellungen nicht mehr mit den modernen Lebensbedingungen vereinbar sind.
Eine erste Theorie geht von der These aus: Die herrschende Moral ist immer die Moral der Herrschenden. In der bürgerlichen Gesellschaft dient die monogame Ehe zur Aufrechterhaltung der bestehenden Herrschaftsverhältnisse. Die repressive bürgerliche Gesellschaft macht die Ehe zum bloßen Fortpflanzungsinstitut und entfremdet den Menschen von sich selbst und von den Mitmenschen, denn sie erlaubt die Erfüllung sexueller Wünsche nur in der monogamen Ehe. Eine Befreiung des Menschen zu nicht-repressiven Formen sexuellen Verhaltens ist nur durch eine Umwandlung der Gesellschaft möglich. In der neuen Gesellschaft wird sich von selbst eine natürliche Sexualmoral entwickeln. In ihr werden gesellschaftliche Normen zur Regelung des Verhältnisses von Mann und Frau überflüssig. Erst jetzt kann der Mensch seine Triebwünsche selbst gestalten. Er braucht sich nicht mehr an überholte Werte und Normen zu halten.
Eine zweite Theorie versteht sich als "humanistische Sexualethik". Ihre neue Moral baut auf dem Grundsatz auf: "Man muß auf dem sexuellen Gebiet nicht mehr Schranken gelten lassen als auf dem Gebiet der Ernährung" (Bertrand Russell). Die bürgerliche Moral ist eine verlogene "doppelte Moral". Sie beschränkt die Sexualität offiziell auf die Ehe, gestattet aber faktisch dem Mann mehr als der Frau. Zwar wird nach dieser Theorie die Ehe auch weiterhin für die Erziehung der Kinder notwendig sein, aber die Eheleute dürfen in gegenseitigem Einvernehmen auch außereheliche Beziehungen aufnehmen. Sie müssen dabei nur das Prinzip beachten: Du sollst die Gefühle eines Mitmenschen nicht rücksichtslos ausnutzen und ihn nicht mutwillig enttäuschenden Erfahrungen aussetzen, und du sollst unter keinen Umständen fahrlässig die Zeugung eines unerwünschten Kindes riskieren!
Eine dritte Theorie schließlich verkündet als sittliches Prinzip: Das faktisch Gelebte ist das moralisch Gute und Richtige. Wenn eine große Zahl von Menschen vorehelichen Geschlechtsverkehr, "Ehe auf Probe" und "Ehe ohne Trauschein" für richtig hält, dann muß diese Auffassung auch in der Gesellschaft als geltende Moral anerkannt und akzeptiert werden, denn diese Einstellung ist Anzeichen für die Ablehnung einer veralteten Moral. In der neuen Moral zählt allein die Liebe. Triebverzicht ist schädlich, führt zu sexueller Verklemmung und kann Ursache schwerer Sexualneurosen sein. Normen der Kirche und der Gesellschaft, die diese Tatsachen nicht beachten, sind abzulehnen.
Unterschiedliche Anschauungen und Theorien über Sexualität und Ehe sind heute weit verbreitet. Sexualität ist ein wichtiges Thema in Gesprächen und Diskussionen, in Informationsheften und Aufklärungsschriften, in Zeitungen und Büchern, in Bildern und Filmen. Die dort propagierten Theorien und Werthaltungen fordern zu kritischer Auseinandersetzung heraus. Diese ist um so dringlicher, als auch unter Christen Unsicherheit, Verwirrung und ablehnende Haltung gegenüber Orientierungen der kirchlichen Sexual- und Ehemoral vorhanden sind. Dazu tragen nicht nur die in der Gesellschaft verbreiteten Sexualtheorien und sexuellen Verhaltensweisen bei, sondern auch Akzentverschiebungen von der traditionellen zur heutigen Sicht von Sexualität und Ehe in der kirchlichen Verkündigung und in der theologischen Reflexion (zum Beispiel bezüglich des Verhältnisses von Mann und Frau).
Manche Ablehnung der kirchlichen Morallehre ist auch auf die frühere Überbetonung des sechsten Gebotes, auf zu große Enge in der Sexualerziehung und auf eine zu rigorose Beichtpraxis zurückzuführen. Oft war wenig vom Geist der Liebe und Barmherzigkeit zu spüren. Die Kirche steht in der heutigen Situation, in der sich veränderte Einstellungen zu Liebe, Sexualität und Ehe entwickeln, vor schwerwiegenden Fragen und Problemen. Ihre Aufgabe ist es, im Geist des Evangeliums die Botschaft von der Beziehung der Geschlechter so zu verkünden, daß sie sich als menschenfreundliche Sexual- und Ehemoral erweist; sie hat jene Werte zu erschließen, die in den Sinnbezügen menschlicher Geschlechtlichkeit angelegt sind und zum Ausdruck kommen.
2. Sinnbezüge der menschlichen Geschlechtlichkeit
2.1. Personale Ordnung der Geschlechtlichkeit
Geschlechtlichkeit ist keine bloß nebensächliche Eigenschaft des menschlichen Leibes. Wir sind in unserer ganzen leib-seelischen Einheit geschlechtlich geprägt. Die geschlechtliche Ausformung beginnt bereits mit dem frühesten Stadium der vorgeburtlichen Entwicklung. Im Lauf des Lebens erfolgt ihre biologische Ausgestaltung im Zusammenspiel von Erbstrukturen, hormonaler Steuerung und Gehirnprozessen. Zur Selbstfindung des Menschen gehört immer auch die Auseinandersetzung mit der Prägung seines individuellen Wesens durch das Geschlecht. Sie unterliegt nicht nur biologischen, sondern auch sozial-kulturellen Faktoren. Sowohl gegenüber den biologischen als auch den sozial-kulturellen Möglichkeiten ist eine persönliche Entscheidung des Menschen möglich. So wird die Geschlechtlichkeit zu einer Wirklichkeit, die den Menschen als ganzen erfaßt.
Was bedeutet es für uns, geschlechtlich bestimmt zu sein und entweder als Mann oder als Frau zu leben? - Die Geschlechter sind einander zugeordnet. In ganz besonderer Weise erlebt sich der Mensch als einmalig und unvertretbar im liebenden Miteinander und im Einswerden der Liebe, denn in der Liebe begegnen Mann und Frau einander als Personen: Ich liebe dich, weil du du bist, einmalig und unverwechselbar. In der Liebe überschreitet sich eine Person auf die andere hin. Das Zustandekommen und Reifen dieser Beziehung drückt sich leibhaft aus. Da die sexuellen Kräfte und Verhaltensweisen des Menschen nicht durch Instinkte festgelegt sind, müssen Mann und Frau ihnen eine sinnvolle Gestalt geben. Das ist um so mehr erforderlich, als das Sexuelle sich so verselbständigen kann, daß es in den Dienst egoistischer Selbstbezogenheit tritt. Es vermag einen Menschen so zu faszinieren, daß er durch das Sexuelle gefesselt und völlig in Beschlag genommen wird. Dadurch entsteht die Gefahr, sich selbst zu genügen und das Personale und Mitmenschliche zu mißachten.
In der Geschichte hat es zu allen Zeiten die Verteufelung wie auch die Vergötzung der Sexualität und der sexuellen Lust gegeben. An der Sexualfeindlichkeit und der Abwertung der Lust hat auch die christliche Moral früherer Zeit großen Anteil. Durch viele Jahrhunderte war man der Meinung, das Sexuelle sei eher etwas Animalisches und passe nicht zur menschlichen Würde; in der sexuellen Lust werde der Mensch seinen Trieben unterworfen; sie raube ihm den Verstand und die Freiheit. Selbst die sexuelle Begegnung von Mann und Frau in der Ehe sollte nur um der Fortpflanzung willen erlaubt sein, wobei die Lust als Übel in Kauf genommen werden konnte. Diese Wertung ist heute berechtigter Kritik ausgesetzt. Wenn sie auch in der heutigen Morallehre überwunden ist, so wirft man doch der kirchlichen Sexuallehre auch heute noch Sexualfeindlichkeit vor. Manche neuere Sexualtheorien sind aus der Kritik an der Moralvorstellung der sogenannten "bürgerlichen Moral" erwachsen. In ihnen schlägt zum Teil das Pendel nach der anderen Seite aus; sie propagieren sexuelle Freizügigkeit und entarten in Leibvergötzung.
Es gibt in der Sexualität Glück und Erfüllung, aber es gibt auch die Macht der Begierde, den zerstörerischen Egoismus, das Schuldigwerden, das Bedrängtwerden der Frau durch den Mann und des Mannes durch die Frau, die erniedrigende Ausbeutung und die sexuelle Mißhandlung. Seit der Ursünde (Gen 3) gibt es die Zwiespältigkeit zwischen den Geschlechtern. Die Bibel verschweigt sie nicht, die Begierde nach der Frau des anderen bei König David (2 Sam 11,21-27), den Versuch der Verführung Josefs durch die Frau des Potifar (Gen 39,7-18), das Vergehen des Amnon an seiner Halbschwester Tamar (2 Sam 13,1-22) und die vielfachen Weisen des Lasters und der Unzucht, von denen der heilige Paulus im Römerbrief und in den Lasterkatalogen spricht. Sie begegnen uns heute wie damals. In alledem zeigt sich, wie wichtig es ist, die eigene Sexualität human zu gestalten. Maßstab ist die Liebe im Sinn der Weisung des Hauptgebotes, das die Gottes-, Nächsten- und Selbstliebe zu einer Ganzheit zusammenfügt.
Zur humanen Gestaltung der Geschlechtlichkeit gehört die Achtung der sexuellen Intimsphäre bei sich selbst wie bei anderen. Scham und Schamgefühl ist etwas, das nur der Mensch kennt. In der Tierwelt fehlt das sexuelle Schamgefühl. Scham und Schamgefühl sind durch kulturelle Normen mitgeprägt; sie dienen der Selbstachtung und der Achtung des anderen. Es ist keineswegs Prüderie, daß der Mensch nicht schutzlos den Blicken anderer ausgesetzt werden möchte. Jeder hat Anspruch darauf, daß seine geistige und leibliche Intimsphäre gewahrt und geschützt bleibt. Doch wie er selbst nicht den Blicken anderer preisgegeben sein möchte, so darf er auch nicht durch Schamlosigkeit andere provozieren und brüskieren. Solche Darbietungen des eigenen Körpers wie auch Darstellungen intimer sexueller Handlungen in Massenmedien verletzen die menschliche Würde; auch Nacktheit in manchen Formen der Freizeitgestaltung kann - bewußt oder unbewußt - sexuell provozierend sein.
Zur rechten Gestaltung der Geschlechtlichkeit gehört das Wissen um Gut und Böse (vgl. Hebr 5,4) und die Wachheit des Geistes (vgl. Lk 12,35-38). Der Mensch muß sich davor hüten, seine Sexualität zu verdrängen oder sich von ihr treiben zu lassen; vielmehr soll er sie in seinem Leben so entfalten, wie es den jeweiligen Entwicklungsstufen, näherhin deren sittlichen Aufgaben, entspricht: im Kindesalter anders als in der Pubertät; in der Jugend anders als im Erwachsenen- und Seniorenalter; in Jugendfreundschaften anders als in der Ehe und im ehelosen Leben; Jungen anders als Mädchen, Frauen anders als Männer. Voraussetzung für die personale Gestaltung der Sexualität ist das Vertrauen des Menschen zu sich selbst und zu seiner Leiblichkeit. Wer sich selbst annimmt und bejaht, vermag am ehesten seine Geschlechtlichkeit als Gabe und Aufgabe zu sehen.
Die stufen- oder phasengerechte Entfaltung der Sexualität ist ein Prozeß, in dem viele Elemente eine Rolle spielen. Individuelle Veranlagung, Erziehung und Prägung durch die Eltern und Geschwister, Einflüsse der Gesellschaft, religiöse und sittliche Erziehung fließen in diesen Prozeß ein. Die beste Voraussetzung für eine gelingende Sexualerziehung ist die Gesamterziehung in einer Lebenswelt, die Geborgenheit und Vertrauen vermittelt. Eltern und Erzieher als natürliche Bezugspersonen der Kinder und Jugendlichen können in einem Klima der vertrauenden Zuwendung und durch ihr persönliches Lebensbeispiel dazu beitragen, daß Kinder und Jugendliche ein natürliches Verhältnis zu sich selbst und zum anderen Geschlecht entwickeln. Bloße Information über biologische Fakten reicht nicht aus; sie muß in die Gesamterziehung eingebunden sein, in der den Kindern und Jugendlichen auch sittliche und religiöse Orientierung gegeben wird. Diese darf nicht aufdringlich vermittelt werden, noch darf sie wie ein äußeres Gesetz vorgeschrieben werden. Sie soll vielmehr so geschehen, daß durch alle Spannungen und Probleme hindurch als eigentlicher Maßstab des Sexuellen die in Richtung auf die Gottesliebe offene Liebe zu sich selbst und zu den anderen eingesehen und verwirklicht wird.
Vieles, was wir über Würde und Wert, Gabe und Aufgabe, Beglückung und Gebrochenheit unserer menschlichen Geschlechtlichkeit wissen, entstammt unserer Erfahrung und Vernunfteinsicht. Im Glauben an Gott begreifen wir die menschliche Geschlechtlichkeit als Geschenk und Gabe der Liebe Gottes.
Nach dem Alten Testament ist der nach Gottes Bild geschaffene Mensch ein leibseelisches Ganzes. Leibliches und Seelisches bestehen nicht nebeneinander, sondern durchdringen sich gegenseitig. Leibfeindlichkeit und Sexualunterdrückung sind dem Alten Testament ebenso fremd wie Leibvergötzung und kultische Verehrung der Sexualität. Mann und Frau sind dadurch ausgezeichnet, daß sie Ebenbild Gottes sind. Gott schuf den Menschen als sein Ebenbild, er schuf sie "als Mann und Frau" (Gen 1,27), geschlechtlich verschieden und einander zugeordnet. Sie leben als ebenbürtige Partner zusammen (Gen 2) und dürfen das Leben weitergeben (Gen 1). Adam nimmt seine Frau als Gefährtin, die Gott ihm zugeführt hat, an. Er erkennt darin die fürsorgende Güte Gottes, die ihm nicht nur untermenschliche Wesen der Schöpfung zuführt, sondern vor allem die ebenbürtige Frau, die ihm gleichwertig ist. "Und der Mensch sprach: Das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch . . . Darum verläßt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau" (Gen 2,23f).
Im Neuen Testament bestätigt Jesus den Glauben seines Volkes über die gottgeschaffene Zweigeschlechtlichkeit des Menschen. Bei der Frage nach der Erlaubtheit der Ehescheidung zitiert er das Wort: "Gott hat sie als Mann und Frau geschaffen" (Mk 10,6). Die damit der Frau zugesprochene gleiche Würde war in der Praxis des Judentums zur Zeit Jesu durch gesellschaftliche Einschränkungen und eine Scheidungserlaubnis, die den Mann begünstigte, gefährdet. Jesus hebt durch sein Eintreten für die Frauen, durch ihre Gleichbehandlung und durch seine Zuwendung zu ihnen die Würde und Gleichwertigkeit der Frau hervor. Er erkennt den Wert des Geschlechtlichen für Mann und Frau an, sieht aber auch, daß schon am Anfang der Menschheitsgeschichte die Beziehung zwischen Mann und Frau belastet ist. Er weist auf die böse Begierde hin, die im Herzen des Menschen aufsteigt (Mt 5,28); er verlangt, radikal gegen sie anzugehen, wie das Wort vom Ausreißen der Körperglieder, das Matthäus auf die sexuelle Begierde bezieht (5,29f), veranschaulicht. Allerdings hat die Kirche immer verurteilt, diese Aussage wörtlich auszulegen und dem möglichen Mißbrauch der Geschlechtskraft durch Verstümmelung abzuhelfen. Bei aller ernsten Mahnung, den Verführungen zu Ausschweifung und Unzucht zu widerstehen, hat sie stets an der Gutheit alles Geschaffenen und somit auch an der Gutheit des Geschlechtlichen festgehalten.
2.2. Liebe, bleibende Treue und unauflösliche Ehe
Niemand kann ohne Liebe leben. Der Mensch bleibt für sich selbst ein unbegreifliches Wesen; sein Leben ist ohne Sinn, wenn ihm nicht die Liebe geoffenbart wird, wenn er nicht der Liebe begegnet, wenn er sie nicht erfährt und sich zu eigen macht, wenn er nicht lebendigen Anteil an ihr erhält (vgl. RH 10).
- "Indem er den Menschen nach seinem Bild erschafft und ständig im Dasein erhält, prägt Gott der Menschennatur des Mannes und der Frau die Berufung und daher auch die Fähigkeit und die Verantwortung der Liebe und Gemeinschaft ein" (FC 11).
Die Liebe zwischen Mann und Frau kann sich auf unterschiedliche Weise äußern: im Angezogensein und Fasziniertsein von der Gestalt und Schönheit des anderen, den man begehrt; in der Bewunderung und Freude an der Liebenswürdigkeit des anderen, den man verehrt; und schließlich im Ja zum anderen, den man um seiner selbst willen liebt.
Die Bibel spricht von diesen Weisen der Begegnung zwischen Mann und Frau an vielen Stellen. In der Genesis erzählt sie vom Jubelruf des Mannes, als er der Frau ansichtig wird, die Gott "als sein Gegenüber" geschaffen hat (Gen 2,23). - Die Erzählung von Jakob und Rahel (Gen 29,20), von Elkana und Hanna (1 Sam 1,5) und besonders das "Hohelied" zeigen, daß in der Geschichte des Gottesvolkes die Liebe aufs höchste gefeiert und unbefangen vom beglückenden Ereignis der Liebesvereinigung von Mann und Frau gesprochen wird (vgl. Spr 5,18-20; Koh 9,9). - Die jahwistische Erzählung (Gen 2) wie auch die prophetische Deutung des Bundes zwischen Gott und dem Volk als eines Liebes- und Ehebundes (vgl. Hos 2; Jes 54) stellen die Liebe in den Mittelpunkt. Der Gottesspruch: "Ich traue dich mir an auf ewig; ich traue dich mir an um den Brautpreis von Gerechtigkeit und Recht, von Liebe und Erbarmen, ich traue dich mir an um den Brautpreis meiner Treue: Dann wirst du den Herrn erkennen" (Hos 2,21f), läßt deutlich werden, daß für Israel Jahwes Liebe und Vertrauen das Fundament der Zusage des Volkes zu Jahwe ist. Ähnlich sind in der ehelichen Gemeinschaft, zu der Gott die Menschen "als Mann und Frau geschaffen" hat (Gen 1,28) und in der sie "ein Fleisch" werden (Gen 2,24), die Ehegatten "ein Herz und eine Seele" (Die Deutschen Bischöfe, Zu Fragen der menschlichen Geschlechtlichkeit, 6).
Die eheliche Liebe vollendet sich in der lebenslangen Treue. In ihr geschieht eine unbedingte Zuwendung des einen Partners zum anderen und ein Engagement füreinander, das sich nicht von wechselnden Umständen abhängig macht. Einer hält am anderen fest, komme, was da wolle. Eine solche Haltung bedeutet eine hohe Form des Einstehens von Menschen füreinander und ein großes Zeichen der Solidarität, zu welcher der Mensch für den Menschen fähig ist. Gerade im Leben aus dieser Treue wird die Ehe durchsichtig auf die Liebe Gottes, der sich in Christus den Menschen und der Welt in einem unbedingten Ja zugesagt hat.
Die Einsicht, daß Liebe unteilbar ist und die Liebenden zu einem unwiderruflichen Treuebund zusammenschließt, in dem "sich die Eheleute gegenseitig schenken und annehmen" (GS 48), hat sich im Lauf der Menschheitsgeschichte erst allmählich durchgesetzt.
In Israel gab es am Anfang durchaus noch Polygamie. Nach der Landnahme verfestigte sich aus mannigfachen Gründen deutlich die monogame Lebensweise. Doch blieb dem Mann, der als Besitzer der Frau galt (vgl. Ex 21,3; Dtn 24,2; 2 Sam 11,26), rechtlich immer die Möglichkeit, die Frau für den Fall, daß er "etwas Anstößiges" an ihr entdeckte, zu entlassen (vgl. Dtn 24,1). Damit war der Willkür des Mannes ein Spielraum gegeben, der häufig egoistisch ausgenutzt wurde. Nur in zwei Fällen war die Entlassung der Frau ausgeschlossen: wenn der Mann seiner Frau zu Unrecht Verletzung der Jungfräulichkeit vor der Ehe öffentlich vorwarf (vgl. Dtn 22,29) und wenn er sich ein unberührtes Mädchen mit Gewalt gefügig gemacht hatte (vgl. Dtn 22,29). - Gegen Entlassung der Frau aus leichtfertigen Gründen richtete sich der Prophet Maleachi (vgl. Mal 2,16). In seiner Sicht ist Jahwe Zeuge des Ehebundes. Hier deutet sich bereits die "Ehelehre" des Neuen Testamentes an.
Jesus verkündet und fordert eine Liebe, die den ganzen Menschen umfaßt und an der Liebe Gottes Maß nimmt. Die zentrale Liebesforderung Jesu umschließt auch die geschlechtliche Liebe. Obwohl sie in Jesusworten nie ausdrücklich vorkommt, ist sie doch in seiner Hochschätzung der Ehe vorausgesetzt. Jesus führt sie auf das schöpferische Handeln des Vaters zurück. Die so ermöglichte Liebe zwischen Mann und Frau schließt Polygamie und Ehescheidung aus. Von der ursprünglichen Absicht des Schöpfers her soll die von Gott gestiftete Ehe von Mann und Frau in Liebe und Treue bis ans Lebensende dauern. - An Jesu Verbot, die Ehe zu scheiden, ist nach der doppelten Überlieferung in einem Wort bei Mt 5,32/Lk 16,18 und in einem Schul- oder Streitgespräch bei Mk 10,2-12/Mt 19,3-9 nicht zu zweifeln. Die bei den Juden geltende Scheidungsregelung (vgl. Dtn 24,1) erkennt Jesus nicht als ursprünglichen Willen Gottes an. Die mit ihm hereinbrechende Gottesherrschaft ermutigt und befähigt zu Liebe und Treue. Gott verheißt und schenkt den Ehegatten seine Gnade, damit sie Schwierigkeiten und Nöte überwinden.
Die Urkirche hat trotz der damals weit verbreiteten Scheidungspraxis die Forderung Jesu als verbindliche sittliche Weisung verstanden (1 Kor 7,10). Eine geschiedene Frau sollte unverheiratet bleiben oder sich wieder mit dem Mann versöhnen (1 Kor 7,11). Für religiös gemischte Ehen gab Paulus besondere Anweisungen. Der christliche Partner sollte eine solche Ehe aufrechterhalten; wenn sich aber der ungläubige Teil trennen wollte, sollte der Bruder oder die Schwester nicht sklavisch gebunden sein (1 Kor 7,12-16), also wohl eine neue christliche Ehe eingehen dürfen (Privilegium Paulinum). So traf man in der Urkirche in schwierigen Fällen besondere Regelungen, die der Weisung Jesu möglichst nahekommen und seinem Geist entsprechen sollten.
Im Hinblick auf eine Ausnahme wegen "Unzucht" (Mt 5,32; 19,9) scheint Matthäus in seiner jüdisch-christlichen Gemeinde eine Frage anzusprechen, die kaum hinreichend geklärt werden kann. Wahrscheinlich ist hier die Erlaubnis der Auflösung von Ehen gegeben, die bereits vor Eintritt in diese Gemeinde geschlossen worden und aus nicht genau erkennbaren Gründen in ihr unannehmbar waren. Diese Auslegung scheint sich dadurch nahezulegen, daß "Unzucht" (porneia) viele unterschiedliche Interpretationen zuläßt.
Nach katholischem Glauben ist die sakramentale Ehe ein Bund, in dem die Liebe Jesu Christi zu seiner Kirche in einer eigenen Weise dargestellt wird (Eph 5,21-33). In Menschwerdung, Tod und Auferstehung hat Christus sich seiner Kirche geschenkt und sich für sie hingegeben. Nur in diesem Geheimnis kann die Ehe als Sakrament verstanden und gelebt werden. Sie ist eine Weise der Christusnachfolge.
Mit der sakramentalen Sicht der christlichen Ehe verkündet die katholische Kirche eine hohe Eheauffassung. Ihr Bekenntnis zur Unauflöslichkeit stößt in der heutigen Welt vielfach auf Unverständnis. Das kann aber für die Kirche kein Grund sein, ihre Grundsätze über die Ehe zu ändern. Andernfalls würde sie dem Wort ihres Herrn untreu werden. Die Kirche sieht in der Botschaft Jesu über die Ehe eine Frohe Botschaft. Diese läßt in der mit Jesus angebrochenen neuen Schöpfung spüren, daß in dem Ruf zur unteilbaren und unaufgebbaren Treue ehelicher Gemeinschaft eine Lebensmöglichkeit angeboten wird, in der die Eheleute die Treue Christi zu seiner Kirche nachvollziehen, indem sie einander die Treue halten.
Vom Verständnis der christlichen Ehe als Sakrament her hält die katholische Kirche daran fest, daß die sakramental geschlossene und als solche vollzogene Ehe weder durch die Eheleute selbst zurückgenommen (innere Unauflöslichkeit) noch durch irgendeine Macht aufgehoben (äußere Unauflöslichkeit) werden kann.
Die Kirche sieht aber auch, daß Ehen in eine Krise geraten und scheitern können. Unter denen, die sich scheiden lassen, gibt es heute mehr und mehr auch katholische Christen. Jedes Scheitern einer Ehe ist für die Betroffenen schmerzlich. Es hinterläßt Wunden und häufig auch bedrückende soziale Folgen. Manche Ehegatten sind von ihrem Ehepartner verlassen worden und leben getrennt von ihm. Andere haben sich so auseinandergelebt, daß sie keine Chance mehr für eine Versöhnung mit dem Ehegatten sehen und als Geschiedene allein leben. Getrennt Lebende und Geschiedene, die für ihr weiteres Leben allein bleiben, können und sollen weiterhin am Leben der Kirche teilnehmen und ihre Sakramente empfangen (vgl. FC 83). Bei anderen stellt sich manchmal auch in einem kirchlichen Eheprozeß heraus, daß die Partner gar keine gültige Ehe eingegangen sind. Wieder andere entschließen sich nach kürzerer oder längerer Zeit nach der Scheidung einer gültigen Ehe zu einer standesamtlichen Wiederverheiratung.
Das ist in zunehmendem Maße auch bei solchen katholischen Christen der Fall, die am Leben der Gemeinde teilnehmen und in der Kirche Heimat gefunden haben. Oft fühlen sich katholische Christen, die nach der Scheidung eine zivile Ehe eingegangen sind, in der Kirche nicht mehr ganz zu Hause. Manche wenden sich sogar ganz von ihr ab, weil sie irrtümlich annehmen, sie seien aus der Kirche ausgeschlossen. Andere wiederverheiratete Geschiedene äußern den dringenden Wunsch, in der Gemeinschaft der Glaubenden am eucharistischen Mahl teilnehmen zu dürfen.
Wiederverheiratete Geschiedene gehören auch weiter zur Kirche und sind zum Gottesdienst wie auch zu allen kirchlichen Veranstaltungen eingeladen wie alle anderen Christen. Wiederverheiratete Geschiedene sollen bedenken, daß sie in unterschiedlichen Weisen am Leben der kirchlichen Gemeinschaft teilnehmen können. In der Bereitschaft zur Buße, im Hören des Wortes Gottes, in der Teilnahme am heiligen Meßopfer, im Gebet, in der Mitarbeit in der Gemeinde und in der gläubigen Erziehung der Kinder rufen sie die Gnade Gottes auf sich und ihre Kinder herab.
Wiederverheiratete Geschiedene können nach der geltenden Ordnung der Kirche nicht zu den Sakramenten zugelassen werden. "Denn ihr Lebensstand und ihre Lebensverhältnisse stehen in objektivem Widerspruch zu jenem Bund der Liebe zwischen Christus und der Kirche, den die Eucharistie sichtbar und gegenwärtig macht" (FC 84; KKK 1665).
Die Kirche hat schon seit langer Zeit wiederverheirateten Geschiedenen den Zugang zur Eucharistie eröffnet, wenn sie zwar miteinander eine enge Lebensgemeinschaft teilen, jedoch im Blick auf das persönliche Verhältnis zueinander wie Bruder und Schwester, das heißt, enthaltsam leben (vgl. FC 84). Viele halten eine solche Empfehlung für unnatürlich und unglaubwürdig. Nicht wenige wiederverheiratete Geschiedene sind jedoch diesen außerordentlichen Weg mit Tapferkeit und Opferbereitschaft gegangen. Sie verdienen Respekt und Anerkennung. Freilich kann diese Lebensweise auf die Dauer nicht von allen wiederverheirateten Geschiedenen, besonders jüngeren Paaren, verwirklicht werden.
Die Kirche weiß um die Not vieler und leidet an ihr mit. Sie sucht in ihrem Hirtendienst und in der Theologie nach Hilfen, die mit der Weisung Jesu und der Lehre der Kirche über die unwiderrufliche Treue in der Ehe vereinbar sind. Die Seelsorger sind verpflichtet, den wiederverheirateten Geschiedenen mit besonderem Eifer nachzugehen. Bei der Suche nach konkreten Hilfen sind sie um der Liebe zur Wahrheit willen verpflichtet, "die verschiedenen Situationen gut zu unterscheiden. Es ist ein Unterschied, ob jemand, trotz aufrichtigen Bemühens, die frühere Ehe zu retten, völlig zu Unrecht verlassen wurde oder ob jemand eine kirchlich gültige Ehe durch eigene schwere Schuld zerstört hat. Wieder andere sind eine neue Beziehung eingegangen im Hinblick auf die Erziehung der Kinder und haben manchmal die subjektive Gewissensüberzeugung, daß die frühere, unheilbar zerstörte Ehe niemals gültig war" (FC 84). Diese unterschiedlichen Situationen und Umstände sollen die Betroffenen in einem aufrichtigen Gespräch mit einem klugen und erfahrenen Seelsorger zu klären, zu beurteilen und zu bewerten suchen, um ihrerseits zu einem verantworteten Gewissensurteil zu kommen.
Der Seelsorger soll sie auch auf die in der Kirche gegebenen Mittel und Wege einer rechtlichen Klärung ihrer Situation hinweisen. In jedem Fall muß bei der Suche nach Hilfen vermieden werden, daß bei den Menschen innerhalb und außerhalb der Kirche über die Unauflöslichkeit der Ehe Irrtum und Verwirrung entstehen.
Als schwerer Verstoß gegen die sittliche Ordnung der Ehe gilt in der Kirche von Anfang an der Ehebruch. Die kirchliche Tradition zählte ihn neben Glaubensabfall und Mord zu den schwersten Vergehen (Kapitalsünden).
Manchmal ist Ehebruch ein spontaner Fehltritt; zumeist hat er aber bereits eine Vorgeschichte: fehlendes Gespräch in der Ehe, mangelnde Verarbeitung von Konflikten, Nachlassen in der Aufmerksamkeit füreinander, sexuelle Unerfülltheit in der Ehe, Erfahrungen des Begehrtwerdens durch andere, Einstellung der Umwelt zu Sexualität und ehelicher Treue, familiäre Zerwürfnisse, gesellschaftliche und berufliche Belastungen, Einsamkeit und vieles mehr.
Ein Ehegatte, der erfahren muß, daß der andere Ehebruch begangen hat, empfindet das oft als schwere Beleidigung und als Verletzung der ehelichen Treue, zu der die Ehegatten sich in der Eheschließung aneinander gebunden haben. Deshalb ist Ehebruch eine schwere Verfehlung gegen die eheliche Liebe und Treue, gegen den Bund der Ehe und gegen das Sakrament der Liebe Christi.
Im Alten Testament finden wir in der rechtlichen Regelung der Ehe und des Ehebruchsverbotes eine Entwicklung vor, in der zunächst beide Ehepartner vom Verbot betroffen werden, allerdings beide noch nicht in gleicher Weise. Bei einem außerehelichen Geschlechtsverkehr begeht der Mann nur dann Ehebruch, wenn er mit einer Verheirateten, nicht wenn er mit einer Unverheirateten verkehrt; die Frau aber macht sich in jedem solchen Fall des Ehebruchs schuldig. Allerdings wendet sich das Alte Testament auch gegen den Verkehr des Mannes mit Unverheirateten, der als etwas Schändliches gilt, das der Schuldige wiedergutmachen soll (vgl. Dtn 22,28f); er ist aber für den Mann sowenig Ehebruch wie der Verkehr mit einer Dirne, wiewohl auch dies "moralisch" als "Todesweg" eingestuft wird (vgl. Spr 5,3ff; 23,27ff). Diese Ungleichbehandlung von Mann und Frau im Bereich des sechsten Gebotes ist zeitgeschichtlich aus dem Umstand zu verstehen, daß die Frau noch unter die Besitztümer des Mannes gerechnet wird, während sie selbst nie rechtlich als Besitzerin des Mannes gilt.
Im Bereich des Begehrungsverbotes (Dtn 5,21) ist die Frau aus der Reihe der Besitztümer des Mannes herausgenommen. Das neunte Gebot meint innere Entscheidungen, bei denen Wege geplant und bereitet werden, mit deren Hilfe die Frau des Nächsten verführt werden soll. Es verpflichtet den Menschen - und dies besonders im Bereich des Geschlechts- und Erwerbstriebs -, sein "Innen", aus dem alle Handlungen hervorgehen, so zu ordnen und zu steuern, daß das Wohl des Nächsten und der Gemeinschaft im Auge behalten und gesichert wird. Diese innere Zucht - in Frontstellung zu den "bösen Plänen des Herzens" (vgl. Gen 8,8; Jer 7,24; Sir 5,2) - wurde je länger je mehr, besonders in der Weisheitslehre, ein Ideal der Lebensführung, so daß Ijob bekennt: "Einen Bund schloß ich mit meinen Augen, nie eine Jungfrau lüstern anzusehen" (31,1).
In der Antwort an den jungen Mann, der nach dem "Weg zum ewigen Leben" fragt, bestätigt Jesus, daß dazu das Halten der Gebote gehört, darunter auch die Weisung: "Du sollst nicht die Ehe brechen" (Mk 10,19). Dieses Verbot will die eheliche Treue schützen. Darüber hinaus warnt Jesus vor dem im Herzen aufsteigenden Begehren und fordert eine letzte Herzensläuterung: "Ihr habt gehört, daß gesagt worden ist: Du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch: Wer eine Frau nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen" (Mt 5,27). Im "lüsternen Anschauen" offenbart sich ein Mangel an Zuwendung zum Ehegatten: ein "Ehebruch im Herzen".
Seit ihren Anfängen weist die Kirche sexuelle Freizügigkeit, den Umgang mit Dirnen (vgl. 1 Kor 6,12-20) und eheliche Untreue als sittlich unerlaubt zurück (vgl. Gal 5,19; Kol 3,5; Eph 5,3 u. a.). Diese ist nicht, wie manche meinen, ein unbedeutender "Seitensprung", sondern ein schweres Unrecht. - In der Trauungsliturgie versprechen sich die Eheleute, daß sie einander die Treue halten in guten und in bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, und sich lieben, achten und ehren, bis der Tod sie scheidet.
Dieser Zielgestalt der Ehe widerspricht auch die sogenannte "offene Ehe", in der sich die Ehegatten gegenseitig das Recht zuerkennen, auch außereheliche sexuelle Beziehungen aufzunehmen. Diese gegenseitig gewährte "Freizügigkeit" ist weniger ein Zeichen von humaner Großherzigkeit als von mangelnder Bereitschaft zur sittlichen Gestaltung der Ehe und von Mißachtung der Würde der menschlichen Person. Fast immer spüren Eheleute, die solche Vereinbarungen treffen, daß ihre Ehe zerstört ist. Ihre eheliche Gemeinschaft leidet unter starken Belastungen, oft kommt es zu schweren gegenseitigen Demütigungen und zur Auflösung der Ehe.
Christliche Eheleute wissen sich in ihrem Bund der Liebe und Treue Christi zu seiner Kirche eingebunden und empfangen in der sakramentalen Ehe Kraft zum Durchhalten ihres Treuebundes (vgl. Eph 5,21-32). Dieser Bund ist ein Bund des gegenseitigen Vertrauens, ein Prozeß, in dem es auch Versagen, Schuld und Erkalten der Liebe geben kann; doch ist das für Christen kein Grund zur Aufkündigung der Treue. Auch wenn ein Partner die eheliche Gemeinschaft verlassen hat, bleibt der andere in Treue an seinen Gatten gebunden. Er kann sein Alleinsein bewußt und gläubig in der Nachfolge Christi als Anteil an seinem Kreuz tragen.
- "In der Bindung bis in den Tod bringt ein Ehegatte die Liebe Christi, von der nichts scheiden kann (Röm 8,35), in die alltägliche Nähe des Ehepartners. In solcher ein ganzes Leben umspannender Treue zeigt sich die Fülle christlicher Existenz: der Glaube an den Auferstandenen, welcher den Glauben an die Auferweckung des Ehepartners einschließt; die Hoffnung, welche für den anderen hofft, indem sie auf Christus setzt; die Liebe, die am anderen festhält, weil sie ihn in Christi Liebe zu bejahen vermag" (EF 1.2.2.3.).
2.3. Gleichberechtigung, Partnerschaft und Institution
In der partnerschaftlichen Liebe erkennen Mann und Frau einander als gleichrangig und gleichwertig an und achten sich in ihrem Mannsein und in ihrem Frausein. In diesem Verständnis der Zuordnung von Mann und Frau wird "die lange Zeit in Gesellschaft und Kirche vorherrschende Betonung der Ehe als Institution zur Erzeugung und Erziehung von Nachkommenschaft durch eine Orientierung am Leitbild der partnerschaftlichen Ehe ergänzt" (EF 0.1; vgl. GS 47ff). Zu dieser Neuorientierung, in der "auch eine vorwiegend rechtliche Sicht der Ehe als vertraglicher Institution und die stark patriarchalisch bestimmte Rollenverteilung von Mann und Frau korrigiert" wurde, haben "die Auflösung der Großfamilie alter Prägung, die Trennung von Familie und Arbeitswelt sowie die zunehmende Gleichberechtigung von Mann und Frau beigetragen" (ebd.).
In der früheren geschlossenen Gesellschaft war die Ehe in die Großfamilie eingebunden. Die Lebensgemeinschaft der Ehe und Familie war zugleich Wirtschafts- und Produktionsgemeinschaft. In ihr hatte die Weitergabe des Lebens den Vorrang vor der Partnerbeziehung, zumal es eine hohe Kindersterblichkeit gab. Zwar zeigen viele Beispiele, daß die Gattenliebe als hoher Wert gepriesen wird, aber die Erzeugung von Nachkommenschaft zur Erhaltung der Wirtschaftsgemeinschaft war oft wichtiger als die Liebe der Ehegatten.
Im Industriezeitalter änderte sich die Wirtschaftsstruktur. Die Großfamilie wurde aufgelöst. Heirat, eheliches und familiäres Leben werden von nun an nicht mehr durch ökonomische Interessen bestimmt, sondern man heiratet den Partner, den man liebt. Es entsteht die partnerschaftliche Ehe.
Mit den Veränderungen in der Arbeitswelt beginnen auch Frauen, außerhäusliche Arbeiten aufzunehmen und Berufe zu ergreifen, die früher den Männern vorbehalten waren. Erstmals in der Geschichte der Menschheit setzt sich auch praktisch durch, daß Mann und Frau, die gleichwertig und gleichrangig sind, als gleichberechtigt anzuerkennen sind.
Die Anerkennung der Gleichrangigkeit, der Gleichwertigkeit und vor allem der Gleichberechtigung der Frau hat sich auch heute noch nicht in allen Ländern der Erde durchgesetzt. Andere Religionen sehen die Stellung der Frau anders als das Christentum. Selbst im von Judentum und Christentum geprägten Bewußtsein ist das, was wir heute als selbstverständliche Konsequenz des Schöpfungs- und Erlösungsglaubens ansehen, erst in einem langen Prozeß zum Durchbruch gekommen.
Die Bibel deutet das in der damaligen Zeit bestehende Herrschaftsverhältnis zwischen Mann und Frau als eine Folge des Sündenfalls. Nach ihm spricht Jahwe zur Frau: "Du hast Verlangen nach deinem Mann; er aber wird über dich herrschen" (Gen 3,16). - Trotz der untergeordneten sozialen Stellung der Frau und trotz ihrer Einordnung in die Besitztümer des Mannes beruft sich die Bibel für die Gleichrangigkeit und Gleichwertigkeit der Geschlechter auf die ursprüngliche Absicht des Schöpfergottes (vgl. Mk 10,6f). Die rechtliche Durchsetzung der Gleichberechtigung kam in den damaligen patriarchalischen Strukturen der Gesellschaft allerdings noch nicht in den Blick.
Jesus rückte durch sein Verhalten die Würde und Gleichwertigkeit der Frau ins Licht. An seiner Predigt, an seinen Heilungen und an seiner Liebe zu den Menschen haben die Frauen ebenso Anteil wie die Männer. Er nimmt Frauen in seine Begleitung auf und läßt sich von ihnen unterstützen (Lk 8,1-3), tritt für eine verachtete Dirne ein (Lk 7,36-50) und durchbricht die damaligen gesellschaftlichen Schranken (Joh 4,27) und religiösen Tabus (Mk 5,28-34).
In seinen Aussagen über die Ehe (Mk 10,1-12; Mt 5,31f; 19,1-10; Lk 6,16-18) und vor allem im Wort vom Scheidungsverbot (Mk 10,6-9) richtet sich Jesus scharf gegen das jüdische Scheidungsrecht und nimmt Partei für die Würde der Frau. Er stellt heraus, daß die Frau nicht Besitz des Mannes ist und daß der Mann in gleicher Weise zur Treue verpflichtet ist wie die Frau. Damit macht er in den damaligen rechtlichen Strukturen einen unbedingten sittlichen Anspruch geltend, der in der Beziehung der Ehegatten auf die Verwirklichung der Liebesforderung zielt. Diese ist nur möglich, wenn Mann und Frau gleichwertige Partner sind.
Die Absicht Jesu, den gleichen Rang und die gleiche Würde der Frau gegenüber dem Mann zur Geltung zu bringen und die Frauen aus den Fesseln damaliger Anschauungen und Gewohnheiten zu befreien, wird in der Urkirche ernstgenommen. Paulus greift auf die Taufe zurück, in der die bisherigen Unterschiede überwunden und alle Getauften zu einer Einheit in Christus zusammengeführt sind. "Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau; denn ihr alle seid einer in Christus Jesus" (Gal 3,27f). Dieser grundlegende theologische Satz, der die Schöpfungsordnung in der von Christus gebrachten Neuschöpfung neu auslegt, zielt dahin, die bisherigen trennenden Schranken und Hemmnisse zu überwinden.
Die gläubige Erkenntnis in die Praxis umzusetzen war selbst für Paulus nicht leicht (vgl. 1 Kor 11,2-16), obwohl er Frauen zur vollen Teilnahme am Gemeindeleben berief, ja leitende Aufgaben (vgl. Röm 16,1-5 u. a.) und missionarische Tätigkeit (vgl. Röm 16,7) von Frauen anerkannte. In der Zeit nach Paulus gab es auch Tendenzen, Frauen stärker dem häuslichen Bereich zuzuordnen (vgl. 1 Kor 14,34f mit 1 Tim 2,11-15; ferner 1 Petr 3,1-6; Tit 2,5; 1 Tim 5,11-14). Die Mahnung an die Männer, ihre Frauen zu lieben, die auch in römisch-hellenistischer Ethik auftaucht, empfängt in Eph 5,25-32 innerhalb einer christlichen "Haustafel" eine einzigartige Vertiefung: "Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat" (5,25). Das Vorbild der dienenden Liebe Christi mußte die Haltung des Mannes zu seiner Frau verändern: statt patriarchalischer Machtausübung hingebende Liebe. Im übrigen mahnt Eph 5,21 alle Christen, Männer und Frauen: "Einer ordne sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus." - Das hohe Bild der Ehe, das hier entworfen wird, bleibt in der Wirklichkeit dieser Welt gewiß ein nie einholbares Ideal; es deckt aber eine Sicht auf, in der Liebe und Treue in der Ehe nicht unerreichbar erscheinen.
Auch in der Gegenwart wird der Frau nicht immer jene Anerkennung und Achtung gewährt, die ihr zukommt. Mit Recht wehren sich Frauen und Männer aber auch gegen extreme Bewegungen, die den Reichtum der Verschiedenheit der Geschlechter aufzuheben versuchen und so das Bild der Frau in seinen spezifischen Werten verfälschen. Mann und Frau sind zwar gleichwertig, aber nicht gleichartig. Unterordnung, Gegensätzlichkeit oder einseitige Emanzipation werden der Beziehung der Geschlechter nicht gerecht.
Wer meint, wegen der Gleichwertigkeit komme es für die Frau darauf an, dem Mann gleich zu sein, macht fälschlicherweise den Mann zum Maßstab des Menschseins. - Zum vollen Menschsein gehört, daß der Mann ganz Mann und die Frau ganz Frau ist und daß beide einander ergänzen.
Trotz mancher Fehleinschätzungen und Fehlhaltungen wird heute die eheliche Gemeinschaft, in der die Eheleute bemüht sind, als gleichwertige Partner zusammenzuleben, als humane Gestalt von Ehe erfahren. Die partnerschaftliche Ehe wird von den Eheleuten als besonderer Raum persönlicher Zuwendung und Geborgenheit erlebt, der zugleich offen ist für die verantwortete Weitergabe des Lebens, aber auch für die Begegnung mit Freunden und Bekannten, für die Teilnahme am kulturellen und gesellschaftlichen Leben, für Arbeit und Beruf.
Die heutige Ehe stellt "hohe Anforderungen an die Liebesfähigkeit der Ehegatten, an ihre Offenheit füreinander, an das Vermögen der Reifung im Verlauf der verschiedenen Phasen des menschlichen Lebens und an ihre Bereitschaft zur Konfliktlösung" (EF 0.2.). Das macht die Ehe in unserer Zeit verletzlicher und anfälliger, denn die Eheleute sind oft auf sich selber und die eigene Kraft verwiesen, um anstehende Probleme zu lösen.
Junge Ehepaare stellen manchmal schon nach kurzer Ehedauer fest, daß die Wirklichkeit ihres ehelichen Lebens nicht dem Leitbild entspricht, das sie für ihre Ehe gewünscht und erträumt hatten. Romantische Vorstellungen von Identitätsfindung, Selbstverwirklichung und bleibend gelingender Sexualität, mangelnde Einübung in Verzicht auf Eigeninteressen sowie fehlende Fähigkeit zu klärendem Gespräch und zu gemeinsamer Bewältigung von Konflikten führen zu Spannungen und Enttäuschungen und lassen Verbitterung und gegenseitige Verweigerung aufkommen. Schon kleinere Konflikte können als übermächtiger Leidensdruck erfahren werden, der in eine Krise treibt, aus der als einzig möglicher Ausweg die Flucht in die Scheidung erfolgt. - In solchen Krisen geraten auch Eheleute, die feststellen, daß in der Sorge um die Erziehung und Ausbildung der Kinder ihre eigene Partnerbeziehung verkümmert ist. Sie empfinden nach dem Weggang der erwachsenen Kinder ihre Ehe als sinnentleert und meinen, für das weitere Leben mit einem anderen Partner einen neuen Anfang machen zu sollen.
Auch die veränderte Aufgabenverteilung von Mann und Frau bringt Belastungen und Gefährdungen mit sich. Es gibt viele Beispiele gelungener Ehen, in denen Ehegatten, unabhängig davon, ob einer oder beide Eheleute im außerhäuslichen Arbeitsprozeß stehen, miteinander glücklich sind. Andere Ehen leiden unter den Spannungen und Belastungen der Berufstätigkeit beider Ehegatten, der unterschiedlichen Arbeitszeiten und Arbeitsorte, der Arbeitslosigkeit, des Berufs-, Wohnungs- und Ortswechsels, der Aufgaben in Haushalt und Familie und der Sorge für die Kinder.
Einseitige Vorstellungen von Partnerschaft, aber auch die Erfahrung des Auseinanderbrechens von Ehen in der eigenen Familie und im Umfeld tragen dazu bei, daß das Bewußtsein für den Wert der Ehe als lebenslange Gemeinschaft und als Institution abnimmt. Für viele ist das Wort Institution ein Reizwort geworden. Sie bejahen die Liebe, lehnen aber die Institution Ehe ab. Sie verstehen die Ehe als private Angelegenheit, für die Trauschein, sittliche Normierungen und rechtliche Regelungen als überflüssig oder als Fesseln angesehen werden. Nach ihrer Auffassung entwürdigt die Institution die Person. - Vor allem die jüngere Generation stellt kritische Anfragen: Ist die Institution überhaupt nötig? Warum sind volle geschlechtliche Beziehungen erst in der Ehe erlaubt? Ist das Hineinwachsen in die Ehe nicht ein Prozeß, in dem voreheliches Zusammenleben als Einüben in die Partnerschaft wichtig ist?
Schwierigkeiten und Konflikte in der Ehe und mit der Ehe beruhen heute zum Teil auf objektiven Lebensbedingungen, zum Teil auf subjektiven Fehleinschätzungen, aber oft auch auf sündhaftem Verhalten. Die vielen Scheidungen bringen Verwundungen bei den Ehepartnern und Leiden bei den Kindern mit sich, die als "Scheidungswaisen" zurückbleiben; man beruft sich auf die Liebe und gerät in die Gefahr, sich von der Verantwortung für die Treue zurückzuziehen; und in der Gesellschaft schwindet das Vertrauen in die Tragfähigkeit der Ehe als Institution. All das stellt Kirche und Gesellschaft vor die Frage nach einem umfassenden Verständnis der Ehe und nach Orientierungen, die es den jungen Menschen ermöglichen, die Werte der partnerschaftlichen Ehe zu entdecken und zu leben. Was können menschliche Erfahrungen und christlicher Glaube dazu sagen?
- Die Gemeinschaft ehelicher Liebe zwischen Mann und Frau ist die intimste Gemeinschaft, die es unter Menschen gibt. Zu ihr gehören Spontaneität und Leidenschaftlichkeit, aber auch Beständigkeit und Dauer. Deshalb sagen Mann und Frau in der Eheschließung ein unbegrenztes Ja zueinander, das über ihre unmittelbaren Empfindungen hinausgeht. In dieses Ja zum gemeinsamen Leben sind Ehegatten und Kinder eingeschlossen; es ist ein Ja zur Ehe und Familie; ein Ja zum gemeinsamen Lebensweg in guten und in bösen Tagen. Dieses Ja ist ein Wagnis, vor dem der Mensch zurückschrecken kann; doch dürfen Mann und Frau, die sich in der Ehe einander binden, gewiß sein, daß ihnen in ihrem vor Gottes Angesicht geschlossenen Ehebund Gott nahe ist. Er trägt, schützt und stützt das zerbrechliche Ja der Ehegatten durch seinen Segen. Die katholische Kirche versteht diesen Segen Gottes für die Ehe unter Christen als eine von Jesus Christus selbst gewollte und von Gott im Zeichen des Eheversprechens geschenkte Zusage der Gnade. Sie bezeichnet eine solche Ehe als Sakrament. Die evangelische Kirche begreift zwar die Ehe mit Martin Luther als "weltlich Ding", sieht aber ihre Verbindlichkeit in Gottes gnädiger Anordnung und in seiner Liebe zu den Menschen begründet und getragen.
- Das ausdrückliche Eheversprechen ist ein Akt endgültiger Zusage der Partner. Es befreit von Willkür und wechselnden Einstellungen und weist immer wieder auf das hin, was die Partner miteinander verbindet. Deshalb gehört die Bereitschaft, sich zu binden, zur Wahrhaftigkeit und zur Reife der Liebe, in der die Eheleute wissen, daß sie sich aufeinander verlassen können. Die personale Liebe und das mit ihr verbundene intime eheliche Leben brauchen Verbindlichkeit und Objektivität. Durch sie wird die Beziehung der Ehepartner nicht erschwert, sondern unterstützt und geschützt.
- Die intime Gemeinschaft der Ehegatten ist stets eine vor den anderen zu verantwortende Gemeinschaft. Das ausdrückliche Versprechen muß deshalb auch ein öffentlich bekanntes Versprechen sein, das von anderen gehört und geachtet wird. Das öffentliche Versprechen ist gewissermaßen die Bestätigung der Aufrichtigkeit des Willens zu dauerhafter Bindung.
- "Durch die Öffentlichkeit des Eheversprechens wird die Verläßlichkeit des Ja-Wortes in seiner Verbindlichkeit für die Ehepartner und für die Menschen, mit denen sie in der Gesellschaft leben, bekannt und bekräftigt. So gehören persönliche Beziehungen und öffentliche, auch rechtlich wirksame Bindung im Eheversprechen zusammen. Zwischen der persönlichen Beziehung der Eheleute und ihrer institutionellen Form besteht kein Gegensatz. Die Öffentlichkeit des Eheversprechens nimmt diesem nicht den diskreten Ursprung in der unmittelbaren und ganz persönlichen Liebe der Partner; es bedeutet Schutz und Anerkennung, Unterstützung und Zeugenschaft für das ergangene Ja-Wort und für den gemeinsamen Weg. Ohne die so verstandene institutionelle Verfassung der Ehe bleibt die angestrebte Lebensgemeinschaft einer zerstörerischen Unsicherheit ausgesetzt; dies führt zunächst zu einer stetigen Gefährdung des Vertrauens, auch wo dies zunächst nicht erkannt und nicht eingestanden wird" (Ja zur Ehe, Gemeinsame Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz und des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Oktober 1981, II, 3).
Die institutionellen Regelungen schließen Konflikte und Krisen im Verhältnis der Ehepartner nicht aus. Sie verhindern auch nicht, daß das Festhalten an der Institution als sinnlos erscheinen kann, wenn die Ehe Rückschläge erleidet; aber sie sind Mahnung und Anruf an die Eheleute, zu ihrem Ja-Wort zu stehen und sich gegenseitig zu stützen. In der Bindung aneinander geben die Ehegatten vermeintliche Vorrechte auf, helfen einander in den täglichen Arbeiten und erfahren Freude an und mit den Kindern; sie suchen Begegnungen mit Freunden, nehmen Anteil am öffentlichen Leben und bemühen sich in gemeinsamer Verantwortung vor Gott um ihr religiöses Leben und um ihren Dienst in Kirche und Welt (vgl. FC 42).
So kann die christliche Ehe der Lebensraum für das Ja-Wort der Ehegatten sein. Wie sehr die Ehe auch Belastungen ausgesetzt ist, so ist sie doch offen für ein gemeinsames Leben in Glaube, Hoffnung und Liebe.
Wo Eheleute um ihre eigenen Schwächen und um die des anderen wissen, werden sie auch bereit sein, Vergebung zu erbitten und zu gewähren, Krisenzeiten zu ertragen und mitzutragen. Wenn Christen dafür ein Beispiel geben, werden junge Menschen wieder die Sinnhaftigkeit der Ehe entdecken und bereit sein, ihr Ja-Wort zur Ehe zu wagen.
Kirche und Gesellschaft tragen Mitverantwortung für die Förderung der Werte und Rechte der Ehe, für soziale und wirtschaftliche Unterstützung der Eheleute und für die rechte Einordnung der Ehe in den göttlichen Heils- und Weltplan wie auch in die Gesamtgesellschaft.
2.4. Eheliche Liebe, Fruchtbarkeit und Elternschaft
Die Liebe der Ehegatten kann auf vielfache Weise fruchtbar sein. Im Ja-Wort der Liebe sagt sich ein Mensch dem anderen zu. Im Wort "Ich liebe dich!" und in der leiblichen Hingabe vertrauen sich die Ehegatten einander an. Frucht dieser Hingabe aneinander ist das gemeinsame Leben, in dem sie zusammenwachsen und reifen.
- "Diese Liebe hat der Herr durch eine besondere Gnade und Liebe geheilt, vollendet und erhöht. Eine solche Liebe, die Menschliches und Göttliches in sich eint, führt die Gatten zur freien gegenseitigen Übereignung ihrer selbst, die sich in zarter Zuneigung und in der Tat bewährt, und durchdringt ihr ganzes Leben; ja gerade durch ihre Selbstlosigkeit in Leben und Tun verwirklicht sie sich und wächst" (GS 48).
Das Ja der Liebe, das darauf angelegt ist, Leben weiterzuschenken, kann fruchtbar werden in der Zeugung neuen Lebens. Angesichts dieser Möglichkeit übernehmen die Ehegatten eine große Verantwortung. Aus Mann und Frau werden Vater und Mutter. Sie erfahren durch das Kind, das ihnen anvertraut ist, in neuer Weise, was es bedeutet, Mensch zu sein. Sie nehmen das Kind an, wenden sich ihm zu und schenken ihm einen Lebensraum, in dem es geborgen ist und sich entfalten kann. Darin zeigen die Eltern, daß sie bereit sind, die besondere Aufgabe zu übernehmen, zu welcher "der Schöpfer die Menschen am Anfang als Mann und Frau geschaffen" (Mt 19,4; Gen 1,27) und ihnen "eine besondere Teilnahme an seinem schöpferischen Wirken" verliehen hat (GS 50).
Wie Gott Mann und Frau zur gegenseitigen Ergänzung und Zusammengehörigkeit beruft (vgl. Gen 2,18), in der sie "ein Fleisch" werden (Gen 2,24), so beruft er sie auch zur verantworteten Weitergabe des Lebens (vgl. HV 10). In der Bibel ist dieser Auftrag Gottes an den Menschen mit dem Auftrag zur Weltgestaltung und Weltbeherrschung verbunden (vgl.: Die Deutschen Bischöfe, Zu Fragen der menschlichen Geschlechtlichkeit, 7).
- "Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar, und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch, und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen" (Gen 1,28).
Gottes schöpferische Liebe will in der schöpferischen Liebe der Menschen sichtbar werden:
- "In ihrer Aufgabe, menschliches Leben weiterzugeben und zu erziehen, wissen sich die Eheleute als mitwirkend mit der Liebe Gottes des Schöpfers und gleichsam als Interpreten dieser Liebe" (GS 50).
Kinder geben dem Leben der Eheleute einen neuen Inhalt. Wie schon das wechselseitige Ja die Ehegatten beglückt hat, kann das Erleben, wie ein Kind heranwächst, lächelt, das Sprechen lernt und vieles mehr, den Eltern große Freude schenken, die auf das Kind wie eine wärmende Sonne strahlt, unter der es gedeihen kann. Wo Eltern solche Wärme vermitteln, sind sie "Interpreten" der Liebe Gottes. Und wenn solche Zuwendung auch oft überschattet sein mag von Sorgen, überwiegt im Normalfall doch die Freude.
Wo Eltern bereit sind, in der Weitergabe des Lebens mit der Liebe Gottes mitzuwirken, schließt dies ein, daß Mann und Frau ihre Elternschaft verantwortet ausüben. Was ist mit verantworteter Elternschaft gemeint?
Verantwortete Elternschaft besagt nach christlichem Verständnis zunächst: Der Raum, in dem das Leben verantwortlich weitergegeben wird, ist die Ehe. Das Zweite Vatikanische Konzil betont, daß die "Aufgabe, menschliches Leben weiterzugeben und zu erziehen", als eine nur den Eheleuten zukommende Sendung zu betrachten ist (GS 50).
Verantwortete Elternschaft besagt ferner, "daß die Gatten von sich aus entschlossen bereit sind zur Mitwirkung mit der Liebe des Schöpfers und Erlösers" (GS 50). Wenn ein Ehepaar sich wirklich liebt, wird es normalerweise den Wunsch empfinden, Kinder als Zeugen dieser Liebe zu haben. Das bereichert und vertieft die gegenseitige Verbundenheit und stellt eine entscheidende Schule der Gatten- und Elternliebe dar. Kinder sind aber nicht nur da, um Eltern zu beglücken, sondern sie sind eigene Personen mit eigenen Ansprüchen. Wer einem Kind das Leben schenken möchte, erfüllt nicht in erster Linie sich selbst einen Wunsch, sondern es muß ihm um das Kind selbst gehen. Als Glaubender weiß er: Letztlich lebt das Ja zum Kind aus dem Ja Gottes zum Menschen und zur Welt.
Verantwortete Elternschaft besagt schließlich: Wer Kinder haben will, muß fähig und bereit sein, sie angemessen zu ernähren, zu erziehen und auszubilden. Deshalb müssen Eheleute "in menschlicher und christlicher Verantwortung ihre Aufgabe erfüllen und in einer auf Gott hinhörenden Ehrfurcht durch gemeinsame Überlegung versuchen, sich ein sachgerechtes Urteil zu bilden. Hierbei müssen sie auf ihr eigenes Wohl wie auf das ihrer Kinder - der schon geborenen oder der zu erwartenden - achten; sie müssen die materiellen und geistigen Verhältnisse der Zeit und ihres Lebens zu erkennen suchen und schließlich auch das Wohl der Gesamtfamilie, der weltlichen Gesellschaft und der Kirche berücksichtigen. Dieses Urteil müssen im Angesicht Gottes die Eheleute letztlich selbst fällen" (GS 50).
Das sittliche Urteil darüber, wie in der konkreten Situation verantwortete Elternschaft zu verwirklichen ist, wird somit von der rechten Einsicht in individuelle, soziale und ökonomische Gegebenheiten mitbestimmt. Deshalb kann das Urteil über die sittlich vertretbare Kinderzahl nicht von vornherein so lauten, daß man sagt, die Zahl der Kinder in der Ehe müsse möglichst hoch oder möglichst niedrig sein. Das Urteil muß vielmehr von dem geleitet sein, was für die Mutter, den Vater und die Kinder in ihren Lebens-, Wohn-, Arbeits- und Ausbildungsverhältnissen zumutbar und im Rahmen der Verantwortung für die künftige Generation vertretbar ist.
Das Urteil der Eltern kann das eine Mal dazu führen, daß sie sich für ein weiteres Kind entscheiden; ein anderes Mal sehen sie sich zum Verzicht auf ein weiteres Kind überhaupt oder zu einem bestimmten Zeitpunkt verpflichtet. Die Entscheidung darf nicht willkürlich gefällt werden:
- "Christliche Ehegatten, die der göttlichen Vorsehung vertrauen und den Geist der Opferbereitschaft pflegen, verherrlichen den Schöpfer und gehen der Vollendung in Christus entgegen, wenn sie das Amt der Weitergabe des Lebens in großherziger menschlicher und christlicher Verantwortlichkeit verwalten. Unter den Ehegatten, die in solcher Weise das ihnen von Gott anvertraute Amt erfüllen, sind besonders jene zu erwähnen, die nach gemeinsamem, klugem Urteil auch eine größere in angemessener Weise zu erziehende Kinderzahl übernehmen" (GS 50).
Die Kirche ermutigt Eltern, Kindern das Leben zu schenken; sie warnt vor einer Tendenz, welche die Bereitschaft von Eltern, die mehreren Kindern das Leben ermöglicht, diffamiert. Egoismus und Pessimismus führen zu einer Mentalität, die kinderfeindlich und lebensfeindlich ist, einer Mentalität, die in der Konsumgesellschaft verbreitet ist. Ebenso sollen sie sich nicht zum Ausführungsorgan eines bloß nationalen oder wirtschaftlichen Denkens machen lassen. Zu den unveräußerlichen Rechten der Familie gehört "das Recht, die eigene Verantwortung in der Weitergabe des Lebens und in der Erziehung der Kinder wahrzunehmen" (FC 46).
Eheliche Liebe behält Sinn und Wert auch dann, wenn ihr die Fruchtbarkeit in der Zeugung neuen Lebens versagt ist (vgl. FC 41). Unfruchtbarkeit ist nicht - wie in manchen alttestamentlichen Vorstellungen - Fluch und Schande. Gottes Gnade und Segen gilt jeder Ehe, in der das Ja der Liebe und Treue die Gatten eint. Ehegatten können leibliche Unfruchtbarkeit als großes Leid erfahren; doch kann auch ihre Ehe fruchtbar werden, indem sie ein Kind adoptieren oder besondere Dienste in Kirche und Gesellschaft übernehmen.
2.5. Ehe und Ehelosigkeit
Viele Menschen leben ehelos: die einen, weil sie "um des Himmelreiches willen" (Mt 19,12), andere, weil sie im Einsatz für den Beruf oder in der Fürsorge für andere Menschen auf eine Ehe verzichten; wieder andere, weil sie keinen passenden Partner gefunden haben oder weil sie wegen körperlicher bzw. psychischer Behinderung keine Ehe eingehen können. Ehelosigkeit kann somit durch verschiedene Umstände und unterschiedliche Motive bedingt sein.
Das Motiv "um des Himmelreiches willen" ist die Bereitschaft, alle Kräfte für die Sache Jesu einzusetzen, der selbst für seine Verkündigung des Evangeliums und seine Hingabe an die Menschen ein eheloses Leben führte. Wenn Menschen auf einen besonderen Ruf Gottes hin ehelos leben, um auf diese Weise die Nachfolge Jesu zu verwirklichen, nimmt Jesus sie in Schutz und ermutigt sie dazu: "Manche sind von Geburt an zur Ehe unfähig, manche sind von Menschen dazu gemacht, und manche haben sich selbst dazu gemacht - um des Himmelreiches willen. Wer das erfassen kann, der erfasse es" (Mt 19,12). Die Berufung zur Ehelosigkeit "um des Himmelreiches willen" ist eine Gnade Gottes, der zu folgen nicht im Belieben des berufenen Menschen steht, aber ohne seinen freien Entschluß auch nicht verantwortbar wäre. Im Horizont der von Jesus verkündeten Gottesherrschaft hat ein solcher Entschluß einen zeichenhaften Sinn: Das ehelose Leben im Dienst Gottes und in der Hingabe an die Menschen verweist auf das künftige Gottesreich, in dem "sie nicht mehr heiraten" werden (Mk 12,25).
Der Zölibat des Priesters und die Ehelosigkeit der Ordensleute sind, wenn sie in der Ganzhingabe an Gott und im Dasein für andere vorgelebt werden, auch ein Anruf an Eheleute, in ihrer Ehe auf ihre Weise Gottes Reich zu suchen. Auf beiden Wegen kann der Ruf Jesu, sich Gott und den Menschen zu schenken, verwirklicht werden. Wie der Weg der Ehelosigkeit um des Gottesreiches willen eine eigene Weise der Liebe ist, so ist auch der Weg der Ehe eine eigene Weise, die Berufung der Person zur Liebe zu verwirklichen. Jeder der beiden Wege ist somit in der ihm eigenen Weise eine konkrete Verwirklichung des Menschen als "Sein nach dem Bilde Gottes". Beide Wege widersprechen einander nicht und lassen sich nicht gegenseitig ausspielen, denn "Ehe und Jungfräulichkeit sind die beiden Weisen, das eine Geheimnis des Bundes zwischen Gott und seinem Volk darzustellen und zu leben" (FC 16; vgl. auch KEK 1, 391).
Heute begegnet man vielfach der Meinung, die Hochschätzung der Ehelosigkeit um des Gottesreiches willen durch die Kirche bedeute eine Abwertung von Sexualität und Ehe; außerdem könne sexuelle Verzichtleistung zu Verdrängungen, Frustrationen und Neurosen führen. Dazu ist zu sagen: Wenn Sexualität und Ehe nicht als hoher Wert angesehen werden, ist auch der Verzicht auf die Ehe kein hoher Wert. "Wer die Ehe abwertet, schmälert auch den Glanz der Jungfräulichkeit; wer sie hingegen preist, hebt deren Bewunderungswürdigkeit mehr hervor und macht sie leuchtender" (Johannes Chrysostomus; vgl. FC 16). Wer ganz von der Sache Gottes ergriffen ist und sich ganz von diesem Engagement der Liebe zu Gott tragen läßt, findet gerade in dieser Form der Liebe seine Identität, in der er im Verzicht auf leibliche Fruchtbarkeit geistlich fruchtbar sein kann: in der zeichenhaft gelebten Erwartung des Reiches Gottes, in der Ganzhingabe an Jesus Christus und für den Dienst in der Kirche (vgl. UH III, 3).
Für Menschen, die sich aus beruflichen oder aus Gründen der Nächstenliebe zur Ehelosigkeit entschieden haben, wird es immer wieder darauf ankommen, daß sie sich die Motive der früheren Entscheidung immer neu vor Augen stellen und die Werte, um derentwillen sie auf die Ehe verzichtet haben, weiterhin bejahen.
Schwerer und schmerzlicher ist das Alleinsein für Menschen, die keinen passenden Partner finden oder ihren Ehegatten verloren haben. Hier verbindet sich mit dem Fehlen des Ehepartners oft das Gefühl der Enttäuschung, des Versagthabens oder der Trauer. Es fällt ihnen nicht leicht, mit der ihnen auferlegten Lebensform zurechtzukommen. Häufig werden Alleinstehende von anderen ausgenutzt. "An die Ehelosen richten sich viele Erwartungen, man ist aber wenig bereit, ihre besonderen Probleme zu sehen, die vorwiegend in der Einsamkeit liegen" (Die Deutschen Bischöfe, Zu Fragen der menschlichen Geschlechtlichkeit, 13). Alle sind aufgerufen, den Alleinstehenden besser gerecht zu werden. Abschätzige Einstellung zur Ehelosigkeit, Herabsetzung der Alleinstehenden und Zurücksetzung der Alleinerziehenden widersprechen dem christlichen Grundgebot. Christliche Gemeinden können den Alleinstehenden helfen, ihre Einsamkeit zu überwinden. Sie können freundschaftliche Kontakte schaffen und sie in ihre Familien einladen, denn Alleinstehende brauchen Beziehungen zu Bekannten und Freunden; sie müssen spüren, daß sie von ihrer Umgebung angenommen und geachtet werden.
In der Gesellschaft ist heute die Auffassung verbreitet, daß auch Alleinstehende ein Recht auf volle geschlechtliche Beziehungen hätten, wenn das nur mit Zustimmung des Partners und ohne Schaden für andere geschehe. Diese Auffassung steht jedoch im Widerspruch zur sittlichen Ordnung. Wer geschlechtliche Beziehungen zu jemand aufnimmt, mit dem er die volle Lebensgemeinschaft der Ehe nicht haben will oder nicht haben kann, handelt unwahrhaftig. Hinzu kommt, daß hier fälschlicherweise das sittliche Urteil über die Erlaubtheit sexueller Beziehungen nur vom unmittelbaren und augenscheinlichen Schaden für den anderen oder für andere abhängig gemacht wird. Jede sündhafte Handlung richtet Schaden an.
3. Sittliche Orientierung der Sexualität in der Ehe
3.1. Wert und Würde der ehelichen Begegnung
Das einende Prinzip, aus dem die Eheleute ihre Ehe formen und gestalten, ist die Liebe (vgl. EF 2.2.1.2.). Sie umgreift das eheliche Leben in der beglückenden Erfahrung, angenommen und verstanden zu sein, im Gefühl der Geborgenheit in und mit dem geliebten Partner, in der gegenseitigen Ergänzung und Fürsorge füreinander, in der Freude aneinander, in der Sprache und Gebärde der Liebe, im Zusammenwohnen und Beiwohnen als gemeinsamer Gestaltung des ehelichen und familiären Lebens.
Die geschlechtliche Begegnung soll ein Vollzug und eine Darstellung der ehelichen Liebe sein. Dem Glücken der Sexualität in der Ehe kommt große Bedeutung zu. Das sexuelle Erleben vermag die Erfahrung des Einsseins mit dem geliebten Ehepartner zu vermitteln; es schenkt in der Vereinigung das Gefühl tiefer Verbundenheit; es läßt in den Härten und Belastungen des Lebens Glück erfahren; es versöhnt in Auseinandersetzung und Streit; es trägt zur Reifung und Entfaltung der Persönlichkeit, zum Wachsen der gegenseitigen Liebe und zur Förderung des ehelichen und familiären Klimas bei.
In einer christlichen Eheethik haben abwertende Urteile über die Sexualität keinen Raum.
Maßstab für die sexuelle Begegnung in der Ehe ist die menschliche Würde. Es ist Aufgabe der Eheleute, eine Kultur der Geschlechtlichkeit zu entwickeln, die der Würde der Person entspricht. Daraus folgt als sittliche Orientierung, daß alle jene Akte, durch welche die Eheleute leiblich eins werden, von sittlicher Würde sind; "sie bringen, wenn sie human vollzogen werden, jenes gegenseitige Übereignetsein zum Ausdruck und vertiefen es, durch das sich die Gatten gegenseitig in Freude und Dankbarkeit reich machen" (GS 49).
So wertvoll und wichtig das Glücken der Sexualität in der Ehe ist, so ist die lustvoll erlebte Begegnung doch nicht der einzige Garant für die Erfüllung der Ehe. Sexuelles Erleben allein vermag die Partner auf Dauer weder zu binden noch zu erfüllen. Falsche Glückserwartungen können zu Enttäuschungen führen, wenn die Eheleute die Erfahrung machen, daß sie nicht erfüllbar sind. Außerdem verleiten sie zu einem Leistungsdenken, das Ängste und Minderwertigkeitskomplexe, sexuelles Versagen und bleibende sexuelle Störungen zur Folge haben kann.
Eine sinnvolle Gestaltung der Sexualität ist möglich, wenn die sexuelle Begegnung in Liebe geschieht und der Mensch in seinem Begehren nicht um sich selbst kreist, sondern sich dem anderen schenkt. Ehepartner müssen ein Gespür dafür entwickeln, daß Liebe Nähe und Distanz braucht.
Wo Mißtrauen, Eifersucht und Streit herrschen, wo Vergebung verweigert wird und Konflikte nicht ausgetragen werden, ist weder sexuelle Harmonie noch Erfüllung der Ehe möglich. Im ehelichen Leben muß jeder der Ehepartner seine Individualität wahren und müssen beide zusammen eine Gemeinschaft der Liebe sein.
Liebe rechnet nicht, sie duldet keinen Vorbehalt und keine Abstriche. Sie läßt sich nicht verbittern, sie ist langmütig und trägt nichts nach (vgl. 1 Kor 13). Sie setzt die Bereitschaft voraus, sich auf Unvorhersehbares und Nichtkalkulierbares einzulassen und auch am Partner festzuhalten, wenn das sexuelle Erleben aus unterschiedlichen Gründen nicht den jeweiligen Erwartungen entspricht, Einschränkungen oder Verzicht erfordert oder nicht mehr möglich ist.
Das Glücken der Ehe ist ein Geschenk, das der freigeschenkten Liebe des Ehegatten und der darin erscheinenden Liebe und Gnade Gottes verdankt wird. Eheliche Gemeinschaft und eheliches Glück sind Verheißung und Vorzeichen des Heiles, zu dem Gott die Menschen beruft; sie sind aber nicht dieses Heil selbst. Ehe lebt aus der Hoffnung, daß in ihr der Sinn gefunden wird, der über alles Verrechenbare hinausreicht. Ehegatten, die sich in diesem Sinn anvertrauen, gewinnen zunehmend die Gewißheit, daß es letztlich mit ihnen gut gehen wird. Ihre Liebe und ihre Hingabe sind schon immer von Gott getragen, der die Liebe ist und seine Liebe grenzenlos verschenkt. Für sie ist die christliche Botschaft von der Ehe eine Frohbotschaft, in der sich Gott ihnen zusagt und seine Hilfe gewährt.
3.2. Empfängnisregelung
Die Aufgabe, in gewissenhafter Entscheidung über die Zahl der Kinder und über die Abstände zwischen den Geburten zu bestimmen, bringt für die Eheleute die Frage mit sich, wie sie ihre Absicht, für eine bestimmte Zeit oder für immer auf weitere Kinder zu verzichten, mit der harmonischen Gestaltung ihres ehelichen Lebens in Übereinstimmung bringen können (vgl. GS 51; HV 10, 16). Aus der Verpflichtung zu verantworteter Elternschaft ergibt sich somit die Frage nach sittlich erlaubten Wegen der Empfängnisregelung.
Dauernder Verzicht auf die eheliche Begegnung ist ein schwer zu realisierender Weg, denn "wo nämlich das intime eheliche Leben unterlassen wird, kann nicht selten die Treue als Ehegut in Gefahr geraten und das Kind als Ehegut in Mitleidenschaft gezogen werden" (GS 51).
Die Entscheidung der Eheleute über Wege der Empfängnisregelung darf aber auch nicht willkürlich gefällt werden:
- "Wo es sich um den Ausgleich zwischen ehelicher Liebe und verantworteter Weitergabe des Lebens handelt, hängt die sittliche Qualität der Handlungsweise nicht allein von der guten Absicht und Bewertung der Motive ab, sondern auch von objektiven Kriterien, die sich aus dem Wesen der menschlichen Person und ihrer Akte ergeben und die sowohl den vollen Sinn gegenseitiger Hingabe als auch den einer wirklich humanen Zeugung in wirklicher Liebe wahren" (GS 51).
Die kirchliche Lehrverkündigung über die Empfängnisregelung betont, daß die beiden entscheidenden Sinngehalte, die liebende Vereinigung und die Fortpflanzung, untrennbar miteinander verbunden sind und deshalb jeder eheliche Akt für die Weitergabe des Lebens offen bleiben muß (vgl. HV 11, 12; FC 32). Deshalb wird jede Handlung abgelehnt, "die entweder in Voraussicht oder während des Vollzugs des ehelichen Aktes oder im Anschluß an ihn beim Ablauf seiner natürlichen Auswirkungen darauf abstellt, die Fortpflanzung zu verhindern, sei es als Ziel, sei es als Mittel zum Ziel" (KKK 2370; vgl. HV 14; FC 32).
Es geht nach diesen Aussagen um die Wahrung der Werte und Sinngehalte der personalen Ordnung. Eingriffe in diese Ordnung (zum Beispiel durch chemische oder mechanische Mittel) berauben den ehelichen Akt seiner Öffnung auf die Fortpflanzung hin und bewirken so eine gewollte Trennung der Sinngehalte des ehelichen Aktes. Dies ist, wie eigens betont wird, bei der natürlichen Empfängnisregelung nicht der Fall. Deshalb ist es erlaubt, den natürlichen Zyklus der Zeugungsfunktion zu berücksichtigen und den ehelichen Verkehr auf die empfängnisfreien Zeiten zu beschränken. Auf diese Weise werden die dargelegten sittlichen Grundsätze nicht verletzt (vgl. HV 16; FC 32).
Der Weg der "natürlichen Empfängnisregelung" stößt heute aus unterschiedlichen Gründen auf vermehrtes Interesse, aber auch auf Widerspruch.
Viele Frauen lehnen die Anwendung von künstlichen Mitteln als Eingriff ab; andere beklagen, daß mit dem Einnehmen von chemischen Präparaten die Empfängnisregelung ihnen allein aufgebürdet werde, währenddessen die Männer wenig Anteil an den Problemen der Frau nehmen; viele sehen deshalb die Beobachtung und Wahrung des Zyklusgeschehens der Frau als die eigentlich partnerschaftliche Weise der Empfängnisregelung an.
Es gibt jedoch Ehepaare, die darin für ihre Ehe keinen gangbaren Weg erkennen können. Ehegatten, die zu der festen Überzeugung kommen, daß sie in ihrer persönlichen Situation der Lehrverkündigung über die Empfängnisregelung nicht folgen können, berufen sich auf ihr verantwortungsbewußtes Gewissensurteil.
Die Deutschen Bischöfe haben in einem "Wort zur seelsorglichen Lage nach dem Erscheinen der Enzyklika ,Humanae vitae`" pastorale Hilfen zu geben versucht. Diese sogenannte "Königsteiner Erklärung" vom 30. 8. 1968 läßt keinen Zweifel an der Forderung zur Annahme der Enzyklika: "Da der Papst nach langer Prüfung der entstandenen Fragen gesprochen hat, steht jeder Katholik, selbst wenn er sich bisher eine andere Auffassung gebildet hatte, vor der Forderung, diese Lehre anzunehmen" (11). Die "Königsteiner Erklärung" widerspricht also nicht der Lehre von "Humanae vitae", noch mindert sie deren Verbindlichkeit.
Leider ist sie - gegen ihren Wortlaut - oft als Gegen-Instanz zur Enzyklika "Humanae vitae" ausgelegt und vielfach auch zur Bekämpfung der kirchlichen Lehre über die Empfängnisregelung mißbraucht worden. Nicht selten wird sie als Instrument benutzt, um sich über die Aussagen der Enzyklika "Humanae vitae" hinwegzusetzen. Durch solche Einstellungen und Haltungen kann es dazu kommen, daß in der inzwischen eingetretenen Liberalisierung des sexuellen Verhaltens der ethische Aspekt der Empfängnisregelung verdunkelt oder gar nicht mehr gesehen wird. Darum mahnt Papst Johannes Paul II.: Es "gehört zur pastoralen Führung der Kirche, daß die Eheleute vor allem die Lehre der Enzyklika ,Humanae vitae` als normativ für die Ausübung ihrer Geschlechtlichkeit klar anerkennen und sich aufrichtig darum bemühen, die für die Beobachtung dieser Norm notwendigen Voraussetzungen zu schaffen" (FC 34). Der Papst hat durch eine stärker personal orientierte Argumentation die Ausführungen von "Humanae vitae" zu vertiefen gesucht (vgl. dazu FC 32-34).
Da es keine sittliche Urteilsfindung geben kann, die sich nicht dem Anspruch der von der Kirche verkündeten Norm ernsthaft und aufrichtig stellt, mahnt die "Königsteiner Erklärung" hinsichtlich eines abweichenden Gewissensspruchs: "Wer glaubt, so denken zu müssen, muß sich gewissenhaft prüfen, ob er - frei von subjektiver Überheblichkeit und voreiliger Besserwisserei - vor Gottes Gericht seinen Standpunkt verantworten kann" (12).
Im Blick auf eine "verantwortungsbewußte Gewissensentscheidung der Gläubigen", wie immer diese ethisch genauer zu bewerten ist, heißt es dort, daß die Seelsorger in ihrem Dienst, besonders in der Verwaltung der Sakramente, ein solches Gewissensurteil achten, was nicht einfach Zustimmung, Billigung oder gar Rechtfertigung bedeutet (vgl. 11, 12 und 16). "Bei ihren Schwierigkeiten und Nöten sollten die Eheleute im Wort und im mitfühlenden Herzen des Priesters ein Echo der Stimme und der Liebe unseres Erlösers finden" (HV 29).
Je mehr christliche Eheleute sich ihrer Berufung bewußt sind, ihre Ehe als Gemeinschaft des Lebens und der Liebe zu verstehen, um so mehr werden sie auch die Fähigkeit gewinnen, ihre eheliche Begegnung in Verantwortung voreinander und vor Gott zu leben. Dazu ist eine fortgesetzte Gewissensbildung unerläßlich. Die Kirche setzt auf das stufenmäßige Wachsen und Reifen der Menschen in der Ehe (vgl. FC 34). Sie muß auch hier die Menschen in ihrem Gang durch die Zeiten und in ihrem Ringen um die sittliche Wahrheit begleiten.
3.3. Operative Sterilisation
Im Zusammenhang mit der Empfängnisregelung wird öfter die Frage gestellt, ob es nicht sittlich gerechtfertigt sein könnte, sich durch einen operativen Eingriff (Unterbindung der Samenstränge beim Mann oder der Eileiter bei der Frau) für immer unfruchtbar machen zu lassen. In einigen Ländern sind solche operativen Sterilisationen, sofern sie auf eigenen Wunsch geschehen, rechtlich erlaubt. Andere Länder gestatten sie nur bei Frauen, bei denen medizinisch feststeht, daß die Vermeidung weiterer Schwangerschaften nicht durch Empfängnisregelung zu erreichen ist.
In der Öffentlichkeit wird immer wieder die Frage erörtert, ob nicht geistig Behinderte, die zur Eingehung einer Ehe nicht fähig sind, operativ sterilisiert werden sollten und ob nicht die Eltern sogar die Pflicht hätten, einen entsprechenden Eingriff vor Eintritt der Volljährigkeit des Kindes vornehmen zu lassen.
Nach gesetzlicher Regelung gilt in Deutschland, daß weder die Eltern noch das Kind berechtigt sind, eine Sterilisation vornehmen zu lassen. Auch die Sterilisation einer volljährigen geistig Behinderten darf nicht gegen ihren Willen geschehen. Wenn sie diesen nicht zum Ausdruck bringen kann, ist eine Sterilisation mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes nur dann zulässig, wenn mit einer etwaigen Schwangerschaft eine Gefahr für das Leben der Schwangeren oder eine schwerwiegende Beeinträchtigung ihrer körperlichen oder seelischen Gesundheit zu erwarten wäre, die nicht auf andere zumutbare Weise abgewendet werden könnte (vgl. 1631c und 1905 BGB).
Für die sittliche Bewertung der operativen Sterilisation als empfängnisverhütende Maßnahme sind mehrere Elemente zu beachten. Zunächst einmal betrifft der operative Eingriff nicht nur eine Körperfunktion, sondern er hat auch große psychische und allgemeinmenschliche Bedeutung. Im Bereich des Sexuellen spielen geistige und gefühlsmäßige Momente eine große Rolle. Eine Sterilisation kann, auch wenn sie in gegenseitigem Einverständnis der Eheleute vorgenommen wird, später zu einer schweren Belastung werden. Als Weiteres kommt hinzu, daß eine Sterilisation, sofern sie niemals wieder rückgängig gemacht werden kann, jede Chance ausschließt, nach dem Tod des Ehegatten in einer eventuellen neuen Ehe noch Kinder haben zu können. Schließlich ist aus medizinisch-ärztlicher Sicht zu bedenken, daß Zeugungs- und Empfängnisfähigkeit nicht als Krankheit eingestuft werden können. Deshalb ist es vom ärztlichen Ethos her nicht gestattet, einen Eingriff vorzunehmen, für den keine schwerwiegenden medizinischen Gründe zu erkennen sind. Operative Sterilisation ist somit aus der Sicht des ärztlichen Ethos nicht eine bloße Dienstleistung, die der Arzt auf Wunsch nach Vorbeugung gegen die Möglichkeit einer künftigen Zeugung oder Empfängnis bedenkenlos vornehmen kann, sondern sie bedarf einer schwerwiegenden medizinischen Begründung, um ethisch gerechtfertigt zu sein. Die subjektive Absicht des Arztes wie des ihn um die Sterilisation angehenden Patienten reicht für die ethische Begründung zur Vornahme einer Sterilisation ebensowenig aus wie der Wunsch nach Heilung oder Vorbeugung eines physischen oder psychischen Leidens, dessen Eintreten aufgrund einer Schwangerschaft vorauszusehen oder zu fürchten ist (vgl. dazu die Lehraussagen der Kirche: DS 3760-3765; 3788; Papst Pius XII.: AAS XLIII, 1951, 843f; AAS L, 1958, 734-737; Brief der Kongregation für die Glaubenslehre an die Nordamerikanische Bischofskonferenz vom 13. 3. 1975: AAS LX VIII, 1976, 738f). Diese ethisch begründeten Richtlinien treffen auch für geistig Behinderte zu. Ihr Umgang mit der Sexualität wird nicht dadurch verändert, daß man die möglichen Folgen verhindert, sondern dadurch, daß sie eine angemessene Betreuung durch geeignete Helfer erhalten.
Besonders verwerflich sind staatliche Regelungen, die aus bevölkerungspolitischen Gründen Zwangssterilisierungen anordnen. Hier liegt ein schwerer Eingriff in Persönlichkeitsrechte vor.
3.4. Künstliche Befruchtung
Viele Ehepaare bleiben ungewollt kinderlos (10-15%) und empfinden diese Kinderlosigkeit als schweres Leid. Sie möchten Nachkommen haben, mit denen und für die sie leben und arbeiten können.
Manche Eheleute, die kein Kind haben können, sind bereit, ihre Kinderlosigkeit anzunehmen und sich anderen Aufgaben im Bereich kirchlicher oder sozialer Tätigkeit zu widmen. Andere möchten anstelle eines eigenen Kindes, das ihnen versagt ist, ein fremdes Kind annehmen. Eine Adoption ist ein Bekenntnis zum Leben. Für die Kinder, die von Adoptiveltern angenommen werden, ist das Leben in der Familie eine große Chance.
Der Wunsch nach einem eigenen Kind kann aber auch so intensiv sein, daß Ehegatten bereit sind, alle vertretbaren medizinischen Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen, um doch noch zu einem Kind zu kommen. Mit zunehmendem Erfolg versucht die moderne Medizin, solchen Eheleuten die Erfüllung ihres Kinderwunsches zu ermöglichen.
Seit längerer Zeit ist die künstliche Übertragung des Samens (artifizielle Insemination) bekannt. Das Verfahren, bei dem der Same des Ehemannes übertragen wird, bezeichnet man als homologe Insemination. Bei außerehelicher Übertragung des Samens spricht man von heterologer Insemination.
Davon ist die künstliche Befruchtung außerhalb des Mutterleibes mit anschließender Übertragung des Embryos in die Gebärmutter zu unterscheiden. In der Fachsprache bezeichnet man sie als "Fertilisatio in vitro mit Embryo-Transfer", abgekürzt: FIVET. Auch dieses Verfahren kann ehelich (homolog) und außerehelich (heterolog) angewendet werden.
Seit der Zeit, da eine extrakorporale Befruchtung mit anschließender Übertragung des Embryos erstmals gelungen ist, wird immer wieder die Frage gestellt, ob dieser Weg, ein Kind zur Welt zu bringen, sittlich zu verantworten ist. In eine Antwort auf diese Frage sind die Motive, die Methode selbst und die möglichen Folgewirkungen einzubeziehen.
Die Motive für den Kinderwunsch können unterschiedlich sein. Manche wünschen sich ein Kind, weil sie darin die Erfüllung ihrer Ehe sehen; andere meinen, ein Kind könne dazu beitragen, Schwierigkeiten in der Ehe zu überwinden; andere betonen, daß durch ein Kind der Leidensdruck der Frau oder der Eheleute behoben werden könne; die Adoption eines fremden Kindes könne diesen Leidensdruck nicht beseitigen.
Vom sittlichen Standpunkt her ist bezüglich der Motive zu bedenken, daß nicht jedes Motiv ohne weiteres und in jedem Fall sittlich vertretbar ist. Das Motiv, daß ein Kind die Ehe retten oder die Ehegatten von Leidensdruck befreien könne, würde das Kind lediglich zum Mittel machen. Sittlich berechtigt ist ein Kinderwunsch, wenn er vom Motiv der Erfüllung der Ehe in einem Kind und von der Liebe zum Kind selbst getragen ist.
Bezüglich der Methode der extrakorporalen Befruchtung mit anschließender Embryonenübertragung wird in der Diskussion immer wieder das Argument eingebracht, es gehe bei diesem Verfahren um die Behandlung einer Krankheit im weiteren Sinn, etwa bei Sterilität der Frau. Durch das Verfahren werde zwar nicht der Defekt der Sterilität behoben, aber er werde technisch umgangen, um auf diese Weise die an sich bestehende Fruchtbarkeit zur Erfüllung kommen zu lassen. Könnte es bei einem berechtigten Kinderwunsch sittlich erlaubt sein, dieses Verfahren in Anspruch zu nehmen, wenn alle anderen Wege zur Erfüllung des Kinderwunsches aussichtslos sind? Und könnte man nicht sagen, daß in einer Ehe, in welcher der Kinderwunsch nur auf diese Weise zu erfüllen ist, die Verbindung von ehelicher Liebe und Fortpflanzung in einem umfassenden Sinn gewahrt sei, zumal hier die liebende Hingabe der Ehegatten ganzheitlich in die Weitergabe des Lebens einfließe?
Die Kongregation für die Glaubenslehre hat sich in der "Instruktion über die Achtung vor dem beginnenden menschlichen Leben und die Würde der Fortpflanzung" vom 22. 2. 1987 zur Methode der FIVET ablehnend geäußert. Sie betont, daß der würdige Ort für die Zeugung neuen menschlichen Lebens der eheliche Akt sei. Jede Art von Fortpflanzung, die nicht die Frucht der ehelichen Vereinigung ist, sei sittlich nicht zu vertreten. Eine außerhalb des Leibes der Frau erlangte Befruchtung bleibt der Sinngehalte und der Werte beraubt, die sich in der Sprache des Leibes und der Vereinigung der menschlichen Personen ausdrücken. "Das Verfahren der FIVET muß in sich selbst bewertet werden; es kann seine endgültige moralische Bewertung weder aus dem ehelichen Leben in seiner Gesamtheit herleiten, in das es sich einfügt, noch von den ehelichen Akten, die ihm vorangehen, noch von denen, die ihm folgen mögen" (B 5). Da auch die künstliche Übertragung des Samens die Trennung der auf die menschliche Befruchtung ausgerichteten Handlung vom ehelichen Akt einschließt, ist auch sie "in sich unerlaubt und steht in Widerspruch zur Würde der Fortpflanzung und der ehelichen Vereinigung" . . . (ebd.).
Trotz der Zurückweisung der extrakorporalen Befruchtung und der künstlichen Insemination betont die Kongregation für die Glaubenslehre, das moralische Gewissen verwerfe nicht notwendigerweise die Anwendung gewisser künstlicher Hilfsmittel, die einzig dazu dienen, "den ehelichen Akt zu unterstützen, indem der Arzt seinen Vollzug erleichtert oder ihm sein Ziel zu erreichen hilft, sobald er in normaler Weise vollzogen ist" (B 7).
In die sittliche Bewertung der Methoden sind auch ihre unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten einzubeziehen. Die homologe künstliche Insemination und Befruchtung ist zwar moralisch unannehmbar, aber sie ist "weniger verwerflich" als die heterologe. Letztere löst durch Einschalten einer dritten Person (Ei- oder Samenspende, Leihmutterschaft) die Gemeinsamkeit der Elternschaft auf und verletzt sowohl das Recht des Kindes als auch das Recht der Ehegatten. Ihre Anwendung ist deshalb besonders verwerflich (vgl. KKK 2376f).
Auch bei der Bewertung der tatsächlichen oder möglichen Folgewirkungen der einzelnen Methoden sind Unterschiede zu beachten. Bei der extrakorporalen Befruchtung mit anschließendem Embryonentransfer wurden bisher mehrere Embryonen übertragen. Um beim möglichen Mißlingen des Versuchs noch weitere Versuche vornehmen zu können, wurden bislang Embryonen tiefgefroren konserviert. Wenn sie nicht gebraucht wurden, ließ man sie als überzählige Embryonen zugrunde gehen. Das ist aber heute nicht mehr nötig, denn es können auch einzelne weibliche Eier funktionstüchtig bis zur Befruchtung und Übertragung aufbewahrt werden. Das Problem überzähliger Embryonen muß somit aufgrund der neueren medizinischen Möglichkeiten nicht mehr entstehen.
Schwerwiegender sind die möglichen Folgen allerdings beim mißbräuchlichen Umgang mit der Fortpflanzungsmedizin: Bereitstellung von Samenbanken, Ersatz- bzw. Mietmutterschaft, Experimente mit Embryonen, verbrauchende Forschung an Embryonen. Hier sind in besonderer Weise Warnungen angebracht.
Faßt man alle diese Elemente zusammen und bezieht darüber hinaus auch die bisher niedrige Erfolgsrate, die oftmals langdauernde und mit psychischen und körperlichen Risiken verbundene Behandlung in die ethische Bewertung ein, dann wird einsichtig, daß die Kirche aus gewichtigen Gründen schwerwiegende Bedenken gegen das Verfahren der extrakorporalen Befruchtung hat und mit großer Dringlichkeit davon abrät, eine extrakorporale Befruchtung vornehmen zu lassen (vgl.: Gott ist ein Freund des Lebens, 63).
Es ist Aufgabe des Staates, für die Fortpflanzungsmedizin rechtliche Regeln aufzustellen. Dabei hat der Gesetzgeber solche Verfahren zu untersagen, durch die menschliche Wesen künstlich ins Leben gerufen, unzulässigen Risiken ausgesetzt, als Versuchsobjekte behandelt und von sogenannten "Leihmüttern" ausgetragen werden.
- "Das staatliche Gesetz darf seinen Schutz nicht denjenigen Techniken künstlicher Fortpflanzung gewähren, die zum Vorteil dritter Personen (Ärzte, Biologen, Wirtschaftskreise oder Regierungsmächte) das an sich ziehen, was ein den Beziehungen der Eheleute innewohnendes Recht ausmacht; ferner darf es nicht die Spendung von Keimzellen zwischen Personen, die nicht legitim verheiratet sind, gesetzlich zulassen" (Instruktion der Kongregation für die Glaubenslehre über die Achtung vor dem beginnenden menschlichen Leben und die Würde der Fortpflanzung, III).
Nach dem seit dem 1. Januar 1991 geltenden Embryonenschutzgesetz der Bundesrepublik Deutschland wird die mißbräuchliche Anwendung der Fortpflanzungsmedizin, darunter auch die Ersatzmutterschaft, sowie die mißbräuchliche Verwendung menschlicher Embryonen zum Beispiel zu Forschungszwecken und eine Reihe anderer kirchlich mißbilligter Verfahren zur Manipulation von Embryonen (zum Beispiel Klonen sowie Chimären- und Hybridenbildung) unter Strafandrohung verboten.
Niemals darf freilich ein Kind, das mit Hilfe unerlaubter Methoden das Licht der Welt erblickt hat, diskriminiert werden. Jedes Kind, das zur Welt kommt, ist Geschenk der göttlichen Güte; es muß als solches angenommen und mit Liebe aufgezogen werden.
4. Fragen der vor- und außerehelichen Sexualität
4.1. Personale Entfaltung der eigenen Sexualität
Die Aufgabe, die eigene Geschlechtlichkeit sinnvoll in die Entfaltung der Person einzuordnen, ist ein lebenslanger Prozeß, der den Gesetzen des Wachstums folgt, denn der Mensch ist "ein geschichtliches Wesen, das sich Tag für Tag durch seine zahlreichen freien Entscheidungen selbst formt; deswegen kennt, liebt und vollbringt er das sittlich Gute auch in einem stufenweisen Wachsen" (KKK 2343; FC 34). Dieser Prozeß ist mit Anstrengungen und Schwierigkeiten verbunden. Dabei kann es auch zu Formen sexuellen Verhaltens kommen, die dem vollen Sinn menschlicher Geschlechtlichkeit nicht entsprechen. Eine dieser Formen ist die Masturbation.
Die Bezeichnung "Onanie" trifft für dieses Phänomen nicht zu, weil die Sünde des Onan (Gen 38,8ff) darin bestand, daß er der Verpflichtung des damaligen Rechtes, anstelle seines verstorbenen Bruders mit der Schwägerin Nachkommen zu erzeugen, entgehen wollte.
In der Vergangenheit kam es bezüglich der Masturbation zu Fehleinschätzungen. Man nahm an, daß die männliche Samenzelle bereits vollständiges menschliches Leben enthalte, und sah infolgedessen in der Masturbation eine Art frühe Tötung menschlichen Lebens. Auch schrieb man der Masturbation die Entstehung gesundheitlicher Schäden zu. Diese Argumente können heute nicht mehr aufrechterhalten werden.
Gelegentlich ist die sexuelle Selbsterregung schon in der frühen Kindheit zu beobachten. Sie hat nichts mit sexueller Fehlhaltung zu tun und darf deshalb auch nicht von Eltern und Erziehern mit Drohungen und Strafen belegt werden.
In der Pubertät und im Jugendalter durchlaufen viele Jungen und Mädchen eine Phase, in der es öfter zur Masturbation kommt. Hierbei können ganz unterschiedliche Ursachen und Anlässe eine Rolle spielen. Manchmal geben Jugendliche dem sexuellen Drang, den sie in dieser Zeit besonders stark erfahren, einfach nach. Ein anderes Mal kann Neugier dazu führen, daß einer seine aufbrechende Geschlechtskraft erfahren möchte. Auch Einsamkeit, Versagen in der Schule oder im Beruf, Überreizung durch die sexualisierte Umwelt und der Wunsch nach sexueller Erfüllung, der in den Jahren des Reifens stärker wird, sind Anlaß zur Masturbation.
Diese Situationen zeigen an, daß hier die rechte Einordnung der Sexualität in die Person noch nicht voll gelungen ist. Die Masturbation kann Ausdruck von Unreife, aber auch von falscher Ichbezogenheit sein. Wo sie bewußt angestrebt und an ihr festgehalten wird, ist sie ein sittliches Fehlverhalten. "Der Jugendliche, der damit zu ringen hat, muß erkennen, daß er über dieses Stadium hinauswachsen muß, wenn seine Sexualität nicht infantil bleiben soll" (Die Deutschen Bischöfe, Zu Fragen der menschlichen Geschlechtlichkeit, 11).
Bei Erwachsenen kann es zur Masturbation kommen, wo äußere Umstände (Krankheit, Einsamkeit, Fernsein vom Partner) sexuelle Beziehungen nicht zulassen. Auch hier kann die Masturbation Ausdruck der Selbstbezogenheit sein. Als Selbstbefriedigung entspricht sie nicht der Zielsetzung einer reifen Geschlechtlichkeit.
Ob und in welchem Maße bei der Masturbation Schuld vorliegt, hängt somit auch davon ab, wieweit jeweils Einsicht und Freiheit mitspielen. Entscheidend ist, ob der Wille zu verantworteter Formung und Ausrichtung der Geschlechtlichkeit besteht oder ob schuldhafte Ichbezogenheit vorliegt.
4.2. Umgang der Geschlechter miteinander vor der Ehe
Lange bevor junge Menschen an eine Ehe denken, begegnen sie einander als Jungen und Mädchen in vielfachen Weisen des Miteinanderseins: in Schule und Beruf, bei Spiel und Tanz, in Urlaub und Freizeit. Sie gehen zusammen aus, verlieben sich, werden Freund und Freundin, tauschen Zärtlichkeiten aus und kommen einander immer näher oder gehen auch wieder auseinander.
In all diesen Weisen der Begegnung der Geschlechter spielen sexuelle Anziehung und Spannung eine große Rolle. Im Rahmen vielfacher Formen von Zärtlichkeit und Intimität kann es in diesen Beziehungen auch zum Geschlechtsverkehr kommen.
In der heutigen Gesellschaft wird vorehelicher Verkehr in zunehmendem Maße geduldet oder gar für richtig angesehen.
Im Einklang mit der christlichen Tradition lehrt die katholische Kirche, daß die volle geschlechtliche Gemeinschaft ihren Ort in der Ehe hat. Diese sittliche Orientierung geht davon aus, daß die Beziehung zwischen den Geschlechtern nur glücken kann, wenn sie wahrhaftig ist. Zur Wahrhaftigkeit der Begegnung zwischen jungen Menschen gehört, daß sie nicht eine Verbundenheit vortäuscht, zu der die beiden nicht stehen können oder wollen.
- "Die leibliche Ganzhingabe wäre eine Lüge, wenn sie nicht Zeichen und Frucht personaler Ganzhingabe wäre, welche die ganze Person, auch in ihrer zeitlichen Dimension, miteinschließt. Wenn die Person sich etwas vorbehielte, zum Beispiel die Möglichkeit, in Zukunft anders zu entscheiden, so wäre schon dadurch ihre Hingabe nicht umfassend" (FC 11).
In der Zeit vor der Ehe sollen junge Menschen sich prüfen, ob sie in ihren Anschauungen und Interessen zueinander passen, und sich darüber klar werden, ob sie miteinander den Schritt in die Ehe wagen wollen. Jeder der beiden muß sich auch wieder zurückziehen können, wenn er feststellt, daß die Voraussetzungen für eine gute Ehe nicht gegeben sind. Deshalb darf die Bindung vor der Ehe nicht eine Verbundenheit vortäuschen, die gar nicht besteht.
Vielfach wird die Auffassung vertreten, man müsse schon vor der Ehe erproben, ob man sexuell zueinander passe. - Diese Auffassung verkennt, daß die Ehe selbst und das Gelingen der Sexualität in der Ehe ein Prozeß ist, in dem es Höhen und Tiefen, Freude und Enttäuschung, Gelingen und Mißlingen, Sünde und Schuld gibt. Das Erproben der Sexualität gibt keinerlei Gewißheit und Sicherheit, daß die spätere Ehe gelingt. Deshalb ist es für junge Menschen, die einander lieben, wichtig, daß sie die Entscheidung, ab wann eine volle Geschlechtsbeziehung zu verantworten ist, nicht nach subjektivem Ermessen treffen. Die frühzeitige Aufnahme voller geschlechtlicher Beziehungen kann dazu führen, daß die beiden sich über ihre wirkliche Beziehung täuschen; ihre Enttäuschung wird dann in der Ehe um so größer sein. Wer den anderen "erproben" will, ob er seinen sexuellen Vorstellungen entspricht, macht den anderen zum Mittel; wenn dieser die "Probe" nicht besteht, fühlt er sich mißbraucht, er wird zutiefst verwundet und bleibt enttäuscht zurück.
Es geht im Umgang Liebender miteinander nicht darum, daß vor der Ehe nichts und in der Ehe alles erlaubt ist, sondern es geht darum, daß Liebende den Weg zur Ehe als einen menschlich, charakterlich, sittlich und religiös höchst wichtigen Prozeß verstehen und leben, der viele Weisen der Begegnung umfaßt. Dazu führt die Gemeinsame Synode aus:
- "Im Vorraum der vollen sexuellen Gemeinschaft gibt es ein breites Spektrum sexueller, das heißt aus der geschlechtlichen Bestimmtheit des ganzen Menschen erwachsender Beziehungen unterschiedlicher Intensität und Ausdrucksformen, auch eine Stufenleiter der Zärtlichkeit. Diese Beziehungen können als gut und richtig gelten, solange sie Ausdruck der Vorläufigkeit sind und nicht intensiver gestaltet werden, als es dem Grad der zwischen den Partnern bestehenden personalen Bindung und der daraus resultierenden Vertrautheit entspricht. Volle geschlechtliche Beziehungen freilich haben ihren Ort in der Ehe. Auch Praktiken, bei denen im gegenseitigen Einvernehmen der Orgasmus gesucht, aber nur der letzte leibliche Kontakt nicht vollzogen wird, gehören nicht in den vorehelichen Raum. Notwendige Grenzen können nur in ernstem Bemühen um Selbstbeherrschung und in Ehrfurcht vor dem Partner eingehalten werden" (EF 3.1.3.3).
Voreheliche Intimbeziehungen führen manchmal zu ungewollten Schwangerschaften. Oft wird dann der Ausweg in einer Abtreibung gesucht, oder der Vater des Kindes nimmt die Schwangerschaft seiner Freundin zum Anlaß, sie zu verlassen. Wenn es um des Kindes willen zu einer Heirat kommt, die nicht in voller Freiwilligkeit eingegangen wird, ist eine solche Ehe von Anfang an belastet, und es kommt vor, daß sie später scheitert. Wird ein ungewollt gezeugtes Kind von der Mutter äußerlich angenommen, innerlich aber abgelehnt, kann das Kind für sein ganzes Leben lang mit einer schweren Hypothek belastet sein. Wo es zu einer vor- oder außerehelichen Schwangerschaft kommt, sind beide Eltern verpflichtet, das neue Leben anzunehmen und zu schützen. Wenn sich der Vater seiner Verantwortung entzieht und die werdende Muter trotzdem zu ihrem Kind steht und es zur Welt bringt, verdient sie um so mehr Achtung und Unterstützung. Als alleinerziehende Mutter braucht sie besondere Zuwendung und Hilfe. Auch das unehelich geborene Kind ist von anderen in Achtung und Liebe anzunehmen.
4.3. Nichteheliche Lebensgemeinschaften
Nichteheliche Lebensgemeinschaften treten heute in unterschiedlichen Formen auf. Manche Partner leben für eine gewisse Zeit zusammen, ohne an eine dauernde Bindung in einer späteren Ehe zu denken. Andere leben zusammen, möchten später eine Ehe eingehen, können sich aber im Augenblick nicht mit dem jetzigen Partner zu einer Ehe entschließen oder möchten aus praktischen Gründen eine Ehe hinausschieben. Wieder andere verstehen ihre nichteheliche Lebensgemeinschaft grundsätzlich als Alternative zur "bürgerlichen" Ehe. Sie lehnen die Institution Ehe ab.
Bei den einzelnen Formen von nichtehelichen Gemeinschaften spielen unterschiedliche Motive eine Rolle. Die einen haben Angst vor einer endgültigen Bindung. Bei anderen mindern die zahlreichen Ehescheidungen, die sie in der eigenen Familie und in der Umwelt erleben, ihr Vertrauen in die Ehe. Bei wieder anderen spielt die Auffassung mit, zu einem gemeinsamen Leben sei kein Trauschein nötig. In der Ehe seien Partner in eine Institution eingebunden, in der die Aufmerksamkeit füreinander nachlasse; in der nichtehelichen Lebensgemeinschaft dagegen müßten sich die Partner die gegenseitige Zuwendung immer wieder neu erringen. - Die verschiedenen Motive werden dadurch bestärkt, daß nichteheliche Lebensgemeinschaften immer öfter vorkommen und auch von der Gesellschaft akzeptiert werden.
Objektiv fehlen diesen Lebensgemeinschaften in unterschiedlicher Weise drei Elemente: die Entschlossenheit und Kraft einer klaren Entscheidung; das öffentliche Bekenntnis, für immer in Treue miteinander verbunden sein zu wollen; der Schutz der Rechtsgemeinschaft, der für die Ehegemeinschaft und für die Gesellschaft unerläßlich ist. Auch liegt ein Widerspruch darin, daß die Partner wie in einer Ehe leben, aber nicht bereit sind, eine Ehe einzugehen und in ihr zum anderen zu stehen, was immer die Zukunft bringen mag. Hinzu kommt, daß sich eine Person mißbraucht fühlen muß, wenn man mit ihr die Gemeinschaft nur so lange aufrechterhalten will, wie man es für gut hält. Ferner ist zu bedenken, daß durch das Zusammenleben Verpflichtungen entstehen, denen man sich nicht entziehen kann, ohne dem Partner schweres Unrecht oder großes Leid zuzufügen. Deshalb kommt es auch häufig dazu, daß Partner, die längere Zeit zusammenleben, eine Ehe eingehen, weil sie spüren, daß sie den anderen nicht mehr verlassen können, obwohl manches gegen eine Ehe spricht.
Die Kirche kann an den moralischen und pastoralen Problemen, die sich aus der wachsenden Zahl nichtehelicher Gemeinschaften ergeben, nicht vorbeisehen. Christen, die in nichtehelichen Gemeinschaften leben und die Ehe grundsätzlich ablehnen, mißachten die religiöse Bedeutung der Ehe und verweigern ihrer Gemeinschaft das Geschenk der sakramentalen Gnade, das der Ehe zugesagt ist.
Bei anderen Lebensgemeinschaften, die die Ehe für gut und richtig halten, aber dem Ideal der christlichen Ehe nicht entsprechen, gibt es ein echtes Bemühen um ein partnerschaftliches Leben mit dem Menschen, den sie lieben und dem sie vertrauen. Dadurch unterscheiden sie sich erheblich von unpersönlichen und bindungslosen Sexualbeziehungen. Die Kirche kann solche Gemeinschaften nicht billigen, aber sie will mit Menschen, die in nichtehelichen Gemeinschaften leben, im Gespräch bleiben oder Verbindung mit ihnen halten. Das gilt für solche nichtehelichen Gemeinschaften, in denen die Partner bewußt die personalen Werte der Liebe und Treue verwirklichen und die Wertorientierung der Kirche grundsätzlich übernehmen, aber in der Frage der Normorientierung persönlich zu der Überzeugung gekommen sind, daß die von der Kirche verkündeten Normen sexuellen Verhaltens zum gegenwärtigen Zeitpunkt für sie weder begründet noch akzeptabel erscheinen. Das verständnisvolle Gespräch kann hier manchmal zu einer Änderung der Überzeugung führen; vielfach ist das jedoch nicht der Fall. Jede Beratung muß darauf gerichtet sein, daß die Partner nicht durch harte Urteile aus dem Lebensraum der Kirche ausgestoßen werden, sondern im Rahmen des Möglichen zum Mitleben mit der Kirche ermutigt werden. Dabei kann auch das Lebenszeugnis anderer eine Hilfe sein, daß Christen ihre Entscheidungen in Übereinstimmung mit dem Glauben der Kirche treffen.
Christliche Eltern stehen in der Erziehung ihrer Kinder angesichts der Umwälzungen in Denken und Verhalten der Gesellschaft vor schwierigen Situationen. Sie können nicht die Augen davor verschließen, in welcher Weise ihre heranwachsenden Kinder Beziehungen zum anderen Geschlecht aufnehmen. Sie erleben in ihrem Umkreis, daß Eltern ihren Kindern bedenkenlos ie vorzeitige Aufnahme geschlechtlicher Beziehungen zugestehen und ein Zusammenleben lange Zeit vor der Ehe erlauben. Andere trauen sich wegen ihres eigenen Versagens vor oder in der Ehe nicht, ihren Kindern Orientierungshilfe zu geben. Wieder andere leiden darunter, daß ihre Kinder in nichtehelicher Gemeinschaft leben, vermeiden aber klärende Gespräche, um möglichen Konflikten aus dem Wege zu gehen: Sie haben Angst, ihre Kinder zu verlieren. Noch andere schließlich sind so streng, daß sie ihren Kindern, sofern sie in einer nichtehelichen Gemeinschaft leben, das Haus verbieten und jegliche Verbindung mit ihnen abbrechen. Solche Zerwürfnisse bringen für Eltern und Kinder großes Leid mit sich.
Eltern müssen darum bemüht sein, bei ihren Kindern Achtung im Umgang mit dem anderen Geschlecht zu wecken und zur Wahrhaftigkeit in der Liebe zu erziehen. Mehr als durch Worte kann das durch das christliche Leben der Eltern selbst geschehen. Sie sollten aber niemals das Gespräch mit den Kindern abreißen lassen. Wie sehr die Kinder auch Wege gehen, die dem sittlichen Empfinden der Eltern, der rechten Ordnung des Geschlechtlichen und der Ehe widersprechen, so soll doch immer die Möglichkeit offengehalten werden, daß die Kinder bei den Eltern ein Zuhause haben können.
Seelsorger und kirchliche Gruppen werden darum bemüht sein, diskret und taktvoll mit Menschen, die in nichtehelichen Gemeinschaften leben, Kontakt aufzunehmen, die konkreten Ursachen des Zusammenlebens kennenzulernen und nach Möglichkeit darauf hinzuwirken, daß sie ihre Situation ordnen (vgl. FC 79). In der religiös-sittlichen Erziehung und Führung der Jugendlichen soll jener Sinn für Treue vermittelt werden, ohne den es keine wahre Freiheit gibt. Verständnisvolle Begleitung soll die Jugendlichen in ihrem Reifungsprozeß fördern und ihnen die Wirklichkeit des Ehesakramentes erschließen.
Die Christen sind auch dazu aufgerufen, die Träger der öffentlichen Ordnung auf ihre Verantwortung für die Institution von Ehe und Familie aufmerksam zu machen und ihr christliches Verständnis von Ehe und Familie in die Gesellschaft einzubringen, um so eine ehefreundliche Gesetzgebung zu fördern.
4.4. Gleichgeschlechtliche Beziehungen
Homosexualität ist heute in zunehmendem Maß ein Thema geworden, das in der Öffentlichkeit heftig umstritten ist. Oft werden nur noch die Verführung von Kindern und Jugendlichen und homosexuelle Beziehungen mit erpresserischer Absicht unter Strafe gestellt.
Die rechtliche Regelung ist aber nicht zu verwechseln mit der sittlichen Bewertung homosexueller Handlungen. Homosexualität ist ein vielschichtiges Phänomen. Wie sehr selbst in der modernen Psychologie und Medizin die Erforschung und Beschreibung der Homosexualität umstritten ist, zeigen Versuche, das Phänomen der Homosexualität in verschiedene Formen aufzugliedern oder es in seinen Ursachen und Entwicklungen beziehungsweise in den Graden seiner Ausprägung zu beschreiben.
Eine erste Auffassung geht von den Erscheinungsformen der Homosexualität aus. Sie spricht von entwicklungsbedingter Homosexualität, wenn homosexuelle Handlungen in der Pubertät vorkommen. Hier handelt es sich zumeist um vorübergehende Reaktionen, die später von heterosexuellen Verhaltensweisen abgelöst werden, sofern darin nicht eine homosexuelle Prägung zum Vorschein kommt. Als situationsbedingte oder Pseudohomosexualität bezeichnet man homosexuelle Kontakte, die in Gefangenschaft, Haft oder sonstiger Isolation als "Notlösung" vorgenommen werden. Diese verliert sich wieder, sobald der Kontakt mit dem andersgeschlechtlichen Partner wieder möglich ist. Eine andere Form ist das homosexuelle Verhalten bei Bisexualität. Hier werden sexuelle Beziehungen zu gleichgeschlechtlichen wie zu andersgeschlechtlichen Partnern aufgenommen. Als letzte Form schließlich spricht man von ausschließlicher, echter oder Neigungshomosexualität. Bei ihr fühlt sich der Homosexuelle sein ganzes Leben lang ausschließlich vom gleichen Geschlecht angezogen.
Eine zweite Auffassung geht vom Entwicklungsprozeß des bereits homosexuell geprägten Menschen aus. Sie sieht in der homosexuellen Neigung eine unwiderrufliche - genetisch bzw. psychisch bedingte - Prägung der Sexualstruktur. Diese kommt allerdings erst in vielen Abstufungen und Übergängen voll zum Vorschein. In der Anfangsphase entdeckt der homosexuell Geprägte in einem schmerzlichen Prozeß sein Anderssein. Ihr folgt die Phase des Bedürfnisses nach Befriedigung mit gleichgeschlechtlichen Menschen. Daran schließt sich die Phase der wechselseitigen körperlichen Kontaktaufnahme an. In der letzten Phase schließlich gibt es volle homosexuelle Begegnungen bis zum Zusammenleben homosexueller Partner in einer länger dauernden Gemeinschaft. Diese dauert nach dem Stand der heutigen Forschung in nur wenigen Fällen mehrere Jahre an.
Die unterschiedlichen Auffassungen über Formen und Entwicklungsstufen der Homosexualität lassen erkennen, daß zwischen homosexueller Prägung und homosexuellen Handlungen zu unterscheiden ist. Die Prägung oder Neigung wird von Homosexuellen selbst erst im Rahmen unterschiedlich verlaufender Entwicklungsphasen als bleibende Neigung zu gleichgeschlechtlichen Menschen erkannt. Homosexuell Veranlagte haben diese Veranlagung nicht selbst gewählt (vgl. KKK 2358). In der wissenschaftlichen Forschung, die mit dem Phänomen der Homosexualität befaßt ist, besteht weiterhin die Auffassung, daß der homosexuell Veranlagte bzw. Geprägte seine homosexuelle Neigung nicht ändern kann. Andererseits machen anerkannte wissenschaftliche Autoren darauf aufmerksam, daß bestimmte Therapien unter günstigen Voraussetzungen auf Dauer eine Änderung der homosexuellen Neigung bewirken können. Was immer in wissenschaftlicher Hinsicht von der homosexuellen Prägung oder Neigung zu sagen ist, so ist doch in ethischer Hinsicht klar, daß der Homosexuelle für seine homosexuellen Handlungen nicht weniger verantwortlich ist wie der Heterosexuelle für seine heterosexuellen Handlungen. Das ist nicht nur unter grundsätzlichen ethischen Erwägungen von Bedeutung, sondern auch im Hinblick auf die Gefährdung der Gesundheit durch eine mögliche Übertragung von Immunschwäche-Viren, die bei homosexuellen wie heterosexuellen Handlungen möglich ist.
Homosexualität bringt im Vergleich zur Heterosexualität Beeinträchtigungen mit sich. Bereits die Anatomie der menschlichen Geschlechtlichkeit weist auf die Zweigeschlechtlichkeit hin. Homosexuelle Handlungen schließen eine volle geschlechtliche Polarität wie auch die Zeugung von Nachkommenschaft grundsätzlich aus. Der gleichgeschlechtlichen Beziehung haftet somit Unfruchtbarkeit an. Unter dieser Rücksicht empfindet auch der Homosexuelle seine Prägung als Anderssein, selbst wenn er sich allmählich mit seiner Vorgegebenheit abfindet.
Von der Schöpfungsordnung und vom Schöpfungsauftrag Gottes an Mann und Frau her kann Homosexualität nicht als eine der Heterosexualität gleichwertige sexuelle Prägung angesehen werden. Der eigentliche Raum der vollen Geschlechtsgemeinschaft ist nach dem Verständnis der Bibel die Ehe zwischen Mann und Frau, und die Keimzelle der menschlichen Gesellschaft ist die Ehe.
In biblischer Zeit wurde Homosexualität streng verurteilt. Man war sich im Alten wie im Neuen Testament darüber klar, daß homosexuelle Praktiken nicht dem eigentlichen Sinn menschlicher Geschlechtlichkeit entsprechen können. In Israel wurden Menschen, die homosexuelle Handlungen - aus welchen Gründen auch immer - vollzogen, nach geltendem Recht sogar aus dem Volk ausgestoßen (vgl. Lev 18,22; 20,13). Im Neuen Testament versteht der Apostel Paulus homosexuelles Verhalten als widernatürlichen Verkehr (vgl. Röm 1,25-27; 1 Tim 1,10), vor dem er in gleicher Weise warnt wie vor anderen sexuellen Fehlhaltungen.
Unzureichende Kenntnis über die Ursachen der Homosexualität haben in der Vergangenheit zur Verfolgung und Verurteilung homosexueller Menschen geführt. Auf der Grundlage heutiger Einsicht über die Entstehung der homosexuellen Verfaßtheit verbietet sich jede Diffamierung homosexuell veranlagter Menschen. In sittlicher Hinsicht ist es für homosexuell veranlagte Menschen wichtig, daß sie sich bemühen, sich nicht von ihrer Sexualität beherrschen zu lassen, sondern sie bewußt humanen Wertvorstellungen und Zielsetzungen einzuordnen. Dabei müssen sie vor allem andere in ihrer Personwürde achten und dürfen sie nicht als Mittel zur eigenen Triebbefriedigung mißbrauchen. Sie müssen vermeiden, durch ihr Verhalten Anstoß zu erregen und andere zu verführen. Sie "sind berufen, in ihrem Leben den Willen Gottes zu erfüllen und, wenn sie Christen sind, die Schwierigkeiten, die ihnen aus ihrer Veranlagung erwachsen können, mit dem Kreuzesopfer des Herrn zu vereinen" (KKK 2358).
In der Gesellschaft ist es allen Menschen aufgegeben, homosexuell veranlagten Menschen Verständnis entgegenzubringen. Diffamierung und Herabsetzung treibt sie in eine unerträgliche Situation und erschwert ihnen die Kommunikation. Die Christen sind aufgerufen, homosexuellen Menschen pastorale Hilfe anzubieten. Eine kirchliche Anerkennung als Institution können gleichgeschlechtliche Partner nicht erlangen.
4.5. Darbietung und Darstellung der Sexualität
Zu den ältesten Fehlformen sexuellen Verhaltens gehören die Darbietung des eigenen Leibes in der Prostitution sowie die Darstellung unzüchtigen Verhaltens in den verschiedenen Formen der Pornographie.
Prostitution ist eine sexuelle Dienstleistung gegen Entgelt. In ihr wird der Leib angeboten, ohne daß dabei Liebe geschenkt oder eine tiefere menschliche Beziehung gesucht wird. Die Prostituierte verkauft nicht sich selbst und ihre Liebe, sondern ihren Leib, der zur Ware wird. Sie stellt ihren Leib für eine bloße Funktion zur Verfügung. Anlaß zur Prostitution können Armut, entwürdigende Abhängigkeit oder fehlende Geborgenheit sein. In der Prostitution setzt die Prostituierte ihre eigene Würde herab und erniedrigt zugleich den Sexualpartner, der nur die Funktion und nicht die Person, nur die Triebbefriedigung und nicht die personale Gemeinschaft sucht. Dadurch wird er in seiner Triebbestimmtheit bloßgestellt. Das gilt auch für Männer, die homosexuelle Prostitution ausüben.
Aus ethischer Sicht ist die Prostitution schon deshalb abzulehnen, weil in ihr die geschlechtliche Hingabe in Widerspruch zu ihrem eigentlichen Sinngehalt steht. Die körperliche Einswerdung wird getrennt von dem, was sie ausdrücken soll: Liebe und Treue. Besonders ist auch die doppelte Moral zu verurteilen, die dem Mann in der Sexualität mehr Freiheit einräumt als der Frau und sein Vergehen mit größerer Nachsicht beurteilt. Prostitution und Geschlechtsverkehr mit Prostituierten widersprechen auch zutiefst der christlichen Hochachtung vor dem menschlichen Leib. Der heilige Paulus erinnert im ersten Korintherbrief daran, daß der Leib nicht für die Unzucht da ist, sondern für den Herrn (6,13). "Wer aber Unzucht treibt, versündigt sich gegen den eigenen Leib. Oder wißt ihr nicht, daß euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt?" (1 Kor 6,18-19).
Unter Pornographie versteht man die Beschreibung oder Darstellung von unzüchtigen Sachverhalten. Dabei wird ein Bild vom Menschen und der Sexualität geboten, das den allgemein anerkannten und humanen Wertvorstellungen entgegengesetzt ist. Die Frau wird als bloßes Objekt sexueller Erregung für Männer dargestellt. Auch wird ein wirklichkeitsfernes Bild vom Menschen gezeichnet, in dem nur Jugend, Gesundheit, äußere Schönheit und sexuelle Potenz zählen.
Die Grenzen dessen, was als schamlos und obszön empfunden wird, haben sich in der Gegenwart stark verschoben. Es ist nicht immer eindeutig, was in den Massenmedien als Kunst oder als Pornographie anzusehen ist. Oftmals werden Darstellungen und Szenen geboten, die den Intimbereich des Menschen verletzen.
Die Gefahr der Pornographie besteht vor allem darin, daß hier ein Verständnis des Menschen vermittelt wird, das Personenwürde und Verantwortung mißachtet. Wo obszöne Darstellungen unkritisch aufgenommen werden, nehmen sie Einfluß auf die Vorstellungen und letztlich auch auf das Handeln der Menschen. Besonders gefährlich ist die Verbindung von Pornographie und Brutalität, die in Videokassetten und anderen Medien verherrlicht werden. Hier verstärkt sich das menschenverachtende Verständnis von Sexualität und Brutalität wechselseitig.
Jugendliche sind durch pornographische Bilder, Filme und Schriften besonders gefährdet. Es ist Aufgabe der Eltern und der Gesellschaft, sie davor zu bewahren. Jugendgefährdende und das sittliche Empfinden verletzende Filme und Schriften bis hin zur Kinderpornographie sollten auch gesetzlich verboten werden.
Ethos und Ethik der Geschlechtlichkeit fordern nicht nur die Beobachtung einzelner Normen ein, sondern setzen eine humane Einstellung zu sich selbst und zum Mitmenschen voraus. In allem geht es um Verantwortungsbewußtsein und Bereitschaft zur Selbststeuerung, Beständigkeit und Treue. Der Christ weiß, daß er dazu Wertvorstellungen und Orientierungen in Gesellschaft und Kirche braucht, die ihm bei der persönlichen Urteilsfindung eine Hilfe sein können. Darüber hinaus weiß er um die Kraft des Gebetes und der Gnade Gottes zur verantwortlichen Gestaltung des Lebens im Bereich des Geschlechtlichen.
VII. Siebtes und zehntes Gebot: Du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut
Ich bin dein Gott, der dir Leben und Zukunft schenkt
Du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut
Gott will, daß wir die Freiheit des Menschen achten und uns für Gerechtigkeit in der Welt einsetzen.
1. Das siebte und zehnte Gebot als Wegweisung zu Freiheit und Gerechtigkeit
1.1. Der Wortlaut des siebten und zehnten Gebotes
Die beiden Gebote beziehen sich auf die Verletzung der Freiheit des Menschen und der Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Hinter der negativen Formulierung steht die positive Weisung, die freie Entfaltung des Menschen zu schützen und in der Welt der Arbeit und der Wirtschaft für soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit zu sorgen.
Der Text des siebten Gebotes ist in den beiden Fassungen des Alten Testamentes gleich:
- "Du sollst nicht stehlen" (Ex 20,15; Dtn 5,19).
Im engen Zusammenhang mit diesem Gebot müssen auch die beiden Begehrungsverbote des neunten und zehnten Gebotes gesehen werden. Während im älteren Text des Buches Exodus das Begehren nach Hab und Gut vorweg genannt wird, nennt der jüngere Text des Deuteronomiums zuerst die Frau des Nächsten, um darzutun, daß diese zwar zum Mann und damit zu seinem Besitz gehört, aber - wegen der Würde ihrer Person - nicht ein beliebig veräußerbarer Besitz ist, sondern zu ihm gehört wie sein eigener Arm oder sein eigener Fuß.
Nach katholischer Tradition werden die beiden Begehrungsverbote in das neunte und zehnte Gebot aufgeteilt (vgl. dazu KKK, in dem das neunte und das zehnte Gebot jeweils in einem eigenen Kapitel behandelt werden).
Im Buch Exodus lautet das Begehrungsverbot:
- "Du sollst nicht nach dem Haus deines Nächsten verlangen. Du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen, nach seinem Sklaven oder seiner Sklavin, seinem Rind oder seinem Esel oder nach irgend etwas, das deinem Nächsten gehört" (20,17).
Im Buch Deuteronomium lautet der Text:
- "Du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen, und du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, nicht sein Feld, seinen Sklaven oder seine Sklavin, sein Rind oder seinen Esel, nichts, was deinem Nächsten gehört" (5,21).
1.2. Der ursprüngliche Sinn des siebten und zehnten Gebotes im Alten Testament
Das siebte Gebot "Du sollst nicht stehlen" (Ex 20,15; Dtn 5,19) untersagt jede Verletzung fremden Eigentums durch ungerechte Aneignung und durch Ausbeutung anderer. Das in diesem Gebot gebrauchte hebräische Wort "ganab" meint nicht nur stehlen, sondern den ganzen Bereich von "entführen" - "rauben" - "stehlen" - "täuschen". Es bezieht sich also nicht allein auf Sacheigentum, sondern in erster Linie auf den gewaltsamen Zugriff auf Menschen, um sie zu versklaven oder als Sklaven zu verkaufen. Es geht hier um die Freiheit des Menschen; sie ist das erste Gut, das durch das siebte Gebot geschützt ist. Dazu gehört auch die freie Verfügung über ererbtes oder durch Arbeit erworbenes Eigentum.
Das zehnte Gebot "Du sollst nicht nach dem Haus deines Nächsten verlangen. Du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen, nach seinem Sklaven oder seiner Sklavin, seinem Rind oder seinem Esel oder nach irgend etwas, das deinem Nächsten gehört" (Ex 20,17; vgl. Dtn 5,21), verbietet alle Pläne, Absichten und Unternehmungen, die geeignet sind oder dazu führen, dem Mitmenschen seine wirtschaftliche Existenzgrundlage streitig zu machen oder zu nehmen. Es hat alle Interessen und Machenschaften im Blick, die letztlich auf eine Enteignung von Grund und Boden, Haus oder Hof und der zur Familie gehörenden Personen hinauslaufen.
Die Weisung des siebten und zehnten Gebotes erinnert das Gottesvolk unmittelbar an die Selbstoffenbarung Gottes, die über dem ganzen Dekalog und über jedem einzelnen Gebot steht: "Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, dem Sklavenhaus" (Ex 20,2; Dtn 5,6). Das Volk hat in Ägypten erfahren, was es heißt, versklavt zu sein. "Da setzte man Fronvögte über sie ein, um sie durch schwere Arbeit unter Druck zu setzen" (Ex 1,11). Die Ägypter gingen "hart gegen die Israeliten vor und machten sie zu Sklaven. Sie machten ihnen das Leben schwer durch Arbeit mit Lehm und Ziegeln und durch alle möglichen Arbeiten auf den Feldern. So wurden die Israeliten zu harter Sklavenarbeit gezwungen" (Ex 1,13-14). Der Hinweis auf die Befreiung aus dem Sklavenhaus Ägypten, aus der Rechtlosigkeit der Arbeitslast und der Bedrängnis (Dtn 26,7) stellt im siebten und zehnten Gebot dem Gottesvolk vor Augen: Solche Lebens- und Arbeitsbedingungen, solche Ausbeutung von Menschen und solche Ansprüche auf das, was andere als Hab und Gut erarbeitet haben, darf es im Gottesvolk nicht geben.
Diebstahl und Raub, Unterdrückung und Versklavung sind in der Bibel ein Verstoß gegen den Mitmenschen, der Anspruch darauf hat, daß nicht nur er selbst, sein Leben und seine körperliche und geistige Unversehrtheit, sondern auch sein Eigentum anerkannt und geachtet wird. In der Frühzeit bestand das Eigentum vor allem aus Vieh. Erst nach der Seßhaftwerdung galt auch der Teil des Landes, den Familien oder Sippen besaßen, als Eigentum. Eigentum war der Ertrag erfolgreicher Arbeit und Ausdruck des Segens Jahwes.
Der Verlust des Eigentums wurde weitgehend aufgefangen durch die Solidarität der Familien und Sippen. Erst im Verlauf der Staatenbildung und der Errichtung des Königtums kam es zu gesellschaftlich bedeutenden Gegensätzen von Arm und Reich. Die Eigentumskonflikte, die sich mit der Bildung von Großgrundbesitz (Latifundien), mit dem Wachsen der Verwaltung, der Städte und des Handels allmählich ergaben, finden in zahlreichen Texten des Alten Testamentes ihren Niederschlag.
Alle Habe gilt als Lehen von Jahwe, dem Schöpfer und Landgeber; das ist der Grund, der Eigentum vor fremdem Zugriff schützt, gleichzeitig aber auch verhindert, daß Eigentum unabhängig von den Rechten und Bedürfnissen anderer gesehen werden darf.
Besondere Bestimmungen erinnerten Israel stets daran: In jedem siebten Jahr, dem "Sabbatjahr", sollen die Felder nicht bebaut werden; das, was auf den Feldern wächst, soll den Armen gehören. Wer einem Nächsten etwas geborgt hat, soll es nicht zurückfordern (Dtn 15,1f). In jedem fünfzigsten Jahr, dem "Jobeljahr", soll der in Notlagen veräußerte Besitz von Grund und Boden dem ursprünglichen Besitzer wieder zurückgegeben werden. Wenn auch ein solches Idealgesetz in Israel kaum in die Praxis umgesetzt wurde, so wies es doch immer wieder hin auf den Charakter des Eigentums als eines Jahwelehens.
Staatliche Steuern und die Abgaben an das Heiligtum (Zehnte) sind rechtens, Almosengeben ist eine Pflicht der Gerechtigkeit gegenüber den Armen.
Ungezügelter Erwerbstrieb, Unterdrückung der Schwächeren und Ausbeutung werden insbesondere von den Propheten und auch von den Weisheitslehrern als gottwidrig verworfen. Das Ideal der alttestamentlichen Gesellschaft ist bei aller faktisch bestehenden Ungleichheit die "Gesellschaft der Gleichen".
Deshalb richtet sich die Sozialkritik der Propheten gegen den ungerechten Umgang mit Eigentum. Die Propheten wenden sich immer wieder gegen Latifundienbildung, gegen hemmungslosen Luxus, gegen betrügerische Verkaufspraktiken und nach außen hin legale Ausnutzung von rechtlichen und wirtschaftlichen Regeln, die sich aber zu Lasten der Armen auswirken.
Anhäufung von Eigentum sowie Reichtum, der durch Ausbeutung erworben wurde, gelten der prophetischen Kritik als Zerstörung der alten Gesellschaftsordnung einer Stämme- und Solidargemeinschaft, die dem Verhältnis zwischen Jahwe und Israel entsprach.
- "Hört dieses Wort, ihr Baschankühe [Sinnbild der genußsüchtigen Frauen] auf dem Berg von Samaria, die ihr die Schwachen unterdrückt und die Armen zermalmt und zu euren Männern sagt: Schafft Wein herbei, wir wollen trinken. Bei seiner Heiligkeit hat Gott, der Herr, geschworen: Seht, Tage kommen über euch, da holt man euch mit Fleischerhaken weg, und was dann noch von euch übrig ist, mit Angelhaken" (Am 4,1f).
- "Weh euch, die ihr Haus an Haus reiht und Feld an Feld fügt, bis kein Platz mehr da ist und ihr allein im Land ansässig seid. Meine Ohren hören das Wort des Herrn der Heere: Wahrhaftig, alle eure Häuser sollen veröden. So groß und schön sie auch sind: Sie sollen unbewohnt sein. Ein Weinberg von zehn Morgen bringt nur ein Bat Wein, ein Homer Saatgut bringt nur ein Efa Korn" (Jes 5,8-10).
Als Folge solcher Zerstörung der Rechtsordnung muß der Untergang der Reiche Israel und Juda und das Exil als unausweichlich erscheinen. In exilischen und nachexilischen Programmschriften spielt die Wiederherstellung gerechter Eigentumsverhältnisse eine zentrale Rolle. So fordert zum Beispiel der Verfassungsentwurf Ez 40-48 die Herstellung gleicher Landanteile der Stämme und die Verhinderung erneuter Enteignung und Latifundienbildung. In alledem zeigt sich die gesellschaftskritische Bedeutung des siebten und zehnten Gebotes. Besitz und Eigentum werden nur insoweit als berechtigt angesehen, als sie gerecht erworben sind und nicht die Freiheit der anderen und ihre Lebensgrundlagen beeinträchtigen.
1.3. Das Urteil Jesu und das Ethos der frühen Kirche
Im Blick auf die Gottesherrschaft verliert das Irdische bei Jesus an Gewicht. Irdische Schätze sind unsicher und ziehen das Herz von Gott ab. Jesus selbst lebt ohne Besitz und ruft auch seine Jünger dazu auf, alles zu verlassen und ihm nachzufolgen (Mt 19,16-30). Sie sollen "Schätze im Himmel" sammeln, wo weder Rost noch Motten sie verzehren und keine Diebe kommen, die sie stehlen. Jesus verlangt einen Umgang mit irdischen Gütern, der alle Gier nach Reichtum und Macht überwindet und im Gutes-Tun an den "geringsten Brüdern" Jesu vor Gott bestehen kann. Eigentum und Besitz verpflichten tiefer, als es eine rechtliche Ordnung verlangen kann.
- ". . . Geh, verkauf alles, was du hast, und gib es den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben . . ." (Mk 10,21).
- "Denn was nützt es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, aber sein Leben einzubüßen? Was könnte ein Mensch als Preis für sein Leben geben?" (Mk 8,36f).
Ohne die herrschenden Besitzverhältnisse grundsätzlich anzufechten, betont Jesus stets die Verpflichtung der Reichen für die Armen und findet scharfe Worte gegen die Verführung des Reichtums.
- "Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als daß ein Reicher in das Reich Gottes gelangt" (Mk 10,25).
Paulus zählt Diebstahl und Habgier zu den schweren Verfehlungen (vgl. 1 Kor 6,10). Er wendet sich gegen Betrug, unordentlichen Lebenswandel und Arbeitsscheu (1 Thess 4,6; 2 Thess 3,6-12).
- "Der Dieb soll nicht mehr stehlen, sondern arbeiten und sich mit seinen Händen etwas verdienen, damit er den Notleidenden davon geben kann" (Eph 4,28).
Die Urgemeinde in Jerusalem hat über eine gewisse Zeit in einer Art freiwilligen Gütergemeinschaft gelebt, um auf diese Weise den Worten Jesu vom Teilen mit den Armen gerecht zu werden:
- "Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, jedem soviel, wie er nötig hatte" (Apg 2,44f; 4,32-35).
Als sich das Ehepaar Hananias und Saphira gegen diesen Geist verfehlte, hielt Petrus dem Hananias vor: "Hätte es [das Grundstück] nicht dein Eigentum bleiben können, und konntest du nicht auch nach dem Verkauf frei über den Erlös verfügen?" (Apg 5,4).
Von Anfang an kannte die Urkirche die Abgabe von Besitz aus caritativer Gesinnung. Die Organisation der Armenhilfe wurde in der alten Kirche im "Diakonat" zu einer festen Einrichtung.
Im Neuen Testament geht es - anders als im Alten Testament - um die persönliche Einstellung des einzelnen zum Besitz. Die Kritik des Evangeliums und die sittlichen Weisungen der Briefe richten sich nicht gegen die Institution des Privateigentums, sondern gegen die sittlichen und religiösen Gefährdungen, die mit Besitz und Eigentum häufig verbunden sind: gegen Habsucht, Neid und Egoismus. Es sind die leicht mit dem Besitz von Eigentum einhergehenden Fehlhaltungen im Gebrauch der irdischen Güter, welche die Freiheit des Menschen bedrohen: eine Verkehrung der Rangordnung der Werte, das Verletzen von Gerechtigkeit und Liebe und damit das Aushöhlen der Grundlagen der gesellschaftlichen Ordnung.
Ein besonderes Problem im Urchristentum stellt die Sklavenfrage dar. Sklaven galten als Eigentum ihrer Herren und waren häufig deren Willkür ausgesetzt. Bei Paulus wird zwar an dieser sozialen Lage nichts geändert; jeder soll in dem Stand bleiben, in den er berufen wurde (1 Kor 7,17). Aber die Sklavenfrage wird in ein neues Licht gerückt, weil der im Herrn als Sklave Berufene Freigelassener des Herrn ist (1 Kor 7,22f). Paulus setzt sich ein für den entlaufenen Sklaven Onesimus und bittet dessen Herrn (den Christen Philemon), ihn als "geliebten Bruder" aufzunehmen (Phlm 16).
Die Urkirche suchte so ihren Umgang mit den Sklaven in einer menschlicheren Weise zu gestalten als ihre heidnische Umwelt und sie in die christliche Gemeinde einzugliedern. In der gottesdienstlichen Versammlung sollten alle gleich sein. Ehemalige Sklaven konnten kirchliche Ämter übernehmen und taten dies auch. So war Papst Calixtus I. (+ 222) ein ehemaliger Sklave.
1.4. Die Bedeutung des siebten und zehnten Gebotes in der Gegenwart
Der ursprüngliche Sinn des siebten und zehnten Gebotes, die Freiheit des Menschen und sein Hab und Gut als Lebensgrundlage zu achten, bleibt auch in der heutigen Lebenswelt bestehen; aber er enthält in den gewandelten Strukturen des sozialen und wirtschaftlichen Lebens eine entscheidende Ausweitung. Formen von Versklavung in der heutigen Arbeitswelt und Mißbrauch von Macht im Umgang mit den Gütern der Erde rufen die Weisung des siebten und zehnten Gebotes mit besonderer Dringlichkeit in Erinnerung. Das Gebot lenkt heute die Aufmerksamkeit auf die Herstellung einer gerechten Arbeits- und Wirtschaftsordnung und auf die Verantwortung für den rechten Umgang mit Eigentum in allen seinen Formen.
Zu den neuen Entwicklungen in der Welt der Arbeit und der Wirtschaft haben katholische Sozialethik und kirchliche Soziallehre seit Beginn der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auseinandersetzungen im 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart kritisch und konstruktiv Stellung genommen und im Licht des Glaubens Kriterien einer gerechten Sozial- und Wirtschaftsordnung erstellt. In den Sozialenzykliken der Päpste von "Rerum novarum" (1891) bis "Centesimus annus" (1991) spiegelt sich nicht nur die Dynamik der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung wider, sondern auch die Überwindung ideologischer Doktrinen, die von der Kirche verworfen wurden. In ihrer Verkündigung geht es der Kirche darum, daß der Mensch in verschiedenen Gestalten des sich wandelnden sozialen und wirtschaftlichen Lebens und seiner Strukturen Mensch bleiben und immer Mensch werden kann. In dieser Aufgabenstellung haben das siebte und zehnte Gebot heute ihren gesellschaftskritischen und zugleich menschenrechtsfördernden Sinn.
2. Arbeit als sittliche Aufgabe
2.1. Formen der Arbeit heute
Arbeit ist ein Grundelement des menschlichen Daseins. Sie wird in unterschiedlichen Formen verwirklicht, die jeweils eine eigene Bedeutung für den einzelnen wie für die Gesellschaft haben.
- Unter Erwerbsarbeit oder Berufsarbeit ist vornehmlich jene Arbeit zu verstehen, mit welcher der Mensch Geld oder Güter verdient, um die Bedürfnisse des Lebens abzusichern und Eigentum zu erwerben.
Wirtschaftliche Strukturveränderungen und technische Entwicklungen bringen heute neue Anforderungen an den einzelnen arbeitenden Menschen und neue Aufgaben für die Gesellschaft mit sich. Bis ins 19. Jahrhundert bestand Arbeit vorwiegend in Landwirtschaft, Bergbau, Energie- und Rohstoffgewinnung (primärer Sektor); in der sich entfaltenden Industriegesellschaft gewann die technisch immer kompliziertere Warenproduktion (sekundärer Sektor) immer mehr an Bedeutung. Im Vergleich dazu nimmt heute der Anteil der Arbeit im Dienstleistungsgewerbe, in Handel, Verkehr, Kommunikation, Banken, Versicherungen, Gesundheitswesen, Fürsorgeeinrichtungen, in Schule und Bildung, in Kirchen, Verbänden und Interessenorganisationen (tertiärer Sektor) an der Gesamterwerbstätigkeit beständig zu; der Anteil des primären und sekundären Sektors nimmt im Vergleich dazu ab. Einerseits wird mit dieser Gewichtsverschiebung innerhalb der Wirtschaftssektoren die Belastung des arbeitenden Menschen durch schwere körperliche Arbeit geringer. Im Vergleich zu früher brauchen heute viele Menschen immer weniger an Arbeitszeit und Arbeitseinsatz, um für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Andererseits steigt in vielen Arbeitsbereichen die Belastung. Oft wird die Arbeitswelt für den einzelnen auch schwerer durchschaubar. Es werden neue Anforderungen an den Erwerbstätigen und Erwerbsuchenden gestellt.
- Um Zugang zur Erwerbsarbeit zu bekommen oder zu halten, wird heute zunehmend Fortbildung unumgänglich. Wer sich nicht fortbildet, geht das Risiko ein, seine Arbeit zu verlieren, weil er im Arbeitsprozeß nicht mithalten kann.
- Ein großer Anteil an Arbeit fällt auf die Tätigkeit in der Familie, besonders auf Erziehung und Pflege. Die Arbeit in der Familie ist ein großer innerer Reichtum für die Familie selbst wie für die Gesellschaft. Sie sorgt in erheblichem Maß für Lebensqualität.
- Neben der Erwerbsarbeit hat auch die Eigenarbeit große Bedeutung. Hierzu gehört alles, was außerhalb der Arbeitszeit für den Eigenbedarf getan wird. Die Eigenarbeit stellt oftmals einen Bereich dar, in dem der Mensch mehr als in der Erwerbsarbeit mit Lust und Freude arbeitet. Der positive Wert der Eigenarbeit wird allerdings verfehlt, wenn sie in zu großem Umfang betrieben wird, wenn Sonntage, Feiertage und Urlaubszeit sinnentfremdet genutzt werden oder wenn die Grenze zur die Gemeinschaft schädigenden Schwarzarbeit überschritten wird.
Verstärkte Bedeutung gewinnt in der heutigen Gesellschaft die freie Sozialarbeit. Die amtliche caritative Arbeit bedarf zunehmend der Unterstützung durch freiwilliges caritatives Engagement von Helfern, die ehrenamtlich in Gruppen, Gemeinschaften, Vereinen und Verbänden tätig sind.
2.2. Beziehungsgefüge der Arbeitsformen
Die unterschiedlichen Formen der Arbeit sind einander zugeordnet, bedingen einander und bilden zusammen ein Beziehungsgefüge der Arbeit. Dem einzelnen und der Gesellschaft stellt sich in der je persönlichen Situation und unter den jeweiligen Verhältnissen immer wieder die Frage, wie das Beziehungsgefüge der verschiedenen Formen von Arbeit zu gestalten ist.
Im Gegensatz zur Antike, in der alle Arbeit zur materiellen Existenzsicherung (als Erwerbsarbeit) als verächtlich angesehen und vorzugsweise den Sklaven übertragen wurde, wird heute die Erwerbsarbeit hochgeschätzt. Sie ist zu einem bestimmenden Faktor des menschlichen Lebens geworden und wird häufig sogar im Vergleich zu anderen Formen notwendiger und sinnvoller Arbeit überbetont. Dabei wird oftmals übersehen, daß die gesamte Arbeits- und Lebenswelt der Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft von jenen humanen Quellen lebt, die mit der Familie und anderen Lebenskreisen gegeben sind.
Zwar setzt die mit der technischen Entwicklung möglich gewordene Verkürzung der Erwerbszeit in Form der Tages-, Wochen-, Jahres- und Lebensarbeitszeit mehr Zeit und Energie für andere Betätigungen frei. Gleichzeitig wird es aber auch schwieriger, Beruf, Fortbildung, Familienleben, Eigenarbeit, freiwillige Sozialarbeit und Freizeitaktivitäten sinnvoll miteinander zu verbinden.
2.3. Der personale Charakter der Arbeit
Die Frage nach dem Sinn und Wert menschlicher Arbeit und nach menschenwürdiger Gestaltung der Arbeitswelt steht im Brennpunkt der kirchlichen Sozialverkündigung.
Von der ersten, 1891 erschienenen, bahnbrechenden Sozialenzyklika Leos XIII. "Rerum novarum" über "Quadragesimo anno" (Pius XI., 1931), "Mater et magistra" (Johannes XXIII., 1961), "Pacem in terris" (Johannes XXIII., 1963), "Populorum progressio" (Paul VI., 1967) bis zu den Enzykliken Johannes Pauls II. "Laborem exercens" (1981), "Sollicitudo rei socialis" (1988) und "Centesimus annus" (1991), aber auch in der Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils "Gaudium et spes" ("Über die Kirche in der Welt von heute", 1965) nimmt die Kirche Stellung zu sozialen und wirtschaftlichen Fragen.
Die ersten Enzykliken (RN und QA) befassen sich vor allem mit der gerechten Lösung der Arbeiterfrage im Rahmen der gesellschaftlich-politischen Situation der Industrienationen. Heute weitet sich der Blick auf die ganze Welt aus: auf soziale Gerechtigkeit, Entwicklung und Frieden für alle Völker (MM, PT, GS, PP).
Arbeit, in welcher Gestalt auch immer, ist eine Äußerung des Menschen. Sie ist ein Kennzeichen menschlicher Existenz. Der Mensch ist zur Arbeit geboren wie der Vogel zum Flug (vgl. QA 61).
Als Merkmal der menschlichen Person gewinnt die Arbeit ihren Wert aus ihrer Beziehung zum Menschen, aus dem Wert, den sie für den Menschen darstellt. Arbeit hat personalen Charakter. Sie darf daher nie als bloßes Produktionsmittel behandelt werden (vgl. LE 15,2).
Diese Charakterisierung der Arbeit weist den seit dem 19. Jahrhundert herrschenden Irrtum zurück, menschliche Arbeit sei als Ware zu betrachten. In einer solchen Sicht liegt die Gefahr, vom ökonomischen Tauschwert der menschlichen Arbeit auf die Würde des arbeitenden Menschen zu schließen.
Die Würde der Arbeit mißt sich nicht nach dem Arbeitsprodukt, nicht nach dem Beitrag, den der arbeitende Mensch geleistet hat, sondern nach ihrem subjektiven Wert, nach dem personalen Einsatz und dem persönlichen Engagement, das der einzelne mit seiner Arbeitsleistung verbindet. Zwar darf und muß die Arbeit auch unter ökonomischem Aspekt bewertet und entsprechend unterschiedlich entlohnt werden, aber eine bloß marktgerechte Bewertung der Arbeit kann aus ethischer Sicht nicht genügen; der ökonomische Tauschwert darf nicht der einzige Schlüssel für die Behandlung des Menschen im Produktionsprozeß sein.
Die erste Grundlage für den Wert der Arbeit ist der Mensch selbst, denn der letzte "Zweck der Arbeit, jeder vom Menschen verrichteten Arbeit - gelte sie auch in der allgemeinen Wertschätzung als die niedrigste Dienstleistung, als völlig monotone, ja als geächtete Arbeit - bleibt letztlich immer der Mensch selbst" (LE 6,6).
2.4. Der Sinn menschlicher Arbeit
Menschliche Arbeit hat zuerst ihren Sinn darin, den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Sie eröffnet zugleich einen Weg zur personalen Reife des Menschen. Arbeit formt den arbeitenden Menschen, sie bildet und erzieht. Der Mensch ist nicht nur zur Arbeit berufen, sondern er ist auch sittlich verpflichtet, zu arbeiten und dieses entsprechend seinen Fähigkeiten und Kräften gut zu tun.
Auch mühevolle Arbeit hat Sinn. Es widerspricht nicht der Würde des Menschen, Widerstände zu überwinden und Kräfte einzusetzen, wenn dies innerhalb einer sozialen Ordnung geschieht, die es dem Menschen erlaubt, in der Arbeit mehr Mensch zu werden (vgl. LE 9).
Ein weiterer Wert menschlicher Arbeit ist die Familie. Sie ist eine "durch Arbeit ermöglichte Gemeinschaft und die erste häusliche Schule der Arbeit für jeden Menschen" (LE 10).
Ein dritter Wertbereich ist die umfassende Gemeinschaft, welcher der Mensch aufgrund besonderer kultureller und historischer Bindungen angehört, denn die Kultur einer bestimmten Nation ist "eine große historische und soziale Inkarnation der Arbeit aller Generationen" (LE 10). Der Mensch trägt durch seine Arbeit dazu bei, das Gemeinwohl zu vermehren. Dadurch wirkt er gleichzeitig an der Mehrung der kulturellen und ideellen Güter der ganzen Menschheitsfamilie mit.
2.5. Arbeit im Licht des Glaubens
Durch die Offenbarung Gottes fällt für den Christen auch auf seine Arbeit das Licht des Evangeliums. Die menschliche Arbeit hat somit auch eine theologische Dimension.
Das persönliche und gemeinsame menschliche Schaffen, das Bemühen der Menschen, ihre Lebensbedingungen stets zu verbessern, entspricht der Absicht Gottes (vgl. LE 25,1; GS 34,1).
Die Schöpfungstat Gottes (vgl. Gen 1,1 - 2,4) ist darauf angelegt, daß die Erde das "Lebenshaus alles Lebendigen" bleibt und im Sinne dieses von Gott vorgegebenen Zieles von den Menschen weiterentwickelt wird. Als Bild Gottes hat der Mensch den Auftrag erhalten, die Erde zu "bebauen und zu behüten" (Gen 2,15). In seinem Arbeiten und Wirken ist ihm die Schöpfung zur Ausgestaltung anvertraut.
Die Erde mit ihren Früchten ist die erste Gabe Gottes für den Lebensunterhalt des Menschen. Aber "die Erde schenkt ihre Früchte nicht ohne eine bewußte Antwort des Menschen auf die Gabe Gottes, das heißt ohne Arbeit" (CA 31).
Alle Menschen tragen in jedem sinnvollen Tun zur Gestaltung der Schöpfung bei und dienen dem Wohl ihrer Mitmenschen. Der Christ erfährt in all seinem Tun, daß dies oft geprägt ist von der leidvollen Spannung zwischen der Größe seines Weltauftrages und der Schwere und Last der Arbeit. Er erfährt sein Lebenswerk als begrenzt, von Untergang, Katastrophen oder Unfällen bedroht und vielfach vergeblich. Die Grenze seiner Arbeitskraft und Leistungsfähigkeit kann durch persönliche schicksalhafte Gegebenheiten wie physische oder geistige Behinderung sowie durch gesellschaftliche Umbrüche wie Kriege, Ausbeutung der Arbeitsleistung und vieles mehr eingeengt werden. Die Spannung liegt aber auch im Menschen selber als Folge der Erbsünde, denn er findet sich in der Welt nicht mehr in der ursprünglichen Einheit mit Gott, mit den Mitmenschen und mit der Natur (vgl. Gen 3,17). Entsprechende Folgen sind Egoismus, Neid, Übervorteilung, Rücksichtslosigkeit im Arbeitsprozeß und ausbeuterischer Umgang mit der Natur.
Die mit der Arbeit verbundene Mühsal kann für den Menschen aber auch zur Teilnahme an Christi Erlösungswerk werden. Das tägliche Tragen des eigenen Kreuzes "in Einheit mit dem für uns gekreuzigten Herrn" ist ein Mitwirken "mit dem Gottessohn an der Erlösung der Menschheit auf seine Weise" (LE 27).
Arbeit, im Glauben und in der Liebe getan, ist nie vergeblich, denn die Liebe und ihre Werke bleiben (vgl. GS 39). Arbeit kann sogar so etwas wie einen "Umriß", einen "Schimmer" des neuen Himmels und der neuen Erde erfahrbar machen.
Das Erlösungsgeschehen umschließt nicht nur das Kreuz, sondern auch die Auferstehung und Erhöhung Jesu Christi. Gerade dadurch, daß sich in der Mühsal der Arbeit für den Christen "die Unausweichlichkeit des Kreuzes" bestätigt, enthüllt sich auch bereits in dieser Mühsal ein neues Gut (vgl. LE 27).
Der Geist des Evangeliums und der Glaube an die göttliche Vollendung ermutigen zu einem von Glaube, Hoffnung und Liebe geleiteten Engagement in der Welt. Der entscheidende Grund dafür liegt
im Glauben daran, daß der Mensch in den Sinn der ihm vom Schöpfer geschenkten Freiheit vertrauen darf, durch seine Arbeit die Welt zu gestalten; in der gläubigen Hoffnung, daß Gott sein Heilsziel mit allen Menschen guten Willens erreicht; in der Erfahrung, daß der Mensch durch ein von Liebe und Gerechtigkeit geleitetes Handeln zum Wachsen des irdischen Fortschrittes beiträgt und dadurch "auch bei der Entfaltung des Reiches Gottes" mitwirkt und so "die Güter der menschlichen Würde, der brüderlichen Gemeinschaft und der Freiheit" (LE 27) mehrt.
Unser gesamtes Schaffen, sei es geistiger oder körperlicher Natur, ist eine uns von Gott anvertraute Gabe und Aufgabe. Unser Handeln soll dazu beitragen, daß die Welt, in der wir leben, human gestaltet wird. Deshalb sollen wir unsere Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen verantwortlich und sorgfältig tun in der festen Zuversicht, daß "alle guten Erträgnisse" menschlichen Mühens, "gereinigt von jedem Makel, lichtvoll und verklärt" (GS 38), eingehen werden in das Reich Gottes.
3. Gestaltungsaufgaben in der Arbeitswelt
3.1. Aufbau einer Ordnung der Arbeit
Aus dem Sinn und Wert jeder menschlichen Arbeit ergibt sich die sittliche Forderung nach einer Ordnung der Arbeit, die dem arbeitenden Menschen und der Gesellschaft insgesamt gerecht wird. Es geht um die Aufgabe, ein soziales Gebäude zu bauen, in dem alle Menschen so arbeiten können, daß ihre Würde gewahrt bleibt und daß sie das Ziel ihrer Anstrengungen erreichen können.
Spätestens im 19. Jahrhundert waren große Gruppen der Gesellschaft in ihren materiellen Möglichkeiten, in ihrem sozialen Rang, in ihrer Würde und ihrem Ansehen stark beeinträchtigt. Sie konnten zur damaligen sozialen und politischen Ordnung kaum Stellung nehmen. So entstand mit der Verelendung der Arbeiterschaft die "soziale Frage" in einem quantitativ größeren Umfang und in einer entsprechend größeren politischen Bedeutung als in den bäuerlichen und handwerklichen Gesellschaftsstrukturen früherer Jahrhunderte. In der Zeit der Industrialisierung haben Entwicklungen in Technik, Wirtschaft und Politik auf die Welt der Arbeit und der Produktion große positive Auswirkungen gehabt. Die Arbeit ist für die meisten leichter und erträglicher geworden. Allerdings werden die wachsende Ausweitung der Automatisierung, der Energie- und Rohstoffkosten, die Begrenztheit der Natur, ihre zunehmende Belastung und die Verflechtung mit der internationalen Welt zu Problemen. Während die soziale Frage des 19. Jahrhunderts in erster Linie nationalstaatlich und gegenwartsbezogen war, ist die neue soziale Frage auch auf die ganze Welt und auf die kommenden Generationen bezogen.
Die Lösung der weltweit gewordenen sozialen Frage muß ansetzen beim Menschen und seiner Arbeit. Als Grundlage allen Wirtschaftens und als Fundament aller übrigen wirtschaftlichen Elemente hat die menschliche Arbeit die Schlüsselfunktion zur Lösung der sozialen Frage.
Heute muß eine Ordnung der Arbeit geschaffen werden, die unter neuen Voraussetzungen der personalen Würde des Menschen gerecht zu werden versucht und die Arbeit des einzelnen in den Dienst einer menschenwürdigen Entfaltung aller stellt.
Daraus ergeben sich Konsequenzen und Orientierungen für die weitere Entwicklung, die vom einzelnen Menschen wie von der Gesellschaft ein ständiges Umdenken und ein entsprechendes Handeln fordern.
Daher ist der Adressat solcher Orientierungen nicht nur der unmittelbare Arbeitgeber, sondern vor allem auch die hinter ihm stehenden Faktoren, die auf die Fassung des Arbeitsvertrages, auf das gesellschaftliche Umfeld der Wirtschaft und auf das Entstehen mehr oder weniger gerechter Bedingungen menschlicher Arbeit Einfluß haben (zum Beispiel die Tarifpartner Arbeitgeber und Gewerkschaften, der Staat und seine Organe, politische Parteien, Interessengruppen, Konzerne, internationale Wirtschaftsinstitutionen und Wirtschaftsabkommen). Adressat solcher sittlichen Imperative ist aber ebenso der Arbeitende selbst. Er trägt die moralische Verpflichtung zur Arbeit, zu einer entsprechenden Aus- und Weiterbildung und zur Mitsorge um menschenwürdige Bedingungen im Arbeitsprozeß.
3.2. Recht auf Arbeit
Zu Beginn der Industrialisierung wurde Arbeit zunehmend als bloße Dienstleistung angesehen; menschliche Arbeitsleistung wurde dem Gesetz von Angebot und Nachfrage unterstellt. Der Arbeitnehmer verkaufte dem Arbeitgeber, der über die Produktionsmittel (Eigentum, Kapital, Arbeitsgeräte, Fabriken) verfügte, seine Arbeitsleistung als Dienstleistung. Als entgeltabhängiger Arbeiter und Angestellter war er ganz vom Arbeitsmarktgeschehen und dem Willen des Unternehmers abhängig. Damit wurde er selbst zum bloßen Produktionsfaktor in der Hand des Unternehmers. Anspruch auf Arbeit, auf gerechte Arbeitsbedingungen und auf Berücksichtigung der Person des Arbeitnehmers und des Angestellten konnten die Arbeitnehmer nicht geltend machen. Ein "Recht auf Arbeit" gab es nicht.
Das Recht auf Arbeit als ein soziales Grundrecht besitzt Gültigkeit für Arbeitnehmer und Unternehmer (vgl. LE 17). Es verlangt von allen in der Gesellschaft, daß sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern und den Zustand der Arbeitslosigkeit möglichst begrenzen.
Die erste Verantwortung für die Verwirklichung des Rechts auf Arbeit liegt nicht beim Staat, sondern bei den einzelnen und bei den Gruppen und Vereinigungen der Gesellschaft. Denn der Staat kann das Recht aller Bürger auf Arbeit nicht direkt sicherstellen, ohne das gesamte Wirtschaftsleben zu reglementieren und die freie Initiative der einzelnen zu verhindern. Trotzdem darf auf Ordnungsnormen im Bereich der Wirtschaft nicht verzichtet werden. Aufgabe und Pflicht des Staates in diesem Bereich ist, die Tätigkeit der Unternehmer dahingehend zu unterstützen, daß sie Bedingungen für die Sicherstellung von Arbeitsgelegenheit schaffen. Sie müssen die Tätigkeit dort, wo sie sich als unzureichend erweist, anregen bzw. ihr in Augenblicken der Krise unter die Arme greifen (vgl. CA 48,2).
Bei der Überwindung der Arbeitslosigkeit haben besonders die Unternehmer eine große Verantwortung für die Arbeitsplätze in ihren Unternehmen. Durch umsichtiges und vorausschauendes Handeln haben sie den Bestand der Unternehmen und der Arbeitsplätze zu sichern. Ebenso ist aber auch der einzelne Arbeitnehmer gefordert, in dem ihm möglichen Rahmen seinen Beitrag zu leisten. Dieser kann vor allem im Erwerb neuer Qualifikationen bestehen; er kann aber auch zu der ethischen Pflicht führen, einen Teil der Arbeit und den dazugehörigen Lohn an die Arbeitslosen abzugeben, um ihnen so den Zugang zu einem Arbeitsplatz zu eröffnen. Die Tarifpartner haben Tarifverhandlungen so zu führen, daß auch schwer zu vermittelnden und weniger qualifizierten Arbeitslosen die Möglichkeit gegeben wird, in den Arbeitsprozeß eingegliedert zu werden. Für behinderte Menschen, die auf dem normalen Arbeitsmarkt nicht vermittelt werden können, aber auch für Langzeitarbeitslose müssen andersgeartete Arbeitsmöglichkeiten bereitgestellt werden.
Die Frage nach dem "Recht auf Arbeit" ist über die nationale Ebene hinaus auch eine internationale Frage. Die internationale Arbeitsteilung muß möglichst so gestaltet sein, daß ungerechtfertigte Vorteile (Ausbeutung) vermieden werden.
3.3. Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit
Heute stehen Eheleute und Alleinerziehende vor der schwierigen Aufgabe, häusliche Arbeit und Erwerbsarbeit miteinander zu vereinbaren. Nicht selten herrscht in der Gesellschaft noch ein Rollenverständnis vor, das die Frauen benachteiligt. Die Arbeit von Mann und Frau in Beruf und Familie ist so zu gestalten, daß sie sowohl den beruflichen Ansprüchen der Eltern als auch den Bedürfnissen der Kinder nach Pflege und Zuwendung gerecht wird (vgl. LE 19). Niemand sollte aus materiellen oder psychologischen Gründen gezwungen sein, die Aufgaben des häuslichen und familiären Lebens zugunsten der Erwerbsarbeit zu vernachlässigen. Andererseits gehört es zum Recht auf Arbeit, daß Frauen, die eine Erwerbsarbeit aufnehmen oder einen Beruf ausüben wollen, dazu auch die Möglichkeit haben. Es geht darum, eine Ordnung des gesamten Arbeitsprozesses anzustreben, in der jeder nach seinen persönlichen Erfordernissen arbeiten kann. In ihr muß Männern und Frauen der Zugang zu den verschiedenen Berufen offenstehen und zugleich nach Möglichkeiten der Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und häuslicher Tätigkeit gesucht werden.
Die Notwendigkeit, häusliche Arbeit und Erwerbsarbeit miteinander vereinbar zu machen, erfordert ein Einkommen, das einen Erziehungs- bzw. Familienlastenausgleich einschließt, der von der Solidargemeinschaft zu tragen ist. Dementsprechend sind Erziehungs- und Pflegezeiten zu berücksichtigen und sozialversicherungsrechtlich anzurechnen. Zugleich ist eine flexible Arbeitszeit einzurichten, die auf die Bedürfnisse der erwerbstätigen Frau und der Familie abzielt.
3.4. Schaffung humaner Arbeitsbedingungen und betrieblicher Strukturen
Die Bedingungen der Arbeit müssen dem personalen Charakter der Arbeit entsprechen. Es ist notwendig, den Produktionsprozeß so zu gestalten, daß die Menschen ihm nicht wie Sachen untergeordnet oder geopfert werden.
Zwar muß jedes Unternehmen gewinnorientiert sein, aber Gewinn darf nicht das einzige Ziel des Unternehmens sein. Menschliche und moralische Faktoren müssen in einem Unternehmen mit der Erwirtschaftung von Gewinn im Einklang stehen (vgl. CA 35).
Die moderne Arbeitswelt ist gekennzeichnet durch Arbeitsteilung und Spezialisierung; ihre Verflochtenheit ist für viele kaum überschaubar zu machen. Dem einzelnen Menschen im Arbeitsprozeß fehlt es oft an entsprechendem Spezialwissen. Ihm wird man in seiner personalen Würde nur gerecht, wenn es ihm ermöglicht wird, Zusammenhänge so zu durchschauen, daß er bestimmte Sachzwänge zu akzeptieren vermag. Entscheidend ist nicht allein die objektiv richtige Ordnung, die angemessene Struktur, es bedarf auch der Einsicht in Zusammenhänge und der Bildung eines entsprechenden Bewußtseins.
Zur humanen Gestaltung des Arbeitsvollzugs gehört auch, daß der Umfang der Arbeit dem Bedürfnis des Menschen nach Freizeit gerecht wird.
Die Würde der Arbeit verlangt ferner, daß Unternehmen und Betrieb in erster Linie eine Personalgemeinschaft sind. Arbeit und Kapital als Produktionsfaktoren stehen sich nicht als anonyme Kräfte gegenüber. Auf der einen Seite stehen diejenigen, welche die Arbeit verrichten, ohne Eigentümer der Produktionsmittel zu sein, auf der anderen Seite jene, welche die Rolle des Unternehmers innehaben und entweder selbst Eigentümer oder deren Vertreter sind. Das hat Auswirkungen auf die Art und Weise, wie man Unternehmen begreift: nicht nur als technisch-wirtschaftlichen Apparat oder als Kapitalgesellschaft, sondern in erster Linie als Personenverband, in dem die Menschen, die jeweils hinter beiden Faktoren Arbeit und Kapital stehen, sich gegenseitig respektieren. Jeder Arbeitende soll Partnerschaft und Teilhabe erleben. Damit sind an alle mit Führungsaufgaben betrauten Personen hohe Anforderungen an ihren persönlichen Führungsstil gestellt. Ebenso sind die für die Wahrung der Betriebsverfassung zuständigen Personen gehalten, die gesetzlich vorgeschriebenen und weitere Verwirklichungsformen der Mitbestimmung in personellen, sozialen und wirtschaftlichen Angelegenheiten mit Leben zu erfüllen.
Bei aller Bereitschaft zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit und trotz aller Gemeinsamkeit bestehen in Betrieb und Unternehmen auch unterschiedliche Interessen. Zudem spielen auch größere Zusammenhänge des Marktes und der dort geltenden Steuerungsmechanismen eine Rolle. Es ist deshalb erforderlich, die Rechte und Ziele aller Beteiligten in entsprechenden Gesetzen zur Betriebs- und Unternehmensverfassung rechtlich zu klären.
- Im Arbeitsvollzug ist einer möglichst freien Entfaltung der Persönlichkeit des arbeitenden Menschen Rechnung zu tragen.
- In der Betriebsstruktur (Arbeiter, Angestellte, Führungskräfte, Unternehmer) ist auszuschließen, daß über Arbeitnehmer einseitig verfügt wird.
- In der Arbeitstechnik ist dafür zu sorgen, daß den Arbeitnehmern kein vermeidbares gesundheitliches Risiko zugemutet wird.
- Im Verhältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer darf die funktionsbedingte Unterordnung des Arbeitnehmers nicht zur personalen Unterordnung führen.
- Im Unternehmen muß bei Anerkennung unterschiedlicher Verantwortungsgrade und unterschiedlicher Anordnungs- und Kontrollbefugnisse ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen Arbeitnehmern, Führungskräften und Unternehmern gewahrt bleiben.
- Bei betrieblichen Entscheidungen sind die Mitarbeiterinteressen, die betrieblichen Interessen und die gesamtgesellschaftlichen Belange (zum Beispiel der Umweltschutz und die Vermeidung einer Gefährdung durch die hergestellten Produkte) zu berücksichtigen und optimal zum Ausgleich zu bringen, ohne daß sich die Entscheidungsprozesse unnötig verzögern.
- Im Unternehmen muß unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Aufgaben der einzelnen die aktive Beteiligung aller an der Unternehmungsgestaltung vorangebracht werden.
- Wo Entscheidungen über wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten an höheren Stellen getroffen werden, sollen die Arbeitnehmer auch daran beteiligt sein, sei es unmittelbar, sei es durch frei gewählte Vertreter.
In diesem Zusammenhang gewinnen jene Anregungen der katholischen Soziallehre besondere Bedeutung, die "das Miteigentum an den Produktionsmitteln, die Mitbestimmung, die Gewinnbeteiligung, die Arbeitnehmeraktien und ähnliches" (LE 14) betreffen.
Ein wesentlicher Ausdruck für die Wertschätzung der Arbeit und des arbeitenden Menschen ist der gerechte Lohn für die geleistete Arbeit. Der Lohn ist "der konkrete Weg" (LE 19), über den die Menschen Zugang zu den Gütern erhalten, die ihnen grundsätzlich nach Gottes Willen zur Verfügung stehen sollen. Er ist auch eine wesentliche Quelle, mit deren Hilfe der Mensch in selbstverantworteter Entscheidung gemeinwohlorientiert handeln kann.
3.5. Koalitionsrecht, Streik und Aussperrung
In der modernen Wirtschaft und Gesellschaft richten sich viele Bemühungen auf die Gewährleistung von Rechten: das Recht auf angemessenen Lohn für geleistete Arbeit sowie auf Freizeit und Erholung, auf Ruhestands- und Altersbezüge, auf humane Arbeitsbedingungen und Produktionsverfahren, auf Mitwirkung in Betrieb und Unternehmen. Daran, wie diese Rechte gewährleistet und ausgefüllt werden und wie die Arbeit selbst ausgeführt wird, entscheidet sich zu einem erheblichen Teil, in welchem Maße in einem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen System Gerechtigkeit verwirklicht wird.
Ein grundlegendes Recht der menschlichen Person ist das Recht der arbeitenden Menschen, in voller Freiheit Organisationen zu gründen, die ihre Belange vertreten und ihnen ermöglichen, einen wirksamen Beitrag zur Gestaltung des Wirtschaftslebens zu leisten. Es muß gewährleistet sein, daß sie sich in diesen Organisationen frei betätigen können, ohne Gefahr zu laufen, deswegen Nachteilen ausgesetzt zu sein (vgl. GS 68). Es ist das Recht des einzelnen Arbeitnehmers und Arbeitgebers, sich in Koalitionen (Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände) zu organisieren. Dieses Koalitionsrecht garantiert den Tarifverbänden das Recht und die Freiheit, im Prozeß freiheitlicher Interessenauseinandersetzung und Interessenausgleichung das Arbeitsleben zu ordnen und zu befrieden.
Mittel zur koalitionsrechtlichen Einigung ist der Tarifvertrag. Die Tarifautonomie ist verfassungsrechtlich garantiert. Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine absolute Autonomie. Der Staat hat als Garant des Gemeinwohls zum Beispiel darüber zu wachen, daß sich die Tarifpartner in leistungsstarken Branchen oder Gebieten nicht auf Kosten der Leistungsschwachen einigen. Die Partner müssen sich bei ihren Verhandlungen und Vereinbarungen ihrer allgemeinen Auswirkungen und damit der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung bewußt sein.
Durch die Rahmen- und Entgeltabkommen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen werden Wirtschaft und Gesellschaft im Bereich der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen in einem hohen Maß geregelt und geordnet. Dazu ist sowohl die rechtlich organisatorische Gleichberechtigung als auch das gesellschaftliche Gleichgewicht der Tarifpartner notwendig; weder die Arbeitnehmer und ihre Gewerkschaften dürfen der Arbeitgeberseite noch diese der Arbeitnehmerseite die Arbeits- und Lebensbedingungen diktieren können. Beide Seiten müssen in der Lage sein, die je eigenen Interessen wirksam zu vertreten und eine für beide Seiten wie für die Allgemeinheit verantwortbare Lösung zu finden. Diese darf niemals auf Kosten Dritter zustande kommen. Sie muß unter Berücksichtigung der Situation immer auch den Erfordernissen der sozialen Gerechtigkeit und des Gemeinwohls entsprechen.
Wo es durch den Gegensatz wirtschaftlicher und sozialer Interessen zu kämpferischen Auseinandersetzungen (Streik, Aussperrung) zu kommen droht, sind zunächst alle Bemühungen darauf zu richten, eine Verhandlungslösung zu finden. Erst nach vergeblichen Einigungs- und Schlichtungsversuchen sind gleichsam als "letztes Mittel" - unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit des Arbeitskampfmitteleinsatzes - Arbeitskampfmaßnahmen offen zu halten.
Der Streik gilt unter heutigen Verhältnissen als letzter Ausweg, um Rechte der Arbeitnehmer zu verteidigen oder berechtigte Forderungen durchzusetzen. Ein gerechtfertigter und rechtmäßiger Streik hat bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen: Die Forderungen müssen auf keinem anderen Wege durchsetzbar sein; der Streik darf kein solches Ausmaß annehmen, daß unentbehrliche Dienstleistungen nicht mehr gewährleistet werden können, Dritte in ungebührlicher und erpresserischer Weise betroffen werden oder die Existenz von Unternehmen beziehungsweise ganzer Wirtschaftszweige gefährdet werden.
Auch die Aussperrung unterliegt in analoger Weise sittlichen und rechtlichen Grenzen. Sie muß - als Gegenmaßnahme zum Streik - dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Mittel entsprechen und darf nie das Ziel verfolgen, den anderen Vertragspartner durch Machtmittel auszuschalten.
Zu Recht kann gefragt werden, ob in hochentwickelten Industriegesellschaften mit einem breitausgebauten individuellen und kollektiven Arbeitsrecht Streik und Aussperrung noch angemessene Formen des Arbeitskampfes sind oder nicht durch ein von beiden Seiten kündbares Friedensabkommen oder ähnliche Schlichtungsformen abgelöst werden könnten.
Aufgabe der Gewerkschaften wie der Unternehmerverbände ist die Verteidigung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder. Wo sie sich für die Rechte ihrer Mitglieder einsetzen, müssen sie die allgemeine soziale und wirtschaftliche Situation berücksichtigen und dementsprechend jenen Beschränkungen Rechnung tragen, die die allgemeine Wirtschaftslage des Landes auferlegt. Dabei sollen sie dort, wo politisch intakte Strukturen bestehen, nicht mit Hilfe des Arbeitskampfes politische Ziele durchsetzen wollen.
Obwohl alle am Produktionsprozeß beteiligten Menschen in bestimmter Hinsicht am Erfolg ihres jeweiligen Unternehmens interessiert sind, bedeutet das keinesfalls, daß Vereinigungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern heute überflüssig sind. Entsprechende Organisationen auf beiden Seiten des Arbeitsmarktes sind aufgrund historischer und heutiger Erfahrungen als ein unentbehrliches Element des sozialen Lebens anzusehen.
Solche Organisationen sind nicht Träger eines angeblich unausweichlichen Klassenkampfes, sondern einer echten Solidarpartnerschaft. Gewerkschaften, die sich für die wirtschaftlichen Ansprüche der Arbeitnehmer einsetzen, führen keinen Kampf gegen andere, sondern nehmen teil am Kampf für die soziale Gerechtigkeit (LE 20). Insofern sind sie ebenso wie die Arbeitgeberverbände ein positiver Faktor der sozialen Befriedung und der Solidarität.
3.6. Recht auf unternehmerische Initiative
Ihrer christlichen Berufung folgen Arbeitnehmer, Unternehmer, Anteilseigner oder Manager, "wenn sie verantwortungsbewußt handeln und nach dem Gemeinwohl streben" (Gerechtigkeit für alle. Wirtschaftshirtenbrief der amerikanischen Bischöfe, 117).
Wirtschaftliche Initiative und unternehmerische Tätigkeit sind eine Form der geordneten und schöpferischen menschlichen Arbeit.
Der Mensch verwirklicht sich durch Gebrauch seines Verstandes und seiner Freiheit und übernimmt dabei in seiner Arbeit als Gegenstand und Werkzeug die Dinge dieser Welt und eignet sie sich an. In diesem Tun des Menschen hat das Recht auf wirtschaftliche Initiative seinen Grund (vgl. CA 43,3). Dieses Recht ist zu schützen als ein "Grundrecht der Person". Es dient sowohl der Entfaltung des einzelnen als auch dem Gemeinwohl.
Die Fähigkeit, sowohl die Bedürfnisse der anderen Menschen rechtzeitig zu erkennen als auch die Kombination geeigneter Produktionsverfahren zu deren Befriedigung zu finden, die Fähigkeit also, einen entsprechenden Produktionsprozeß zu organisieren, zu planen und dafür zu sorgen, daß er der Befriedigung der Bedürfnisse ökonomisch optimal entspricht, "ist eine bedeutende Quelle des Reichtums in der modernen Gesellschaft" (CA 32).
Die Tatsache, "daß in der heutigen Welt unter anderen Rechten oft das Recht auf unternehmerische Initiative unterdrückt wird", ist eine nicht zu unterschätzende Ursache von Unterentwicklung und Rückständigkeit. Denn die Erfahrung lehrt uns, daß die Leugnung eines solchen Rechts und seine Einschränkung im Namen einer angeblichen Gleichheit aller in der Gesellschaft tatsächlich den Unternehmungsgeist, das heißt die Kreativität des Bürgers als eines aktiven Subjekts, lähmt oder gar zerstört. Als Folge entsteht auf diese Weise nicht so sehr eine Gleichheit als vielmehr eine Niveausenkung. Anstelle von schöpferischer Eigeninitiative kommt es zu Passivität, Abhängigkeit und Unterwerfung unter den bürokratischen Apparat, der als einziges verfügendes und entscheidendes - wenn nicht sogar besitzendes - Organ der gesamten Güter und Produktionsmittel alle in eine Stellung fast völliger Abhängigkeit bringt, die der traditionellen Abhängigkeit des Arbeiterproletariats im Kapitalismus gleicht (vgl. SRS 15,2).
Die Funktion des Unternehmers verlangt von der Person neben der Fähigkeit, Organisation in Solidarität zu erstellen, und dem Vermögen, das Bedürfnis des anderen wahrzunehmen und zu befriedigen, wichtige Tugenden wie Fleiß, Umsicht beim Eingehen zumutbarer Risiken, Zuverlässigkeit und Treue in den zwischenmenschlichen Beziehungen, Festigkeit bei schwierigen und schmerzvollen, aber für die Betriebsgemeinschaft notwendigen, sozialverträglichen Entscheidungen und bei der Bewältigung etwaiger Schicksalsschläge (vgl. CA 32).
Wirtschaftliche Entscheidungen fallen unterschiedlich aus. Die Entscheidung des Unternehmers, lieber an diesem als an jenem Ort, lieber in diesem und nicht in einem anderen Sektor zu investieren, ist immer auch eine moralische und kulturelle Entscheidung. Unumgängliche wirtschaftliche Bedingungen und politische Stabilität vorausgesetzt, wird die Entscheidung zu investieren, das heißt, einem Volk die Chance zu geben, seine eigene Arbeit zu verwerten, auch von einer Haltung der Sympathie und von dem Vertrauen in die Zukunft bestimmt. Gerade darin kommt die menschliche Qualität dessen zum Vorschein, der die Entscheidung trifft (vgl. CA 36,4).
Dabei ist anzuerkennen, "daß die Art und Weise, wie die Unternehmer der Gesellschaft dienen, von Anreizen des Steuersystems, von der Verfügbarkeit über Kredite und von anderen Maßnahmen bestimmt und begrenzt wird" (Gerechtigkeit für alle. Wirtschaftshirtenbrief der amerikanischen Bischöfe, 117).
4. Sinn und Ordnung des Eigentums
4.1. Formen des Eigentums
Um mit dem Eigentum sachgemäß umzugehen, muß man wie bei der Arbeit unterschiedliche Formen des Eigentums unterscheiden. In der modernen Gesellschaft gibt es eine Vielfalt von Eigentumsformen:
- Um leben zu können, benötigt der Mensch einen erheblichen Teil seines Einkommens für Güter des täglichen Verbrauchs wie Lebensmittel, Kleidung usw. Sie gelten als Verbrauchseigentum.
- Als Gebrauchseigentum werden dauerhafte Gebrauchsgüter bezeichnet wie etwa Wohnungseinrichtung, Auto usw.
- Eine für viele Menschen wichtige Art des Eigentums ist das Grundeigentum, wozu auch das Eigenheim oder die Eigentumswohnung gehört.
- Aus finanziellen Rücklagen entsteht das Geldeigentum in Form von Sparkapital (Kontensparen, Bausparen, Lebensversicherung als Sparform, Unternehmensanteile usw.).
- Der Mensch will sich durch Vorsorge gegen elementare Risiken wie Krankheit, Unfall, Invalidität, Alter absichern. Das geschieht in der modernen Gesellschaft für die meisten Arbeitnehmer durch eine besonders wichtige Eigentumsart: die Sozialversicherung.
- Eine weitere Form von Eigentum entsteht durch Abgaben in der Form von Steuern an die "öffentliche Hand", die damit alle notwendigen oder nützlichen Gemeinschaftseinrichtungen finanziert wie Straßen, Schulen, Krankenhäuser. Es besteht dann ein Anspruch, diese kostenlos oder kostengünstig zu nutzen. Insofern es hier um Rechtsansprüche auf öffentliche Leistungen geht, kann man von indirektem Eigentum an öffentlichen Gütern sprechen.
- Um alle diese Güter und Dienstleistungen zu erbringen, sind Produktionsmittel nötig: Industrieanlagen, Kommunikationsmittel, Verfahrenstechniken, Transportmittel. Diese werden als Produktivkapital oder investiertes Eigentum bezeichnet. Sie stellen in einer modernen Wirtschaft eine besonders wichtige Form des Eigentums dar.
- Als besondere Form von Eigentum kommt dem Besitz von Wissen, Technik und Können zunehmend große Bedeutung zu. Der Reichtum der Industrienationen beruht zu einem nicht geringen Teil auf dieser Eigentumsart. Deshalb gehört auch das geistige Eigentum zum Produktivkapital im weiteren Sinn. Patentrechte an eigenen Erfindungen oder Veröffentlichungsrechte an wissenschaftlicher Literatur, an musikalischen oder literarischen Werken und an Computerprogrammen gehören zum geistigen Eigentum des Urhebers.
4.2. Ordnung des Eigentums
Durch die ganze Geschichte ist bis heute immer wieder die Frage gestellt worden, ob es überhaupt ethisch gerechtfertigt sein könne, Eigentum zu besitzen und darüber nach Gutdünken zu verfügen. Die katholische Lehre vom Eigentum, die durch Thomas von Aquin systematisch entwickelt und in den Sozialenzykliken der Päpste weiter entfaltet wurde, enthält einige grundsätzliche Kernaussagen.
Der erste Grundsatz der katholischen Soziallehre über Eigentum besagt, daß die Güter der Erde für alle bestimmt sind. Gott hat die Erde mit allem, was sie enthält, für alle Menschen und alle Generationen geschaffen. Deshalb haben alle Menschen an den Gütern der Erde ein ursprüngliches Nutzungsrecht, von dem niemand ausgeschlossen werden darf.
Die Gemeinschaft hat dafür Sorge zu tragen, daß dem einzelnen mindestens jenes Maß an Nutzung dieser Güter gewährleistet wird, das ihm ein Leben in Würde ermöglicht.
Wer sich unverschuldet in äußerster Notlage befindet, hat das Recht, sich vom Reichtum anderer das Benötigte zu nehmen, falls die bestehende Eigentumsordnung nicht in der Lage ist, ihm in seiner Not zu helfen.
Der Grundsatz der Gemeinbestimmung der Güter legt das Sinn-Ziel jeder Eigentumsordnung fest. Er bestimmt aber noch nicht, wie eine Eigentumsordnung konkret zu gestalten ist. Es handelt sich hier um ein Rechtsprinzip, das aber keine Eigentumsordnung vorschreibt.
Der zweite Grundsatz der katholischen Soziallehre über das Eigentum besagt, daß das Eigentumsrecht jedem Menschen als persönliches Freiheitsrecht zukommt.
Das Recht auf Eigentum als persönliches Freiheitsrecht ist eine Stütze und zugleich ein Ansporn für die Ausübung von Freiheit (vgl. MM 109). Es dient dem Schutz der Würde und der Freiheit des Menschen und der Sicherung der Familie. Eigentum ist auch in der modernen Form des Produktivkapitals eine unerläßliche Voraussetzung für die wirtschaftliche Tätigkeit des Menschen.
Privateigentum oder ein gewisses Maß an Verfügungsmacht über äußere Güter vermittelt den nötigen Raum für die verantwortliche Gestaltung des persönlichen Lebens des einzelnen und seiner Familie; sie müssen als eine Art Verlängerung der menschlichen Freiheit betrachtet werden, denn sie regen zur Übernahme von Aufgaben und Verantwortung an und zählen so zu den Voraussetzungen staatsbürgerlicher Freiheit.
Ohne Privateigentum wird der Mensch in seiner Freiheit ungebührlich eingeschränkt. Wo die politische Ordnung dem einzelnen das Privateigentum nicht gestattet, wird auch die Ausübung der menschlichen Freiheit in wesentlichen Dingen eingeschränkt oder ganz aufgehoben (vgl. MM 109).
Das Eigentum als persönliches Freiheitsrecht darf aber nicht individualistisch verstanden werden. Da sich der Begriff Privateigentum leicht im Sinne eines nach eigenem Gutdünken zu gebrauchenden Eigentums mißverstehen läßt, ist der Begriff persönliches Eigentum vorzuziehen. Das christliche Personenverständnis sieht nämlich den einzelnen in seiner Selbständigkeit und sozialen Bindung zugleich.
Weil das Recht auf persönliches Eigentum immer der Gemeinbestimmung der Güter verpflichtet bleibt, kann es nie ein unbedingtes Recht sein. "Das Recht auf Privateigentum, das man sich selbst erarbeitet oder von andern geerbt oder geschenkt bekommen hat, hebt die Tatsache nicht auf, daß die Erde ursprünglich der ganzen Menschheit übergeben worden ist. Daß die Güter für alle bestimmt sind, bleibt vorrangig, selbst wenn das Gemeinwohl erfordert, das Recht auf und den Gebrauch von Privateigentum zu achten" (KKK 2403).
Ob die Gemeinbestimmung der Güter in konkreten Fällen durch Mißbrauch von Privateigentumsrechten verhindert wird oder ob bestimmtes Eigentum aus Gemeinwohlgründen besser nicht von Privateigentümern verwaltet werden sollte, muß im Einzelfall festgestellt werden. Die Entscheidung darüber liegt bei der Autorität, die für das Gemeinwohl Verantwortung trägt. Unter bestimmten Bedingungen ist Enteignung bestimmter Produktionsmittel nicht auszuschließen (vgl. GS 71,6; CA 43,3). Bei einer Abwägung darüber, ob unter bestimmten Umständen eine Enteignung oder eine Begrenzung des Eigentums dem Gemeinwohl mehr dient, ist davon auszugehen, daß persönliches Eigentum zwar prinzipiell den Vorrang hat, aber eine Enteignung oder Begrenzung nicht ausschließt.
Bei ungerechtfertigter Enteignung bleibt der Rechtsanspruch auf Rückgabe des Eigentums bestehen. Würden sich in einer gesellschaftlich veränderten Lage dadurch jedoch schwere Nachteile für den jetzigen Besitzer ergeben, der den Besitz "in gutem Glauben" als Eigentum erworben hat, oder würden durch die Rückgabe an den früheren Eigentümer schwere Nachteile für das Gemeinwohl (zum Beispiel durch Behinderung von notwendigen Investitionen) entstehen, so wäre abzuwägen, ob Rückgabe oder Entschädigung in Betracht käme. Bei einer Entschädigung müßte es sich um eine angemessene Entschädigung (Verkehrswert) handeln.
Der dritte Grundsatz der katholischen Soziallehre über das Eigentum besagt, daß niemand das Recht hat, die Güter ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse der Mitmenschen zu gebrauchen oder gar zu vernichten. Es gibt eine Sozialbindung (Sozialpflichtigkeit) des Eigentums; auf dem Eigentum liegt eine unauslöschbare soziale Hypothek (vgl. SRS 42). So haben zum Beispiel Eigentümer von Produktivkapital die Pflicht, es bereitwillig und verantwortungsbewußt einzusetzen. Es besteht auch die Pflicht, vom eigenen Überfluß den Notleidenden zu geben. Auf diese Weise wurde in der mittelalterlichen Gesellschaft auf dem Weg des Almosengebens ein nicht geringer Teil der Bevölkerung versorgt. Heute wird die Sozialbindung des Eigentums weitgehend durch eine progressiv mit dem Einkommen steigende Besteuerung verwirklicht. Der einzelne kann seine Sozialverpflichtung nicht durch Almosen ableisten, sondern hat einen genau festgesetzten Anteil an die Gemeinschaft abzuliefern. Über diese Verpflichtung hinaus besteht aber auch weiterhin die Solidaritätspflicht, den Notleidenden zu helfen. Das Motiv hierfür ist die vorrangige Liebe für die Armen.
5. Sittliche Einzelaufgaben wirtschaftlichen Verhaltens
5.1. Der rechte Umgang mit Konsumgütern
In früheren Zeiten beschränkte sich die wirtschaftliche Tätigkeit des Menschen im wesentlichen darauf, seine bescheidenen Bedürfnisse zu befriedigen. Heute besteht die Aufgabe der Wirtschaft nicht mehr nur darin, eine ausreichende Menge an Gütern anzubieten, sondern auch dafür zu sorgen, daß die Qualität der zu erzeugenden und zu konsumierenden Güter, der beanspruchten Dienste und des Lebens überhaupt verbessert wird. Da diese Entwicklung auch zu einem übersteigerten Konsumbedürfnis führen kann, sind die Konsumgewohnheiten und Lebensstile stets neu zu überdenken. Die Entdeckung neuer Bedürfnisse und neuer Möglichkeiten zu ihrer Befriedigung muß geleitet sein von einem Menschenbild, nach dem die materiellen und triebhaften den inneren und geistigen Interessen in rechter Weise zugeordnet sind (vgl. CA 36).
Ein Wirtschaftssystem besitzt in sich selber keine Maßstäbe, die es erlauben, notwendige und nützliche von künstlich erzeugten und nicht in jedem Fall dem Menschen dienlichen Bedürfnissen zu unterscheiden. Es ist Aufgabe der Menschen, das herauszufinden und ein verantwortliches Verbraucherverhalten zu entwickeln. Hierbei ist auch von den Produzenten und den Trägern der Kommunikationsmittel ein hohes Maß an Verantwortung gefordert. Wo die Gefahr eines selbstzerstörerischen Konsumismus droht, kann auch ein Eingreifen staatlicher Behörden notwendig werden (vgl. CA 36).
5.2. Schutz wirtschaftlicher Rechte anderer
Das siebte und zehnte Gebot richtet sich auf den Schutz des Eigentums. Es verlangt die Respektierung fremden Eigentums, die Bereitschaft, den Nächsten vor Schaden zu bewahren und seine Eigentumsrechte zu schützen. Der einzelne wie die Gesellschaft ist verpflichtet, sich an die Verbote zu halten, die die wirtschaftlichen Rechte des Nächsten schützen. Dazu gehören insbesondere:
- das Verbot des Diebstahls: Beim Diebstahl spielen unterschiedliche Motive eine Rolle: Macht, Geltungsbedürfnis, krankhafter Hang, Neid, Habgier, Genußsucht, Egoismus. Vielfach verliert Diebstahl in der heutigen Einschätzung den Stachel eines Vergehens und wird zum Kavaliersdelikt; Absichten und Pläne gegen die wirtschaftliche Existenz des Mitmenschen, legale und illegitime Eigentumsverletzungen gehören zur Alltagserfahrung im Wirtschaftsleben. Die sittliche und rechtliche Verpflichtung, daß Gestohlenes zurückerstattet werden muß, kommt vielfach erst gar nicht in den Blick.
- das Verbot der Beschädigung fremden Eigentums: Nicht nur die Aneignung, sondern auch die Zerstörung von Eigentum schadet dem Nächsten. Sie richtet sich nicht nur gegen Sachen, sondern stellt einen Einbruch in die Rechtssphäre der Person dar, denn das Eigentumsrecht ist letztlich eine Verlängerung der Personrechte in die Sachwelt hinein. In dem Unrecht, das dem Mitmenschen zugefügt wird, liegt der eigentliche Kern des Vergehens. Unsachgemäße und fahrlässige Behandlung von Maschinen und Einrichtungen am Arbeitsplatz gehört deshalb ebenso zum siebten und zehnten Gebot wie der Diebstahl.
- das Verbot betrügerischer Handlungen: Eine widerrechtliche Aneignung oder Schädigung fremden Eigentums geschieht oft (unter dem Schein des Rechtes) durch Betrug. Dieser reicht von Urkundenfälschung über Unterschlagung und Veruntreuung über alle Formen der Übervorteilung bis hin zu den unterschiedlichsten Arten des unlauteren Wettbewerbs.
Die sittliche Verpflichtung zur Achtung wirtschaftlicher Rechte anderer verlangt, daß der zugefügte Schaden möglichst wiedergutzumachen ist.
5.3 Achtung des geistigen Eigentums
Die Achtung materieller Güter schließt auch die Verpflichtung ein, geistiges Eigentum anderer zu wahren. Gemeint ist damit der Schutz jener Rechte, die ein Mensch auf Grund einer Urheberschaft erworben hat. Patentrechte und Veröffentlichungsrechte an literarischen oder wissenschaftlichen Abhandlungen dürfen nicht ohne Zustimmung des Eigentümers genutzt werden. Der Verstoß gegen den Schutz des geistigen Eigentums umfaßt zum Beispiel die Anfertigung von Raubkopien, um den Kauf von Büchern oder Zeitschriften zu sparen, sowie das unberechtigte Kopieren von Computerprogrammen.
Mehr als materieller Besitz bedeutet geistige Bildung oft einen großen Reichtum. Es ist Pflicht jedes Menschen, sich seiner Fähigkeit entsprechend aus- und weiterzubilden; es ist darüber hinaus aber auch die Pflicht der Gesellschaft, jedem bildungswilligen und bildungsfähigen Menschen die notwendige Unterstützung zu sichern
5.4. Verpflichtung gegenüber gesellschaftlichem Eigentum
Wie das persönliche Eigentum ist auch das gesellschaftliche Eigentum zu achten. Die Verletzung persönlichen und gesellschaftlichen Eigentums darf nicht nach unterschiedlichen Maßstäben bemessen werden. Das gilt sowohl für materielles als auch für geistiges Eigentum. Deshalb ist jeder Versuch, aus dem System der sozialen Sicherung in ungerechtfertigter Weise persönlichen Vorteil zu ziehen, unsittlich, denn er geht zu Lasten anderer und untergräbt das gesamte System. Auch Versicherungsbetrug, Steuerhinterziehung und Zollhinterziehung sind unrechtliches Verhalten gegenüber dem einzelnen wie gegenüber der Gesellschaft. Ähnliches gilt für Organisationen, die Spendengelder widerrechtlich an der Steuer vorbeimanövrieren, wie für Geschäftsleute und Handwerker, die Dienstleistungen gelegentlich ohne Originalrechnung erbringen oder gegen außenwirtschaftliche Verbote verstoßen.
Auch das Benutzen öffentlicher Verkehrmittel ohne Fahrschein, die unsachgemäße Behandlung öffentlicher Einrichtungen, Beschädigung und Zerstörung öffentlicher Anlagen und Gebäude sind Verfehlungen gegen gesellschaftliches Eigentum.
5.5. Beachtung der ökologischen Verträglichkeit
In unserer Zeit besteht die Gefahr, daß der Mensch die Ressourcen der Erde verbraucht und dadurch selbst ihre Existenz bedroht (vgl. CA 37).
Es ist erforderlich, die ökologischen Folgen aller wirtschaftlichen Prozesse (Produktion, Verteilung, Konsum) zu bedenken. Da unbeschränkter Verbrauch von Luft, Wasser und Boden nicht nur die Lebensgrundlagen der jetzigen, sondern auch der kommenden Generationen gefährdet, ist die ökologische Verträglichkeit als wirtschaftspolitisches Ziel einzufordern. Daher müssen die reichen Industriestaaten den Entwicklungsländern die Kosten für die Umweltmaßnahmen ersetzen, von denen sie selber profitieren (zum Beispiel die Erhaltung des tropischen Regenwaldes).
5.6. Aufbau einer weltweiten sozialen Gerechtigkeit
Gott hat die Erde mit allem, was sie enthält, zum Nutzen aller Menschen und Völker bestimmt. Deshalb sind die Güter der Erde in einer Weise zu erschließen und zu verteilen, daß alle Menschen menschenwürdig leben können (vgl. auch KKK 2426).
Die Frage nach einer ausreichenden Produktion und gerechten Verteilung der Güter stellt sich innerhalb jedes Landes und weltweit. Die weltwirtschaftlichen Beziehungen zwischen Völkern und Staaten haben sich in der letzten Zeit zunehmend verdichtet und erweitert. Es gibt kaum ein Volk, das nicht auf dem Weltmarkt Güter und Dienstleistungen anbietet und die Angebote anderer in Anspruch nimmt. In neuerer Zeit hat das arbeitsteilige Zusammenwirken der verschiedenen Wirtschaftszweige, der Völker und Erdteile dazu beigetragen, daß der materielle Lebensstandard insgesamt gehoben werden konnte. Aber nicht für alle Menschen hat sich die Lebenssituation verbessert. Während auf der einen Seite ein erheblicher Teil der Bevölkerung im Überfluß lebt, fehlt heute über einer Milliarde von Menschen das Notwendigste, um auch nur ihre Grundbedürfnisse befriedigen zu können.
Diese Ungleichheit der Lebensumstände verlangt von allen eine größere Solidarität mit den Benachteiligten und ein Handeln, bei dem der Stärkere den Schwächeren gerecht behandelt und für ihn mitsorgt, damit dieser ein Leben in Würde zu führen vermag.
Als grundlegendes moralisches Kriterium für alle wirtschaftlichen Entscheidungen, politischen Maßnahmen und Institutionen gilt die vorrangige Option für die Armen: Wirtschaftliche Entscheidungen und politische Maßnahmen müssen allen Menschen dienen, vor allem aber den Armen. Es ist immer darauf zu achten, was die jeweiligen wirtschaftlichen Entscheidungen für die Armen bewirken, was sie ihnen an Schaden zufügen und inwieweit sie dazu beitragen, daß die Armen in die Lage versetzt werden, sich selbst zu helfen.
Die enge Verbundenheit der Menschheit, die gegenseitige Abhängigkeit aller Menschen und aller Völker fordert eine Solidarität aller Menschen mit den jetzigen und den kommenden Generationen. Es geht darum, gemeinsam "eine Welt in Wahrheit und Gerechtigkeit" (GS 55) aufzubauen.
Die Völkergemeinschaft soll ihren wirtschaftlichen Beziehungen eine Ordnung geben, die den heutigen sozialen Aufgaben entspricht. Grundprinzipien für den Aufbau einer solchen Ordnung internationaler Wirtschaftsbeziehungen sollen die besondere Berücksichtigung des Wohles der schwächeren und ärmeren Nationen, Gerechtigkeit und Entwicklung für die Benachteiligten sein. Ziel ist eine Zusammenarbeit von Partnern, die ein möglichst weitgehendes Maß an Gleichheit der Chancen haben.
Die Industrieländer dürfen nicht Handel treiben, ohne sich um die Auswirkung ihrer Wirtschaftspolitik auf die ärmeren Länder zu kümmern. Es ist ihre Aufgabe, ihre positiven wie negativen Rückwirkungen auf die anderen Mitglieder der internationalen Gemeinschaft zu beurteilen und sie abzuändern, falls sie zu negativen Folgen für die anderen, insbesondere für die ärmsten Länder führen. Die stärkeren Nationen "müssen den schwachen Gelegenheiten zur Eingliederung in das internationale Leben anbieten, und die schwachen müssen in der Lage sein, diese Angebote aufzugreifen" (CA 35).
Auch den Entwicklungsländern kommen Aufgaben im wirtschaftlichen und politischen Bereich zu. Sie müssen "Anstrengungen und Opfer aufbringen, indem sie die politische und wirtschaftliche Stabilität, die Sicherheit für die Zukunft, die Förderung der Fähigkeiten der eigenen Arbeiter, die Ausbildung leistungsfähiger Unternehmer, die sich ihrer Verantwortung bewußt sind, gewährleisten" (CA 35). Einige Nationen werden ihre Nahrungsmittelproduktion steigern müssen, um stets das Notwendige für die Ernährung und zum Leben zur Verfügung zu haben und mit der Zeit wenigstens das Ziel der Selbstversorgung in der Ernährung zu erreichen. Andere Nationen werden zunächst die Reform ungerechter wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Strukturen und politischer Institutionen im eigenen Land einleiten müssen, um eine demokratische Ordnung einzuführen. Neue Formen der Zusammenarbeit innerhalb der Nationen derselben geographischen Zone sind ebenso erforderlich wie eine gerechtere Verteilung des Reichtums innerhalb der einzelnen betroffenen Gesellschaften (vgl. SRS 44, 45 und 14).
Auf den diesbezüglichen Initiativen und Anstrengungen, die heute seitens der Industrienationen wie der Entwicklungsländer selbst unternommen werden, lastet das weitgehend ungelöste Problem der Auslandsverschuldung der ärmsten Länder. Der Grundsatz, daß Schulden gezahlt werden müssen, ist sicher richtig. Es ist jedoch nicht erlaubt, eine Zahlung einzufordern oder zu beanspruchen, die ganze Völker in Hunger und Verzweiflung treiben würde. "Man kann nicht verlangen, daß die aufgelaufenen Schulden mit unzumutbaren Opfern bezahlt werden. In diesen Fällen ist es notwendig - wie es übrigens teilweise schon geschieht -, Formen der Erleichterung der Rückzahlung, der Stundung oder auch der Tilgung der Schulden zu finden, Formen, die mit dem Grundrecht der Völker auf Erhaltung und Fortschritt vereinbar sind" (CA 35,5).
Alle diese Aufgaben können nur in gemeinsamer Anstrengung von Industrie- und Entwicklungsländern angegangen werden. Die weltwirtschaftlichen Bedingungen sind durch Verhandlungen und Verträge so zu gestalten, daß sie von allen beteiligten Partnern akzeptiert werden können. Dazu sind bilaterale, multilaterale und globale vertragliche Vereinbarungen notwendig.
Die Menschheit braucht heute, "angesichts einer neuen und schwierigen Phase ihrer echten Entwicklung, für den Dienst an den Gesellschaften, den Wirtschaften und Kulturen der ganzen Welt einen höheren Grad internationaler Ordnung" (SRS 43). Entsprechende Erwartungen richten sich auf weltwirtschaftliche Beziehungen und rechtsverbindliche Vereinbarungen, die es allen Völkern erlauben, am Reichtum der Güter in sozial gerechter Weise teilzuhaben und so ihr Geschick selbst in die Hand zu nehmen. Dazu ist auch die Errichtung internationaler Instanzen notwendig, die die Einhaltung einzelner Regelungen durchsetzen können.
5.7. Begrenzung des Wachstums der Weltbevölkerung
Ein heute immer stärker ins Bewußtsein tretendes Problem ist das Weltbevölkerungswachstum. Der größte Teil des Zuwachses entfällt auf die "dritte Welt". Viele Entwicklungsländer sehen sich dadurch vor gewaltige Probleme gestellt: Die Entwicklungsfortschritte können nicht Schritt halten mit dem Wachstum der Bevölkerung, so daß die Zahl der Armen weiter ansteigt; der Trend zur Entstehung von Megastädten mit ihren riesigen Slums hält an; der Raubbau an den natürlichen Lebensgrundlagen beschleunigt sich.
Angesichts dieser Situation ist die Versuchung groß, dem Problem mit einfachen Lösungen zu begegnen. Die Erfahrung der letzten Jahrzehnte hat jedoch gezeigt, daß alle Anstrengungen zu einer Begrenzung des Bevölkerungswachstums nur dann erfolgreich sein können, wenn sie die Ursachen des großen Kinderwunsches in den Entwicklungsgesellschaften berücksichtigen. Hier spielen zum großen Teil soziokulturelle Gründe eine Rolle, zum Beispiel die traditionelle Hochschätzung einer großen Kinderzahl, die Abhängigkeit der gesellschaftlichen Stellung der Frau von der Zahl ihrer Kinder und vieles mehr. Die wichtigste Ursache für den Wunsch vieler Menschen in der "dritten Welt" nach einer großen Nachkommenschaft besteht in der Armut. Armut - nicht zuletzt das Fehlen öffentlicher Systeme der sozialen Sicherung - ist nicht nur Folge, sie ist zugleich auch die wesentliche Ursache für ein Zeugungsverhalten, das im Zusammenspiel mit einer auch in den Entwicklungsländern gestiegenen Lebenserwartung das starke Ansteigen der Bevölkerungszahlen hervorruft.
Eine wirksame Begrenzung des Bevölkerungswachstums wird deshalb ohne eine entschlossene Bekämpfung der Massenarmut nicht gelingen können. Auf eine einprägsame Formel gebracht heißt das: Weniger Menschen durch weniger Armut, nicht: Weniger Armut durch weniger Menschen. Projekte der Familienplanung sollten darum möglichst in umfassende Entwicklungsprogramme integriert werden, die zugleich Gesundheits- und Bildungsmaßnahmen einschließen und auf eine Stärkung der familiären und gesellschaftlichen Rolle der Frauen ausgerichtet sind.
Bei allen Programmen der Familienplanung ist das Recht der Eltern, frei, informiert und verantwortlich über der Zahl ihrer Kinder zu entscheiden, unbedingt zu achten. "Nach dem unveräußerlichen Menschenrecht auf Ehe und Kinderzeugung hängt die Entscheidung über die Zahl der Kinder vom rechten Urteil der Eltern ab und kann keinesfalls dem Urteil der staatlichen Autorität überlassen werden" (GS 87). Alle Maßnahmen, die mit direktem oder indirektem Zwang die Freiheit der Eltern einschränken wollen, sind deshalb abzulehnen. Andererseits umschließt das Menschenrecht auf Fortpflanzung auch die Information über die sozialen Bedingungen, unter denen die Eltern ihre Entscheidung zu treffen haben, ebenso wie die Aufklärung über die legitimen Methoden der Empfängnisregelung.
Die Kirche fordert in diesem Zusammenhang, den Unterschied zwischen Abtreibung und Empfängnisregelung strikt zu beachten.
Generell ist davon auszugehen, daß die Armen eher für eine Begrenzung der Kinderzahl gewonnen werden können, wenn sie den Eindruck gewinnen können, daß diejenigen, die ihnen den Verzicht auf einen großen Kinderreichtum empfehlen, damit nicht zuallererst ihren eigenen Interessen - der Verteidigung des eigenen materiellen Reichtums - dienen. Es muß stets deutlich werden: Das eigentliche Ziel aller Familienplanung besteht nicht darin, daß möglichst wenig Kinder geboren werden, sondern daß möglichst viele ein menschenwürdiges Dasein auf der Erde führen können.
6. Christlich verantwortete Wirtschaftsordnung
6.1. Notwendigkeit und Aufgaben der Wirtschaftsordnung
In der Wirtschaft geht es um die materiellen Grundlagen des menschlichen Daseins, also um die gesicherte und dauerhafte Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen. Von Anfang an zeigt sich in der menschlichen Kulturgeschichte das Phänomen der Arbeitsteilung. Heute sind Wirtschaft und Arbeitsteilung gleichzusetzen. Wir sprechen von der modernen, arbeitsteiligen Wirtschaft. Diese kann aber nur erfolgreich sein, wenn sie geordnet ist.
Die Wirtschaftsordnung umfaßt alle rechtlichen Rahmenbedingungen, innerhalb derer sich die wirtschaftlichen Prozesse in einer Gesellschaft vollziehen. Die Wirtschaftsordnung umfaßt somit verbindliche Regeln wirtschaftlichen Handelns und ist daher ein Teil der Rechtsordnung, deren Bildung und Durchsetzung Sache der Gemeinwohlautorität ist. Dabei ist von einem Gemeinwohlverständnis auszugehen, das die Rechte der Person beachtet, insbesondere die Prinzipien der Subsidiarität und Solidarität. Es geht hierbei um die Festlegung der Kompetenzen und Grenzen staatlichen Eingreifens in die Wirtschaft.
6.2. Liberalismus und Sozialismus
Eine ausdrückliche wissenschaftliche Reflexion über die Wirtschaftsordnung, ihre Gestalt, ihre Leistung und ihr Versagen gibt es erst seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, also seit dem Beginn der industriegesellschaftlichen Entwicklung. Seitdem wird die Frage nach einer menschengerechten Wirtschaft heftig diskutiert. Die beiden großen Gegenspieler waren dabei der Liberalismus und der Sozialismus. Während der Liberalismus das Prinzip der Freiheit auch in allen Bereichen der Wirtschaft vertrat und staatliches Eingreifen möglichst auf die Setzung einer allgemeinen Rechtsordnung beschränken wollte, verlangte der Sozialismus die Vergesellschaftung bzw. Verstaatlichung der gesamten Wirtschaft.
Die erste Sozialenzyklika "Rerum novarum", die sich mit diesen Fragen beschäftigte, kritisiert die frühkapitalistische Klassengesellschaft und den ihr zugrundeliegenden individualistischen Liberalismus und dessen ungenügendes Verständnis von den Aufgaben der staatlichen Gewalt.
Ebenso lehnt sie den marxistischen Sozialismus ab, da dieser ein falsches Menschenbild vertritt, das den Staat bzw. die Gesellschaft über die Person stellt, eigentumsfeindlich ist und eine Klassenkampftheorie propagiert, die im historischen Materialismus grundgelegt ist.
"Rerum novarum" zeichnet eine Richtung zur Lösung der sozialen Frage vor, bei der die Irrtümer und Einseitigkeiten der konkurrierenden Theorien vermieden werden. Die Industriegesellschaft wird grundsätzlich bejaht; der Grundwert der Freiheit auch im Bereich des Arbeitsvertrages respektiert, ebenso beim Recht auf Eigentum. Die vom Liberalismus vergessene, vom Sozialismus verfremdete Solidarität wird neben der Freiheit als die entscheidende Komponente einer menschenwürdigen Gesellschaft eingebracht.
Vierzig Jahre später befaßt sich die Sozialenzyklika "Quadragesimo anno" ausdrücklich mit der Wirtschaftsordnung. Dort wird festgestellt, die Wettbewerbsfreiheit könne unmöglich alleiniges regulatives Prinzip der Wirtschaft sein. Sie sei aber innerhalb der gehörigen Grenzen berechtigt und von zweifellosem Nutzen. Um ihren Nutzen wirklich zu stiften und eine Vermachtung der Wirtschaft (Monopolbildung) zu verhindern, bedürfe es freilich der kraftvollen Zügelung und weisen Lenkung durch die Gemeinwohlautorität. Die höheren und edleren Kräfte, welche die wirtschaftliche Macht in strenge und weise Zucht nehmen sollen, sind die soziale Gerechtigkeit und die soziale Liebe (QA 88).
6.3. Soziale Marktwirtschaft
In den vierziger Jahren unseres Jahrhunderts wurde in Deutschland eine Wirtschaftsordnung entworfen, die man später als die soziale Marktwirtschaft bezeichnete.
Die Enzyklika "Centesimus annus" begrüßt die Entwicklung, daß sich "in einigen Ländern . . . ein positives Bemühen zum Aufbau einer demokratischen Gesellschaft, die sich von sozialer Gerechtigkeit leiten läßt", durchsetzte. Dieses Bemühen "wird im allgemeinen durch die Methoden der freien Marktwirtschaft unterstützt" (CA 19,2).
Freiheit und soziale Gerechtigkeit sind die ethischen Grundlagen der sozialen Marktwirtschaft; Marktmechanismen und öffentliche Kontrolle sind ihre beiden grundlegenden Ordnungselemente. Gute Arbeitsmöglichkeiten, ein System sozialer und beruflicher Sicherheit und Überwindung des Warencharakters der Arbeit durch die arbeitsrechtliche Sicherung ihrer Würde sind die Hauptziele einer humanen Arbeitswelt. Stabile Währung, gesundes Wirtschaftswachstum und Sicherheit der sozialen Beziehungen sind weitere unverzichtbare Ziele der sozialen Marktwirtschaft. Als "magisches Fünfeck" gelten heute die marktwirtschaftlichen Ziele Preisstabilität, Vollbeschäftigung, volkswirtschaftliches Wachstum, außenwirtschaftliches Gleichgewicht und ökologische Verträglichkeit, die gleichzeitig unter Beachtung der Gerechtigkeitsprinzipien anzustreben sind.
An den Ereignissen der "Wende" des Jahres 1989 in mittel- und osteuropäischen Ländern im Machtbereich der ehemaligen UdSSR hat sich erwiesen, daß das kommunistische Wirtschafts- und Sozialsystem untauglich ist, die wirtschaftlichen und sozialen Belange der Menschen zu erfüllen. Auf die Frage, ob das Scheitern des Kommunismus auf einen Sieg des Kapitalismus hinauslaufe, antwortet die Enzyklika:
- "Wird mit ,Kapitalismus` ein Wirtschaftssystem bezeichnet, das die grundlegende und positive Rolle des Unternehmens, des Marktes, des Privateigentums und der daraus folgenden Verantwortung für die Produktionsmittel, der freien Kreativität des Menschen im Bereich der Wirtschaft anerkennt, ist die Antwort sicher positiv . . . Wird aber unter ,Kapitalismus` ein System verstanden, in dem die wirtschaftliche Freiheit nicht in eine feste Rechtsordnung eingebunden ist, die sie in den Dienst der vollen menschlichen Freiheit stellt und sie als besondere Dimension dieser Freiheit in ihrem ethischen und religiösen Mittelpunkt ansieht, dann ist die Antwort ebenso entschieden negativ." Im übrigen ist es jedoch passender, die positiv bewertete Variante des Kapitalismus anders zu bezeichnen und von "Unternehmenswirtschaft oder Marktwirtschaft oder einfach von freier Wirtschaft zu sprechen" (CA 42,2).
Aus alledem ergibt sich als Konsequenz, daß weder der liberalistische Kapitalismus noch der marxistische Kollektivismus angemessene Antworten auf die Frage nach einer menschengerechten Wirtschaftsordnung geben kann. In einer sozialen und ökologischen Marktwirtschaft sieht die katholische Soziallehre eine Wirtschaftsordnung, die durchaus ihren Vorstellungen entspricht. Die Kirche kann dabei nicht die konkrete Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik vorschreiben, sondern immer nur jene Werte und die mit ihnen notwendig verbundenen Institutionen und Grundhaltungen benennen, die eine soziale Marktwirtschaft braucht. Wie die einzelnen Kriterien inhaltlich und gesetzgeberisch näherhin umgesetzt werden, läßt sich nicht von vornherein sagen und hängt weitgehend auch von bestimmten historischen Gegebenheiten einer Gesellschaft ab.
VIII. Achtes Gebot: Du sollst kein falsches Zeugnis geben wider deinen Nächsten
Ich bin dein Gott, der dir Leben und Zukunft schenkt
Du sollst kein falsches Zeugnis geben wider deinen Nächsten
Gott will, daß wir zur Wahrheit stehen und niemandem durch Lügen Schaden zufügen.
1. Wahrheit und Wahrhaftigkeit in der Weisung des achten Gebotes
1.1. Der Wortlaut des achten Gebotes
Der Wortlaut des achten Gebotes ist in den beiden Dekalogfassungen des Alten Testamentes nahezu gleich. Im Buch Exodus lautet der Text: "Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen" (20,16). Im Buch Deuteronomium lautet er: "Du sollst nichts Falsches gegen deinen Nächsten aussagen" (5,20).
===== 1.2. Die ursprüngliche Bedeutung des achten Gebotes
Vom Wortlaut her geht es im achten Gebot um das Zeugnis vor Gericht. In der Frühzeit Israels war die Hauptform des Gerichts das Schiedsgericht, bei dem jede Partei ihre Rechtshelfer mitbrachte. Oft hing das Schicksal beschuldigter Menschen vom Zeugnis derer ab, die als Zeugen auftraten. Wenn zwei Zeugen gegen den Angeklagten aussagten, war sein Schicksal entschieden. Durch lügnerische Aussagen konnte der Beschuldigte seine Ehre, seine Freiheit und sogar sein Leben verlieren. Ein "Lügenzeuge" konnte somit schwere Blutschuld auf sich laden. Wurden Zeugen der Lüge überführt, so wurden sie mit der gleichen Strafe belegt, die für den Angeklagten vorgesehen war.
Das Rechtswesen war in Israel ein Grundpfeiler der Volksgemeinschaft. Den eigentlichen Hintergrund bildete der Bundesgedanke. Im Bund mit Jahwe sollte es für alle klar sein, daß falsches Zeugnis vor Gericht nicht nur ein Vergehen gegen den Nächsten war, sondern ein Bruch des Bundes. Das Gebot "Du sollst nichts Falsches gegen deinen Nächsten aussagen" sollte bedeuten: "Du wirst nicht Falsches gegen deinen Nächsten aussagen." Im Bund mit Gott sollte ein solches Vergehen ausgeschlossen sein. Es wäre Rückfall in die alte Knechtschaft, aus der Gott sein Volk befreit hat.
Das ist auch der Grund dafür, daß außer dem Dekalog eine Reihe gewichtiger Gesetzgebungstexte die gerechte Rechtsprechung durch die Richter zu sichern suchte (vgl. Ex 23,1-3.6-9; Dtn 16,19; Lev 19,15). Am intensivsten umschreibt das "Bundesbuch" (Ex 23) den gemeinten Tatbestand: "Du sollst kein leeres Gerücht verbreiten. Biete deine Hand nicht dem, der Unrecht hat, indem du als falscher Zeuge auftrittst. Du sollst dich nicht der Mehrheit anschließen, wenn sie im Unrecht ist, und du sollst in einem Rechtsverfahren nicht so aussagen, daß du dich der Mehrheit fügst und das Recht beugst. Du sollst auch den Geringen in seinem Rechtsstreit nicht begünstigen" (Ex 23,1-3).
Die Forderung, vor Gericht keine falschen Zeugenaussagen zu machen und in der Rechtsprechung unparteilich zu sein, soll bewirken, daß dem Nächsten nicht schwerer Schaden zugefügt und dadurch der Bund mit Gott beeinträchtigt wird.
Der ursprüngliche Sinn des achten Gebotes ist durch die Geschichte des Alten und Neuen Bundes beibehalten worden; aber er hat im Lauf der Zeit eine immer größere Ausweitung erfahren.
1.3. Wahrhaftigkeit im Leben der Menschen heute
Heute geht es im Verständnis des achten Gebotes um die sittliche Forderung nach Wahrheit und Wahrhaftigkeit im gesamtmenschlichen Bereich. Das Gebot fordert dazu auf, das persönliche, gesellschaftliche und öffentliche Leben nach dem Maßstab von Wahrheit und Wahrhaftigkeit zu gestalten.
Die Erfahrung zeigt, daß es nicht immer leicht ist, dem Anspruch von Wahrheit und Wahrhaftigkeit gerecht zu werden. Zwar fühlt sich jeder zutiefst verletzt, wenn er von den anderen belogen, verleumdet, in seinem guten Ruf und in seiner Ehre gekränkt oder in seinem Vertrauen betrogen wird; aber oft neigt der Mensch dazu, sich durch Lüge, Vertrauensbruch und Herabsetzung anderer Vorteile zu verschaffen, durch Schmeichelei und Unterwürfigkeit eine bessere Stellung zu bekommen und durch Prahlerei und stolzes Reden mehr aus sich zu machen, als er wirklich ist.
Trotz aller Verfehlung gibt es in der Menschheit ein beständiges Suchen nach Wahrheit und nach einem Ethos der Wahrhaftigkeit.
Jede Zeitepoche hat ihre bestimmte Vorstellung von dem, was Wahrheit ist. Seit dem Beginn der Neuzeit gibt es eine starke Skepsis gegenüber allgemeingültigen Wahrheiten.
Vertreter der Existenzphilosophie erklären, die Behauptung, daß es objektive, für alle Menschen gültige Wahrheiten gebe, stehe der Einmaligkeit des konkreten Menschen entgegen. Was für den einen wahr sei, müsse nicht auch für jeden anderen wahr sein. Jeder müsse sich in seiner eigenen Wahrheit selbst verwirklichen.
Von einem ganz anderen Leitbild geht der moderne Kritische Rationalismus aus. Nach dem Vorbild der Naturwissenschaft kann ein Mensch der Wahrheit nur näherkommen, indem er auf dem Weg von "Versuch und Irrtum" zu tieferer Erkenntnis vordringt. Er muß diesen Weg immer weiter beschreiten. Eine letzte Gewißheit gibt es nicht. Wer sich diesem Weg der steten kritischen Hinterfragung und des Weitersuchens verschließt, verstößt gegen die Grundlagen der Gesellschaft, die als "offene Gesellschaft" zu verstehen ist. Sie hat nicht die Wahrheit, sondern sie sucht die Wahrheit. Sie ist offen für immer neue Wahrheiten und Einsichten.
Zum Wahrheitsverständnis des modernen Menschen gehört, daß Aussagen, Behauptungen und Meinungen jederzeit auf ihre Richtigkeit bzw. auf ihre Falschheit überprüft und dementsprechend bestätigt oder korrigiert werden können. Die Liebe zur Wahrheit soll sich dadurch ausweisen, daß der Mensch seine Aussagen, Behauptungen und Überzeugungen der Kritik aussetzt. Wer unnachgiebig an seinem Standpunkt festhält und auf seiner Meinung beharrt, gilt als intolerant. Wenn die Gegenargumente überzeugen, muß er seinen Standpunkt ändern. Er wird glaubwürdiger, wenn er bereit ist, Fehler und Irrtümer einzugestehen und sich korrigieren zu lassen.
Die Wahrhaftigkeit gewinnt heute besondere Bedeutung durch die gesteigerte Möglichkeit, Wahres und Falsches über die modernen Kommunikationsmittel zu verbreiten.
Die Kontrollfunktion, die heute den Medien zukommt, kann manches Unrecht aufdecken und dadurch für Benachteiligte eine große Hilfe sein. Oft geraten Rechtsansprüche in Konflikt miteinander, oder einzelne und Gruppen stellen unberechtigte und maßlose Ansprüche an die Gemeinschaft. Vielfach wird auch versucht, die Wahrheit zu verschleiern. Hier sind sachliche Information, Kritik und Offenlegung der Wahrheit berechtigt und notwendig.
In der Forderung, die Wahrheit aufzudecken und sie der Öffentlichkeit mitzuteilen, spiegelt sich das demokratische Verständnis der Gesellschaft über das Verhältnis von Wahrheit und Kommunikation wider. In totalitären Staaten werden die Kommunikationsmittel von den Machthabern kontrolliert und Informationen der Zensur unterworfen. In demokratischen Staaten dagegen werden sie in breitem Umfang dargeboten, damit sich jeder sein eigenes Urteil bilden kann. Oft verbindet sich mit der Gegenüberstellung von Informationen, Meinungen und Standpunkten die Erwartung, daß sich daraus die Wahrheit von selbst ergebe.
So richtig es ist, daß möglichst breit und genau informiert wird, so sehr muß bei alledem beachtet werden, daß in der Kundgabe der Wahrheit auch andere Aspekte zu berücksichtigen sind. Eine rigorose oder gar einseitige Betonung des Objektiven im Informationsprozeß führt leicht dazu, daß Diskretion, Loyalität und Treue mißachtet werden. Liebloser Umgang mit der Wahrheit widerstreitet dem Ethos der Wahrhaftigkeit. Der richtige Gebrauch des Rechts auf Information fordert, "daß die Mitteilung inhaltlich stets der Wahrheit entspricht und bei der Beachtung der durch Recht und menschliche Rücksichtnahme gezogenen Grenze vollständig ist. Auch in der Form muß sie ethisch einwandfrei sein, das heißt, beim Sammeln und Verbreiten von Nachrichten müssen die ethischen Grundsätze sowie das Recht und die Würde des Menschen beachtet werden; denn nicht alles Wissen bringt Nutzen, ,die Liebe aber baut auf` (1 Kor 8,1)" (IM 5).
Der Mensch ist stets herausgefordert, die Tugend der Wahrhaftigkeit zu üben. Diese Tugend leitet uns an, im Leben, im Denken, im Sprechen und im Handeln wahrhaftig zu sein.
"Vermeiden wir Geschwätz jeglicher Art, ob bloß leeres Gerede oder tadelndes Reden . . . Trachten wir danach, wirklich zu meinen, was wir sagen, und zu sagen, was wir meinen . . . Nehmen wir die Wahrheit in Ehrfurcht auf, und bitten wir Gott, uns einen guten Willen zu geben und göttliches Licht, daß sie Frucht bringen in uns" (Kardinal John Henry Newman).
2. Die Dimensionen der Wahrheit und Wahrhaftigkeit
2.1. Die theologische Dimension
Das Alte Testament kennt keinen Begriff, der für sich allein die Übereinstimmung von Wort und Sache (= objektive Wahrheit) meint. Der Akzent beim Wortfeld "wahr" liegt immer auf der Wahrhaftigkeit und Zuverlässigkeit des Sprechenden und damit zugleich auch auf seiner Treue gegenüber dem gegebenen Wort. Das Alte Testament bezeugt, daß diese Wahrhaftigkeit bei den Menschen kaum zu finden ist (Ps 116,11; Jer 9,3f). Niemand darf sich auf den Stammvater Jakob berufen und ihn nachahmen wollen, dessen Segen durch Lüge und Betrug erschlichen ist. Denn in Hos 12 wird Jakobs Betrug an Esau ausdrücklich verworfen (vgl. Mal 3,6).
Ganz anders als mit den Menschen steht es mit Gott: "Gott ist kein Mensch, der lügt" (Num 23,19). Er ist "der Gott der Treue" (Dtn 32,4; Ps 31,6; vgl. Jes 65,16). Seine Worte sind lauter und zuverlässig (vgl. Ps 19,9; 119,140). In Ps 101,7 läßt Gott erklären: "In meinem Haus soll kein Betrüger wohnen, kein Lügner kann vor meinen Augen bestehen." Darum mahnt Sir 7,13: "Jede Lüge mißfalle dir; denn sie hat nichts Gutes zu erhoffen." Allerdings läßt der jeweilige Kontext erkennen, daß in erster Linie die sogenannte "Schadenslüge" angezielt ist.
Die im Alten Testament angesprochene Beziehung der Wahrhaftigkeit zur Treue und Zuverlässigkeit Gottes wird im Neuen Testament bestätigt. Gott selber ist die Wahrheit, die er in Jesus Christus offenbart. Für Christen ist diese theologische Verankerung der tiefste Grund der sittlichen Forderung nach Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Weil Gott nicht täuschen kann (Hebr 6,18), weil sein Wort Wahrheit ist (Joh 17,17) und die von Jesus offenbarte Wahrheit in Gott ihren Ursprung hat (Joh 8,26.40), müssen alle, "die aus der Wahrheit sind", auf die Stimme Gottes hören (vgl. Joh 18,37) und die Wahrheit im Leben bezeugen und "tun" (Joh 3,21; 1 Joh 1,6). Hier wird die Wahrheit freilich nicht als Aussagewahrheit (Wahres reden, Joh 4,18; 10,41) und Wahrhaftigkeit nicht als menschliche Tugend verstanden; vielmehr ist es die von Gott kommende Wahrheit, die der Mensch aufnehmen und in seinem ganzen Leben verwirklichen soll. Paulus spricht von der "Wahrheit des Evangeliums" (Gal 2,5.14; vgl. Kol 1,5), legt aber für seine Verkündigung Wert darauf, auch menschlich als glaubwürdig zu erscheinen (1 Thess 2,3-5). Gottes Wahrheit verträgt keine Unaufrichtigkeit, Heuchelei und Täuschung. Die Lüge kommt vom Teufel, dem Mörder von Anbeginn und "Vater der Lüge" (Joh 8,44). In Jesus Christus war nicht das Ja und Nein zugleich, sondern allein das Ja, das Ja zu allem, was Gott verheißen hat (2 Kor 1,19f). Durch das Wort der Wahrheit wurden wir zum Leben für Gott geboren (Jak 1,18), und im Gehorsam gegen die Wahrheit haben wir unser Herz gereinigt und sind zu ungeheuchelter Bruderliebe verpflichtet (1 Petr 1,22).
Darin zeigt sich, daß es im Neuen Testament ein Wahrheitsethos gibt, das tief im Glauben an Gott, den Wahrhaftigen und Treuen, verwurzelt ist. In Jesus Christus ist Gottes Gnade und Wahrheit endgültig offenbar und heilbringende Wirklichkeit geworden (Joh 1,17); er ist in seiner Person "der Weg, die Wahrheit und das Leben" (Joh 14,6); ihm und seinem Wort gilt es zu folgen; dabei richtet sich der Blick auch auf das Vorbild Jesu (1 Joh 2,6). Das, was die Christen von Christus gelernt haben und worin sie unterrichtet wurden, war "Wahrheit in Jesus" (Eph 4,21). Vor Pontius Pilatus hat Jesus "das gute Zeugnis abgelegt" (1 Tim 6,13).
Bei Jesus stimmen Reden und Tun mit dem überein, was er in seiner Person ist, nämlich der, der den Menschen die Heilswahrheit Gottes verkündigt. Er kennt Gott und muß sagen, daß er ihn kennt (Joh 8,55). Er kann nichts anderes reden, als was ihm der Vater aufgetragen hat (Joh 12,49; 14,10). Er ruft es offen in die Welt und gibt Zeugnis für die von Gott kommende Wahrheit (Joh 18,37). Niemand kann ihm "Sünde" nachweisen (Joh 8,46). Dieses Selbstzeugnis Jesu im Johannesevangelium wird durch das, was die synoptischen Evangelien darüber hinaus vom Umgang Jesu mit den Menschen, von seinen Auseinandersetzungen mit den Gegnern, von seinem Auftreten vor dem jüdischen Gericht berichten, bestätigt.
Außer in den theologischen Aussagen über die Grundlegung der Wahrheit in Gott und in Jesus Christus ist im Neuen Testament auch von der sittlichen Verpflichtung zur Wahrhaftigkeit die Rede. Lauterkeit im Reden und Treue zum gegebenen Wort müssen aus der Bindung an Gott und an Jesus, an sein Wort und an sein Verhalten erfließen. "Von der Liebe geleitet, sich an die Wahrheit haltend", um in allem auf Christus hinzuwachsen (Eph 4,15), das ist das Programm, an das sich die Menschen halten sollen.
In den Aussagen Jesu fallen die Worte von der Lauterkeit des Herzens auf: die Seligpreisung der Herzensreinen (Mt 5,8) und der Hinweis, daß aus dem Herzen Gutes und Böses hervorgeht. "Denn wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund" (Mt 12,34). Die Mahnung an die Jünger: "Seid klug wie die Schlangen und arglos wie die Tauben" (Mt 10,16) ruft dazu auf, bei aller Klugheit und Vorsicht aufrichtig, arglos und lauter zu bleiben.
Den Gegnern Jesu wird häufig "Heuchelei" vorgeworfen. Nicht immer ist darunter absichtliche Verstellung und Hinterlist zu verstehen. Öfter ist der Widerspruch zwischen dem Willen Gottes und dem Verhalten der Menschen gemeint, der Mangel an personaler Verwirklichung dessen, was Gott von den Menschen erwartet und was sie vielleicht selbst wollen (vgl. Mk 7,6; Mt 6,2.6.16). Der Pharisäer im Gleichnis (Lk 18,9-14) tut viel Gutes und verfehlt doch Gottes Willen. - Mit dem Vorwurf von "Heuchelei" im Sinne von Unaufrichtigkeit und Verstellung tut man den streng nach dem Gesetz lebenden Pharisäern freilich Unrecht.
Aber es ist auch eine Frage an Christen, wieweit sie dem Willen Gottes, wie ihn Jesus in letzter Klarheit verkündet, in ihrem Denken, Reden und Tun entsprechen. "Über jedes unnütze Wort, das die Menschen reden, werden sie am Tag des Gerichts Rechenschaft ablegen müssen" (Mt 12,36).
In den Briefen des Neuen Testamentes werden die Christen aufgefordert, die Lüge zu meiden und im Reden wahrhaftig zu sein. Aus dem Bewußtsein, in der Wahrheit Gottes zu stehen und zu einem Leben "in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit" geschaffen zu sein (Eph 4,24), erhebt sich die Mahnung: "Deshalb legt die Lüge ab und redet untereinander die Wahrheit; denn wir sind als Glieder miteinander verbunden" (Eph 4,25). Jakobus warnt vor der "bösen Zunge" (Jak 3,1-12) und mahnt: "Prahlt nicht und verfälscht nicht die Wahrheit" (3,14).
Paulus sieht den Zorn Gottes über die Menschen offenbar werden, die "die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten" (Röm 1,18). "Sie vertauschen die Wahrheit Gottes mit der Lüge", und darum "lieferte sie Gott entehrenden Leidenschaften aus" (Röm 1,15f).
Falsche, verführerische und verderbliche Rede hat man in der Urkirche vor allem Irrlehrern vorgeworfen (vgl. Eph 4,14 und die Pastoralbriefe). Ihr unsittlicher und lasterhafter Lebenswandel ist auch dadurch gekennzeichnet, daß "sie lügen und Meineide schwören" (1 Tim 1,10). Hinter solchen "heuchlerischen Lügenrednern" (1 Tim 4,2) sah man den Einfluß von Irrgeistern und Dämonen (4,1). - Für den Verfasser des ersten Johannesbriefes steht hinter der "Lüge" der Irrlehrer der Antichrist (2,18.21f; 4,2f). "Lügner" sind solche, die sich nicht an das von Jesus gegebene Gebot der Bruderliebe halten (2,4; 4,20). Alles, was der Wahrheit und dem Zeugnis des Glaubens und der Liebe widerspricht, ist Teufelswerk. - Die Johannesoffenbarung stellt das Zeugnis, das die verfolgten Christen für Christus ablegen, in helles Licht (1,9; 6,9; 12,11 u.ö.).
Nach den biblischen Aussagen meint die "Wahrheit Gottes" nicht nur, daß die Botschaft sachlich richtig, sondern daß sie grundsätzlich vertrauenswürdig ist. Augustinus stellt deshalb die Wahrhaftigkeit insbesondere für die Glaubensbotschaft heraus, die ganz auf dem Vertrauen zu ihren Verkündigern aufbaut (Über die Lüge VII, 1; CSEL 41,429f).
An dem biblischen Ideal von Wahrheit und Wahrhaftigkeit hat sich auch jegliche kirchliche Verkündigung zu messen. Der Kirche ist eine Botschaft aufgegeben, die heilbringend und heilend ist, die dem Menschen hilft, in der Gemeinschaft mit Gott den Sinn des Lebens zu finden und aus dieser Sinnbestimmung zu leben. Darum muß sich die Kirche auch in ihrer Verkündigung immer wieder auf die Treue zur Botschaft Gottes besinnen, gegebenenfalls Irrtümer eingestehen und so beständig danach suchen, die Wahrheit tiefer zu erfassen.
2.2. Die personale Dimension
Der Mensch hat ein tiefes Gespür für Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Mit Wahrhaftigkeit verbinden sich Redlichkeit, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Selbsttreue; ihr stehen entgegen: Unredlichkeit, Verstellung, Heuchelei, Treulosigkeit.
In allem geht es zwar auch immer darum, daß man die Wahrheit sagt und nicht etwas als Wahrheit ausgibt, wovon man weiß, daß es unwahr ist; mehr noch geht es aber um die Forderung, daß der Mensch mit sich selbst übereinstimmt, innerlich und äußerlich redlich und unverstellt und in allen Schwierigkeiten und Wechselfällen des Lebens mit sich selbst eins ist und sich treu bleibt. Wahrhaftigkeit ist somit der beständige Wille der Person, wahr zu sein, wahr zu denken, wahr zu handeln und wahr zu reden. In dieser Haltung wird zutiefst die personale Dimension der Wahrhaftigkeit sichtbar.
Wahr sein meint eine ganzheitliche Haltung der Person. Es erinnert an Abraham, der aufgefordert wurde: "Geh deinen Weg vor mir, und sei rechtschaffen" (Gen 17,1). Wahr sein bedeutet: "aus einem Guß" sein, vom Innersten her mit sich selbst in Übereinstimmung leben. Das Gegenbild eines wahren Menschen ist jener, der vor sich selbst auf der Flucht ist, der sich nicht der Wirklichkeit seines eigenen Lebens und seiner Grenzen stellt und der innerlich entzweit und sich selbst entfremdet lebt. Er findet keinen Frieden mit sich selbst und der Welt. Wahrsein vollzieht sich dort, wo ein Mensch zu sich selbst steht. Das ist nicht immer leicht. Zur vollen Einheit mit sich selbst ist der Mensch stets unterwegs. Letztlich ist das, was wir Identität nennen, nicht das Ergebnis nur der eigenen Bemühung, sondern es ist Geschenk und Gnade geglückten Daseins.
Wahr denken heißt: sich der Wahrheit stellen, und zwar zuerst der Wahrheit über sich selbst. Ein Mensch kann nicht nur über andere falsch denken, sondern auch über sich selbst. Er kann sich über sich täuschen oder sich selbst falsch einschätzen, und er kann sich mehr oder weniger bewußt etwas über sich selbst vormachen und mehr scheinen wollen, als er in Wahrheit ist. Ebenso kann er von sich gering denken, am eigenen Wert zweifeln und sich darum selbst nicht annehmen wollen.
Wahr denken verlangt, vorurteilslos die Wirklichkeit der Welt wahrzunehmen und unangenehme Wahrheiten nicht aus dem Gesichtsfeld auszublenden. Wer offen wird für die Umgebung, aufmerksam den Mitmenschen begegnet und in Verantwortung spürt, was nötig ist, der denkt wahr.
Wahr handeln setzt voraus, innerlich der Wahrheit verbunden zu sein. Wer das Wahre tut, handelt in Übereinstimmung mit sich selbst. Das Tun geht dann aus der inneren Haltung der Wahrhaftigkeit hervor, man gibt sich unverfälscht und aufrichtig; man spielt nicht eine Rolle, in der man anderen etwas über sich vorgaukelt; man gibt sich nicht den Schein der Redlichkeit und verführt andere nicht zu falschen Einschätzungen.
Wahr reden besagt, daß die Überzeugung mit dem gesprochenen Wort übereinstimmt. Durch unser Sprechen tritt unsere Aufrichtigkeit am deutlichsten nach außen in Erscheinung. Die Übereinstimmung von Wort und innerer Überzeugung ist für den Menschen ein Gradmesser seiner Einstellung zu sich selbst, zu anderen Menschen und zu Gott.
Die Forderung des achten Gebotes nach Wahrhaftigkeit im Leben, im Denken, im Handeln und im Reden ist somit ein ethischer Anspruch, welcher der Würde des Menschen entspricht. Sie ist der Anspruch auf Wahrung der Treue zu sich selbst. Wer sich verstellt und heuchelt, muß ständig darum besorgt sein, daß seine Unredlichkeit und Unaufrichtigkeit aufgedeckt werden; er kann sich nicht offen und unbefangen geben, weil er befürchten muß, daß er sich verrät. Wer die Unwahrheit sagt, erweist sich als unglaubwürdig und mit sich selbst uneins. Der Wahrhaftige dagegen ist mit sich selbst eins; er wird auch dann Respekt erwarten dürfen, wenn er sich einmal in dem, was er tut oder sagt, täuscht.
2.3. Die soziale Dimension
In der Frage nach Wert und Bedeutung von Wahrheit und Wahrhaftigkeit geht es nicht nur darum, daß der einzelne mit sich selbst identisch ist; Wahrheit und Wahrhaftigkeit sind auch unerläßliche Voraussetzungen für das Gelingen des Gemeinschaftslebens.
Der Mensch lebt in Gemeinschaft und wendet sich bewußt und frei in seiner Sprache anderen Menschen zu. Im Sprechen können wir Sachverhalte und Wissen vermitteln. Wer mit dem anderen spricht, nimmt ihn wahr und nennt ihn mit Namen. Worte können Empfindungen und Gefühle, Absichten und Überzeugungen ausdrücken. Sie können Gemeinschaft stiften und Gemeinschaft zerstören. Es gibt das gute Wort, das Vertrauen schafft, und es gibt das böse Wort, das Trennung bewirkt. Es gibt das Wort, das Wahrheit offenbart, und es gibt das Wort, das Wahrheit verhüllt und verschleiert. Es gibt Worte des Zutrauens und des Mißtrauens, der Liebe und des Hasses, der Überredung und der Verführung, der Werbung und der Propaganda, des Befehls und der Macht.
Wahrhaftigkeit in Wort und Rede schafft Vertrauen und Achtung voreinander. Ohne gegenseitiges Vertrauen und ohne "Treu und Glauben" ist Gemeinschaftsleben auf Dauer unmöglich. Zu einem wahrhaftigen Menschen hat man Zutrauen, auf sein Wort kann man sich verlassen und fühlt sich sicher. Wo einer die Aussage des anderen anzweifelt, kann ein sinnvolles Miteinander nicht gelingen. Das gilt für die kleineren Gemeinschaften der Freundschaft, der Ehe und der Familie ebenso wie für die größeren Gemeinschaften der Gemeinde, der Kirche und des Staates.
Das Zusammenleben der Menschen setzt voraus, daß wir den anderen ernst nehmen und daß aufeinander Verlaß ist. In der menschlichen Gemeinschaft ist der andere von vornherein "Du", er ist Person wie "Ich". Darum ist das christliche Grundwort für die Beziehung zwischen Menschen das Wort "Liebe". Wir sind aus dem Wort der Liebe Gottes geschaffen und sind dazu berufen, einander zu lieben. Der Ort der Begegnung ist die menschliche Gemeinschaft.
Oft sind wir geneigt, andere nicht an uns herankommen zu lassen. Nicht jeder "liegt" uns. Oft nehmen wir den anderen, der auf unsere Zuwendung, auf ein Wort oder auf ein Gespräch mit uns wartet, gar nicht wahr. Wer liebt, achtet den anderen als Person; er verweigert sich ihm nicht, läßt ihn nicht "links liegen", sondern nimmt ihn wahr, spricht mit ihm und ist für ihn da. Offenheit für den anderen, Bereitschaft, ihn wahrzunehmen und den Dialog mit ihm aufzunehmen, ist eine Forderung der Wahrhaftigkeit.
Wenn in einer Gemeinschaft jeder Mensch als Person wahrgenommen werden soll und alle sich wahrhaft menschlich begegnen wollen, müssen sie aufeinander hören und miteinander sprechen. Solange versucht wird, mit anderen im Gespräch zu sein, sie zu verstehen und auf sie einzugehen, ihnen zu vertrauen und in Konflikten nach vertretbaren Lösungen zu suchen, schließen sich Feindschaften und Gewalt zwischen einzelnen, Gruppen und Staaten aus. Die Sprache der Feindschaft ist die Sprache der Verleumdung, der Lüge und der Gewalt. Verlogene Systeme mißbrauchen die Wörter. Sie verderben die Sprache so sehr, daß die Funktion der Sprache, Wahrheit zu offenbaren und Kommunikation zu ermöglichen, ins Gegenteil verkehrt wird.
Wahrheit und Lüge haben somit eine soziale Dimension. Wahrheit baut Gemeinschaft auf, Lüge zerstört sie. In der Lüge wird nicht nur bewußt Falsches ausgesagt, sondern in ihr wird auch der andere, der darauf vertraut, die Wahrheit zu hören, in die Irre geführt. Darin steckt eine Mißachtung der Person des anderen. Je öfter Lügen gebraucht werden und je schwerer sie sind, desto schädlicher wirken sie sich aus. "Wenn die Achtung vor der Wahrheit zerstört oder auch nur geschwächt worden ist, dann wird alles zweifelhaft bleiben" (Augustinus, Über die Lüge). Besonders schweren Schaden richtet die Lüge zwischen Menschen an, die in einem Vertrauensverhältnis zueinander stehen, Verantwortung für andere tragen und darauf angewiesen sind, daß ihre Autorität angenommen und respektiert wird. Das gilt etwa für die Beziehung der Eltern zu ihren Kindern, der Ehegatten zueinander, der Erwachsenen zu den Jugendlichen und der Politiker zur Öffentlichkeit.
2.4. Die sachliche Dimension
Eine Voraussetzung für alle anderen Dimensionen der Wahrheit ist es, daß grundsätzlich Sachverhalte und Sachaussagen einander entsprechen können.
Auf die Grundfragen des Menschen: Was ist dies? Wie ist dies? ist der Mensch durchaus befähigt, Antworten zu geben. Zwar unterbieten die menschlichen Antworten auf diese Fragen die Fülle der Wirklichkeit, dennoch teilen sie die Wahrheit mit.
Das menschliche Wort, der menschliche Gedanke steht daher immer unter dem Anspruch, nach größtmöglicher Entsprechung zur Wirklichkeit einer Sache oder eines Sachverhaltes zu streben und nicht bewußt einen Gegensatz zwischen Aussage und Gedanke einerseits und Sache oder Sachverhalt andererseits stehenzulassen.
Es wäre zu eng, Gedanken und Worte nur wie eine Art "Fotografie" eines Tatbestandes zu betrachten. Deshalb gehören die theologische, personale und soziale Dimension zur Wahrheit der Sachverhalte und Sachen selbst, aber sie ersetzen sie nicht, sondern vertiefen und erweitern die Grundfrage, die das "Gewissen" einer jeden Aussage und eines jeden Gedankens ist: Wie ist es, wie verhält es sich wirklich?
3. Wahrhaftigkeit und Treue zum gegebenen Wort
3.1. Treue zum eigenen Vorsatz
Wahrhaftigkeit äußert sich nicht nur darin, daß eine Aussage mit der inneren Überzeugung übereinstimmt, sondern auch darin, daß jemand zu seinem Wort steht und ihm treu bleibt.
Das gilt bereits gegenüber einem Wort, das einer sich in einem Vorsatz selbst gibt. Vorsätze können sich auf unterschiedliche Werte und Güter richten. Oft wird ein bestimmter Vorsatz gefaßt, um einen sittlichen Wert zu erstreben oder von einer schlechten Gewohnheit abzulassen. Solche und ähnliche Ziele sind nur zu erreichen, wenn jemand dem einmal gefaßten Vorsatz treu bleibt. Es ist ein Zeichen menschlicher Reife und innerer Stärke, wenn er vor Schwierigkeiten nicht vorschnell aufgibt. Wer einen Vorsatz faßt, muß bedenken, ob er das Ziel auch erreichen kann oder ob der Vorsatz sinnlos ist, weil er ihn nicht halten kann oder halten will; dann könnte das Sprichwort gelten: Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Der Weg zum Himmel dagegen ist nie allein das Ergebnis der guten Vorsätze, sondern vor allem das Geschenk der Güte Gottes.
3.2. Halten von Versprechen und Verträgen
Neben dem Vorsatz, in dem jemand sich an ein Wort bindet, das er sich sozusagen selbst gegeben hat, gibt es das Versprechen, in dem er sich zur Treue gegenüber anderen verpflichtet, denen er sein Wort gibt. Er verabredet sich mit anderen, um gemeinsam etwas zu unternehmen; er leiht sich von anderen etwas aus und verspricht, es bald zurückzugeben; er sagt einem anderen Hilfe zu; oder er schließt einen Vertrag, in dem er sich zu treuer Zusammenarbeit verpflichtet. In solchen und anderen Fällen ist ein Mensch sittlich verpflichtet, zum gegebenen Wort zu stehen.
Wer wort- und vertragsbrüchig ist, enttäuscht andere und verliert ihr Vertrauen. Das Gemeinschaftsleben beruht in hohem Maß auf der Zuverlässigkeit von Versprechen und Verträgen. Beide gehören zu den ältesten Institutionen des Gemeinschaftslebens. Deshalb gelten für sie die bekannten sittlichen Grundsätze: Versprechen darf man nicht brechen! Verträge sind zu halten! Diese Forderungen ergeben sich aus der Pflicht zu Treue und Gerechtigkeit.
Allerdings sind Versprechen nicht immer und unter allen Umständen bindend. So kann sich die ganze Sachlage so verändern, daß ein buchstäbliches Worthalten sich gegen den Sinn des Versprechens richten würde. In solchen Fällen kann die Verpflichtung, sich an das Versprechen zu halten, unter Umständen aufhören. Versprechen, die sich auf unsittliche Handlungen beziehen, sind von vornherein nichtig und dürfen nicht gehalten werden.
Ähnlich ist es bei Verträgen. An sich sind Verträge sittlich und rechtlich verbindlich. Die Verbindlichkeit erlischt bei Verträgen, wenn sie erfüllt sind oder wenn die Vertragspartner in gegenseitigem Einvernehmen vom Vertrag zurücktreten oder ihn auflösen. Verträge, die in betrügerischer Absicht geschlossen werden oder deren Inhalt unsittlich ist, sind moralisch verwerflich und rechtlich ungültig.
4. Wahrhaftigkeit im zwischenmenschlichen Bereich
4.1. Diskretion
Der Apostel Paulus faßt alle Gebote, die das zwischenmenschliche Verhalten betreffen, in dem einen Gebot zusammen: "Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst" (Röm 13,9). Sittliches Handeln darf deshalb nie im Gegensatz zur Liebe stehen; es muß immer das Wohl des Nächsten mitbedenken. Das gilt auch für die Mitteilung von Wahrheiten. Sie ist nur soweit sittlich geboten, wie sie mit der Forderung der Liebe in Einklang steht.
Wer einem Menschen Wahrheiten offen ins Gesicht sagt, die ihn verletzen oder ihm schweren Schaden zufügen, handelt verantwortungslos. Eine lieblos hingesagte Wahrheit kann wie ein schneidendes Schwert sein, das den Betroffenen demütigt oder ihn gar richtet. Jesus fordert uns auf: "Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden" (Lk 6,37). Er warnt davor, sich über den anderen zu stellen und sich selbst vor Gott zu rühmen (vgl. Lk 18,13). Wer einem anderen in boshafter Absicht Wahrheiten ins Gesicht sagt, zerschneidet das Band der Gemeinschaft und des Vertrauens; wer ihm dagegen in Liebe die Wahrheit sagt, vermag ihm zu Einkehr und Umkehr zu verhelfen.
Ähnliches gilt auch für die Weitergabe von Informationen an Dritte. Zwar ist man verpflichtet, immer die Wahrheit zu sagen, aber man darf nicht alles ausplaudern, was man weiß. Die Tugend der Wahrhaftigkeit schließt Diskretion ein, das heißt kluge Unterscheidung, Zurückhaltung im Reden und die Fähigkeit zu schweigen, wo es angebracht oder erforderlich ist. Wer sein Herz zu sehr auf der Zunge trägt und nichts für sich behalten kann, verletzt leicht die Liebe und richtet Schaden an. Das kann der Fall sein, wenn man unnötig private Angelegenheiten weitererzählt oder wenn man sein Wissen über andere preisgibt und es dadurch in Umlauf bringt. Oft werden gerade vertrauliche Angelegenheiten, die man unter dem Siegel der Verschwiegenheit mitteilt, schnell verbreitet.
- "Es ist geradezu lächerlich, wenn die Ausplauderer von geheimen Fehlern ihren Hörer bitten und beschwören, es keinem anderen zu sagen; geben sie doch dadurch selbst zu, Unrecht getan zu haben. Wenn du den anderen um Geheimhaltung bittest, so hättest du selbst erst recht schweigen sollen!" (Johannes Chrysostomus, Hom. 3 ad Pop. Antioch. n. 5; PG 49,55).
Die Wahrung der Diskretion kann besonders dann schwierig sein, wenn andere durch Fragen versuchen, jemandem bestimmte Informationen zu entlocken. In manchen Situationen ist es möglich, eine Frage zurückzuweisen, sie unbeantwortet zu lassen oder den Fragenden vom Thema abzulenken. Oft gibt sich aber der Fragende nicht damit zufrieden oder sieht im Schweigen oder in der Verweigerung einer klaren Antwort einen bestimmten Verdacht bestätigt, denn Schweigen kann auch sehr beredt sein.
In der Geschichte der Moraltheologie und Ethik gibt es viele Versuche einer Antwort auf die Frage, wie jemand sich verhalten dürfe, wenn er verpflichtet sei, die Wahrheit zu verbergen oder ein Geheimnis zu schützen. Die einen meinen, er dürfe zwar niemals eine Falschrede, wohl aber eine doppeldeutige oder eine verhüllende Rede verwenden. Andere erklären, man dürfe eine Falschrede als Akt der Notwehr gebrauchen.
Niemand ist sittlich berechtigt, eine falsche Aussage zu machen. Nur wo der Fragende das Recht auf Wahrheit verwirkt hat, kann die Liebe ein bewußtes Verschweigen der Wahrheit gebieten. "Die Lüge ist der unmittelbarste Verstoß gegen die Wahrheit. Lügen heißt gegen die Wahrheit reden, um jemand zu täuschen, der ein Recht hat, sie zu kennen. Da die Lüge die Verbindung des Menschen mit der Wahrheit und dem Nächsten verletzt, verstößt sie gegen die grundlegende Beziehung des Menschen und seines Wortes zum Herrn" (KKK 2483). Dem entspricht, daß niemand verpflichtet ist, die Wahrheit Personen zu enthüllen, die kein Recht auf deren Kenntnis haben (vgl. KKK 2489).
In den Bereich des Anspruchs auf Diskretion fällt auch die Wahrung des Briefgeheimnisses. Nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen vom 10. 12. 1948 (Art. 12) gehört sie zu den Grundrechten der Person; dieses gewährleistet der Privatsphäre des einzelnen einen besonderen Schutz gegen fremde Eingriffe. Das Recht auf das Briefgeheimnis wird verletzt, wenn jemand unbefugt fremde Briefe öffnet oder sich gutverwahrte Briefe anderer aneignet und liest. Als Eingriff in ein Persönlichkeitsrecht ist die Verletzung des Briefgeheimnisses eine sittliche Verfehlung. Sie belastet zudem das Vertrauensverhältnis und die Glaubwürdigkeit. Eltern sollten auch bei ihren Kindern mit deren zunehmendem Alter das Briefgeheimnis immer mehr respektieren.
Im allgemeinen ist das Öffnen und Lesen von Briefen anderer nur gestattet, wenn dadurch eine schwerwiegende Gefahr (zum Beispiel die Aufdeckung eines Verbrechens) abgewendet werden kann.
Eine allgemeine staatliche Briefzensur, die den zuständigen Behörden die Öffnung aller Briefe gestattet, ist sittlich verwerflich. Hier wäre jeder Bürger der totalen Überwachung durch den Staat ausgeliefert. Nur in extremen Ausnahmefällen, wie etwa bei begründetem Verdacht auf eine schwerwiegende Gefährdung des Gemeinwohls, kann eine staatlich angeordnete Briefzensur gestattet sein. Eine Zulassung der Zensur über eng begrenzte Fälle hinaus zerstört das Vertrauen der Bürger zum Staat.
4.2. Wahrung von Ehre und gutem Ruf
Jeder Mensch hat Anspruch darauf, von anderen anerkannt und geachtet zu werden. Verweigert ihm jemand den Respekt, so setzt er ihn in seiner Würde herab und zerstört das gegenseitige Vertrauen. Das Recht auf Wahrheit und auf Wahrung der Personwürde verlangt, daß der gute Ruf eines anderen nicht ohne zwingenden Grund geschmälert wird. Ehre und guter Ruf können auf unterschiedliche Weise verletzt werden.
So spricht man von Ehrabschneidung, wenn jemand tatsächlich bestehende Fehler eines anderen unnötig bekannt macht. Verleumdung liegt vor, wenn jemand einem anderen Fehler anhängt, die er in Wirklichkeit nicht hat. Schlimme Folgen können auch andere Formen von Aussagen haben. Dazu gehört die Weitergabe von Halbwahrheiten. Sie haben zwar Richtiges an sich, aber sie lassen wichtige positive Aspekte beiseite und geben so ein einseitiges, unwahres Bild ab.
Ungerechtfertigt sind auch negative Pauschalurteile. In ihnen wird von einem oder wenigen negativen Vorkommnissen auf das gesamte Verhalten einer ganzen Menschengruppe geschlossen. Pauschalurteile über Andersdenkende, Minderheiten, Völker und Rassen vergiften das Klima des Vertrauens und gefährden das friedliche Miteinander. In Pauschalurteilen werden anderen Menschen negative Eigenschaften oder Motive unterstellt, die weder erwiesen sind noch den Tatsachen entsprechen.
Wer lieblos über andere spricht, vergeht sich dadurch, daß er die Wahrheit nicht voll zur Geltung bringt, auf die der andere ein Recht hat. In allen Aussagen über andere muß es vor allem darum gehen, daß jemand mit aufrichtigem Respekt über andere denkt und spricht. Das ist besonders wichtig, wenn er über Abwesende spricht, die dann keine Möglichkeit haben, sich selber zu verteidigen oder falsche Aussagen zurechtzurücken.
Die Verpflichtung zur Wahrhaftigkeit und Wahrheit bedeutet nicht, daß jemand über andere nur Gutes sagen darf. Es gehört zur Tugend der Wahrhaftigkeit, daß er unter Umständen auch bereit sein muß, Fehler anderer aufzudecken. Das trifft zu, wenn die Mitmenschen ein Recht darauf haben, sich gegen Verhaltensweisen einzelner zu schützen. Wo die Fehler des einzelnen andere belasten oder gefährden, besteht ein berechtigtes Interesse daran, diese Fehler zu kennen, damit andere sich ein zutreffendes Urteil bilden und so eventuell Schaden vom Gemeinwohl abwenden können.
4.3. Zeugnis vor Gericht
Die Forderung, keine falschen Zeugenaussagen zu machen, soll bewirken, daß der Zeuge nicht Unrecht tut und anderen Menschen Schaden zufügt. Er ist um der Gerechtigkeit willen zur wahren Aussage verpflichtet. Diese Verpflichtung, vor Gericht "die Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu sagen", kann aber auch zu Konflikten führen. Das trifft zum Beispiel zu, wenn das Rechtswesen sich parteipolitischen Interessen beugt. In einem solchen Rechtswesen geht es nicht mehr um den Willen zu einem vertrauensvollen Zusammenleben und um menschenwürdige Kommunikation. Hier soll die Forderung nach wahrer Zeugenaussage unter Umständen dazu benutzt werden, das Unrechtssystems zu stützen. Der Zeuge soll durch eine wahre Aussage einen anderen, der an der Beseitigung des Unrechtssystems beteiligt ist, verraten und ihn so dem sicheren Tod ausliefern (vgl. etwa die Prozesse des Volksgerichtshofs im Nationalsozialismus, die Unrechtsprozesse in der früheren DDR und in anderen sozialistischen Staaten). Er kann ihn nur retten, wenn er nicht die Wahrheit sagt. Hat der fragende Richter nicht in diesem Fall ein Recht auf Wahrheit?
Das Recht auf Wahrheit ist weder unbedingt noch absolut. Höchstes und oberstes Gebot ist das Gebot der Nächstenliebe. Wer eine Aussage dazu mißbrauchen will, einem anderen Menschen schweren Schaden zuzufügen, handelt nicht aus Nächstenliebe. Er baut nicht Gemeinschaft auf, sondern zerstört sie schon durch seine böse Absicht. Dadurch hat er das Recht auf Wahrheit verwirkt. Er kann nicht erwarten, daß ihm eine Zeugenaussage gemacht wird, durch die ein anderer der unrechten Gewalt ausgeliefert wird. In einem politischen System, das die Mitteilung der Wahrheit nicht dazu verwendet, das Recht zu bestärken, sondern das Unrecht zu stützen, kann die wahre Zeugenaussage zum Verrat an der Nächstenliebe und am wahren Recht werden.
Im Zeugnis vor Gericht werden zur Bekräftigung der Wahrheit einer Aussage oftmals zusätzliche Sicherheiten gefordert. Die höchste und feierlichste Form einer solchen zusätzlichen Versicherung ist die Berufung auf Gott als Zeuge der Wahrheit einer Aussage: "Ich schwöre bei Gott, daß ich die Wahrheit und nichts als die Wahrheit sage!" Hier wird ein religiöser Eid abgelegt. Der Glaubende versteht einen solchen Eid, wie das zweite Gebot des Dekalogs zeigt (vgl. S. 197-199), als Akt der Gottesverehrung.
4.4. Aufklärungspflicht über Krankheit
Ein besonderes Problem ist dort gegeben, wo die Verpflichtung besteht, jemand über seine Krankheit aufzuklären. Hier kann ein bedenkenloses und wenig einfühlsames Mitteilen der Wahrheit zur Belastung für den Kranken führen. Andererseits kann eine Verschleierung der Wahrheit oder eine falsche Vertröstung auch verhindern, daß der Kranke sich bewußt auf seine Krankheit einstellt, sich auf den Tod vorbereitet oder noch manches ordnet. Bei der Begleitung von Kranken und Sterbenden müssen Angehörige, Ärzte und Pflegepersonal bedenken, daß die meisten Schwerkranken die Nähe des Todes ahnen. Versucht jemand, sie mit irreführenden und falschen Auskünften zu beruhigen, empfinden sie das als Verweigerung eines offenen Gesprächs und fühlen sich isoliert und alleingelassen.
Wer einem Kranken die Wahrheit sagt, darf dies nicht mit einer bloßen Information tun, sondern muß ihn begleiten bei einem Prozeß, in dem er allmählich seine Situation annehmen kann. Voraussetzung dafür ist auf seiten des Arztes und der Angehörigen die Bereitschaft zum Gespräch, das der Kranke als Solidarität und als Hilfe zur Bewältigung seiner Not erfahren kann. Dabei ist darauf zu achten, einem Schwerkranken nicht von vornherein jede Hoffnung zu nehmen, zumal eine exakte Voraussage des weiteren Verlaufs einer Krankheit oft auch medizinisch kaum möglich ist. Allerdings muß dem Kranken deutlich gemacht werden, daß sein Zustand ernst ist. In dem Maße, wie der Patient in der Lage ist, sich mit seinem wirklichen Zustand auseinanderzusetzen, können dann im Prozeß der persönlichen Begleitung weitere und genauere Mitteilungen gegeben werden.
Es geht hier somit nicht um die Entscheidung, dem Schwerkranken entweder ungeschminkt die Wahrheit zu sagen oder ihn zu belügen, sondern um das Bemühen, ihm die Wahrheit allmählich zu eröffnen, und zwar in dem Maße, wie er dafür im Verlauf der Krankheit mehr und mehr bereit wird.
4.5. Pflicht zur "brüderlichen Zurechtweisung"
Die Verpflichtung zur Wahrhaftigkeit kann in Situationen führen, in denen man nicht davor zurückscheuen darf, jemand, der in schwerer Sünde lebt oder in Gefahr ist, eine schwere Sünde zu begehen, zu ermahnen und ihn zur Umkehr zu bewegen. Eine solche "brüderliche Zurechtweisung", von der die Heilige Schrift spricht (Mt 18,15ff; vgl. 1 Tim 5,1f; Gal 2,11-14), gilt in der christlichen Tradition als "Werk der Barmherzigkeit". Damit ist nicht ein liebloses Tadeln gemeint, sondern ein Gespräch, das einem Bruder oder einer Schwester hilft, aus einer Situation umzukehren, aus der sie sich aus eigener Kraft kaum befreien können. Zu solcher Zurechtweisung ist jemand um so mehr verpflichtet, je mehr er für den anderen verantwortlich ist, je näher er ihm steht und je größer die Aussicht auf gegenseitiges Verstehen und auf Umkehr ist. Wenn keinerlei Bereitschaft zur Umkehr zu erzielen, die Sache selbst aber von so großer Bedeutung ist, daß sie weitere Schritte erforderlich macht, muß man um der Liebe zum Mitmenschen wie zur Kirche willen jene Konsequenzen auf sich nehmen, von denen die Heilige Schrift spricht:
- "Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er aber nicht auf dich, dann nimm einen oder zwei Männer mit, denn jede Sache muß durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Hört er auch auf sie nicht, dann sag es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder Zöllner" (Mt 18,15-17).
Es ließe sich viel Peinlichkeit, Ärger und Schaden vermeiden, wenn Konflikte in brüderlichem Gespräch angegangen würden, bevor man sie an die Öffentlichkeit bringt.
4.6. Berufsgeheimnis und Beichtgeheimnis
Jeder, dem persönlich oder amtlich Geheimnisse anvertraut werden, darf solche Geheimnisse nicht weitergeben. Er ist zur Verschwiegenheit verpflichtet.
Beamte und Angestellte im Staatsdienst sind zur Wahrung von Staatsgeheimnissen verpflichtet; Betriebsangehörige haben Betriebs- oder Werkgeheimnisse zu achten; alle therapeutischen Berufe und im Beratungsdienst Tätige haben eine besondere Pflicht zur Verschwiegenheit.
Besonders streng ist das Beichtgeheimnis zu wahren. Es ist die Voraussetzung dafür, daß die Gläubigen vertrauensvoll ihre geheimste Schuld bekennen können. Ein Bruch des Beichtgeheimnisses würde dieses Vertrauen zerstören und schwersten Schaden anrichten.
Das Beichtgeheimnis verpflichtet nicht nur den Beichtvater, sondern auch andere, die auf irgendeine Weise vom Inhalt einer Beichte Kenntnis bekommen haben, zu strenger Verschwiegenheit. Nur der Beichtende selbst ist durch dieses Geheimnis nicht gebunden. Wohl aber verlangt die Gerechtigkeit oft auch von ihm strenge Diskretion beim Gespräch über eine Beichte, besonders über die Worte des Beichtvaters, weil dieser sich auf Grund seiner Verpflichtung zur Geheimhaltung gegen Aussagen, die seine Worte nicht richtig wiedergeben, nicht zur Wehr setzen kann.
Inhaltlich umfaßt das Beichtgeheimnis nicht nur die Sünden, sondern alles, dessen Weitergabe für den Beichtenden belastend sein könnte. Das Beichtgeheimnis ist unverletzlich. Auch die Kirche kann davon nicht dispensieren. Das Beichtgeheimnis darf auch dann nicht gebrochen werden, wenn seine Wahrung für den Beichtvater mit schwersten Nachteilen verbunden wäre.
Ein Beichtgeheimnis liegt jedoch nur dann vor, wenn der Beichtende die Absicht hat, eine sakramentale Beichte abzulegen. Das gilt auch, wenn es nicht zu einer Lossprechung kommt. Dagegen ist es nicht möglich, jemand "unter Beichtgeheimnis" zu verpflichten, wenn die Mitteilung nicht im Rahmen einer Beichte erfolgt.
Eine Verletzung des Beichtgeheimnisses liegt vor, wenn jemand durch Worte oder auf andere Weise ein in der Beichte anvertrautes Wissen über Sünden oder andere belastende Tatbestände weitergibt. Dies gilt nur dann, wenn dieses Wissen mit einem bestimmten Beichtenden in Zusammenhang gebracht wird. Es wird von der Kirche als schweres Amtsvergehen eines Priesters mit der Exkommunikation bestraft.
5. Wahrheit in der Öffentlichkeit
5.1. Meinungsbildung in der Öffentlichkeit
Menschliche Gemeinschaft lebt von Kommunikation. Sie braucht Verständigung und Übereinkunft der Gemeinschaftsglieder untereinander. Dazu sind Prozesse der Meinungsbildung erforderlich, in denen die Menschen in Grundfragen des Gemeinschaftslebens zu gewissen Übereinstimmungen kommen können. An diesem geistigen Austausch und an der Wahrheitsfindung sind alle Glieder der Gemeinschaft je auf ihre Weise beteiligt.
Auch in der Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen ist eine öffentliche Meinungsbildung erforderlich. Papst Pius XII. betont, daß die öffentliche Meinung die Mitgift jeder normalen Gesellschaft sei und daß im Leben der Kirche etwas fehlen würde, wenn in ihr die öffentliche Meinung fehlte (vgl. UG 2151).
Jeder hat das Recht und die Pflicht, entsprechend seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten seine Wertvorstellungen und Überzeugungen in die Öffentlichkeit einzubringen und so an der Bildung der öffentlichen Meinung mitzuwirken, denn die öffentliche Meinung ist von großer Bedeutung für die weltanschauliche und politische Willensbildung wie für rechtliche, ethische und politische Entscheidungen. Der einzelne hat die Pflicht, seine Möglichkeit wahrzunehmen, darauf Einfluß auszuüben. Nicht selten melden sich kleine, aber lautstarke Gruppen zu Wort, die keineswegs für die Gesamtheit repräsentativ sind, während die große Mehrheit schweigt.
Christen dürfen nicht untätig zusehen, wenn sich in der Öffentlichkeit ein Klima ausbreitet, in dem der Sinn für bleibend gültige Werte und für Religion und Kirche zurückgeht oder verdrängt wird. Sie müssen ihre Überzeugungen in die Gesellschaft einbringen und in der Öffentlichkeit dafür Sorge tragen, daß jede Art von Manipulation der öffentlichen Meinung entlarvt wird. Ihr Beitrag muß kritisch und konstruktiv zugleich sein. Er muß Zeugnis davon geben, daß die ganze Wahrheit über den Menschen in Jesus Christus offenbar geworden ist.
Unsere heutige Gesellschaft ist eine "offene Gesellschaft". Sie ist nach "oben" und nach "innen" offen. Sie bietet Raum für religiöse Bezüge wie für den öffentlichen Dialog über Werte, politische Überzeugungen und konkrete gesellschaftliche Anliegen. Dieser Dialog kann nur gelingen, wenn alle, die an ihm teilnehmen, jene Voraussetzungen erfüllen, die für ein gemeinsames Gespräch über Werte und Güter der Gemeinschaft unerläßlich sind. Alle müssen aufeinander hören, einander verstehen lernen und andere Standpunkte gelten lassen, auch wenn sie diese für sich selbst nicht akzeptieren können. Wer versucht, sich rücksichtslos über andere hinwegzusetzen und seine Auffassung mit aller Macht durchzusetzen, wird den Erfordernissen des Dialogs nicht gerecht.
Zum menschlichen Umgang miteinander gehört immer die Haltung der Toleranz. Sie verlangt, daß ein Mensch darauf verzichtet, den anderen auf etwas festzulegen, was dieser nicht anerkennen kann. Toleranz gönnt dem anderen sein Anderssein, sie erträgt dieses Anderssein und schützt es gegenüber der Bedrohung durch Macht und Gewalt. Deshalb ist Toleranz besonders dort am Platz, wo Minderheiten ihre berechtigten Ansprüche nur ungenügend in die Öffentlichkeit einbringen können. In der Haltung der Toleranz gibt der Christ keineswegs die im Glauben erkannte Wahrheit auf, aber er respektiert die Würde der Person des anderen in dessen persönlicher Überzeugung, die er selbst nicht teilt.
5.2. Wahrheitserkenntnis durch Wissen und Bildung
Der Mensch als geistiges Wesen ist auf Wahrheit und Wahrheitserkenntnis angelegt. Er ist befähigt und bestrebt, Erkenntnis und Wissen zu gewinnen. Er will erkennen, "was die Welt im Innersten zusammenhält" (Goethe, Faust I). Der Mensch will wissen, wie es um den Menschen steht und wie er das menschliche Leben und Zusammenleben human gestalten kann. Dazu ist es notwendig, daß alle Menschen am Wissen und an der Kultur der Gesellschaft teilhaben können.
Die fortschreitende Beherrschung der Welt durch Wissenschaft und Technik stellt den heutigen Menschen vor eine solche Fülle von Anforderungen, daß er faktisch zu einem lebenslangen Lern- und Bildungsprozeß herausgefordert ist. Die moderne Gesellschaft ist eine "Lern- und Bildungsgesellschaft" mit einem "Bildungswesen", das ständig fortentwickelt wird. Sie nimmt durch das Bildungswesen entscheidenden Einfluß auf das Leben des einzelnen und der Gemeinschaft (vgl. BB 1.1). Wer versucht, sich den Anforderungen dieser Gesellschaft zu entziehen, bleibt zurück und verliert die Fähigkeit, die wissenschaftlich-technischen und sozialen Prozesse zu verstehen und aktiv an ihrer Gestaltung mitzuwirken.
Der Erwerb von Wissen und Bildung ist nicht nur ein Grundrecht (vgl. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948, Art. 26), sondern auch eine Pflicht. Schulbildung, Umschulung, Weiterbildung und Erwachsenenbildung eröffnen allen Bürgern die Möglichkeit, sich so zu bilden, daß sie in der heutigen Gesellschaft "zurechtkommen", am wissenschaftlich-technischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben teilhaben und ihre Ziele und Wertvorstellungen in die Gesellschaft einbringen können.
Für Christen liegen die obersten Ziele von Erziehung und Bildung "in der Entfaltung der menschlichen Anlagen, in der Befähigung des Menschen zum Dienst an den Mitmenschen, an der Welt und am Reich Gottes" (BB 1.2.2).
Diese Zielvorstellung geht davon aus, daß der Mensch von Gott nach seinem Bild "gebildet" ist. Der Christ wird durch den Glauben "in Jesus Christus hineingebildet". Er soll dieses "Im-Glauben-gebildet-Sein" durch das Zeugnis seines Glaubens und durch seine Lebenspraxis in die jeweilige Kultur einbringen. Durch ihr gelebtes Zeugnis tragen Christen dazu bei, daß die Menschen in der modernen Gesellschaft nicht von ihrem eigentlichen Sinn- und Orientierungsziel entfremdet werden. Denn heute besteht die Gefahr, daß sich eine Art von Bildung entwickelt, in der die Frage nach der Wahrheit über den ganzen Menschen auf Wissen und technisches Können eingeengt oder durch Ideologien verfälscht wird. Das "Im-Glauben-gebildet-Sein" ist nicht ein Überbau oder eine Überformung von Kultur und Bildung. Es respektiert die Eigengesetzlichkeit der gesellschaftlichen Entwicklung, ihrer Kultur und ihrer Bildung (vgl. GS 19). Es begreift das Verhältnis von Glaube und Kultur als ein Wechselverhältnis, in welchem sich beide gegenseitig bereichern und unterstützen (vgl. GS 57f). Voraussetzung dafür ist, daß in der pluralistischen Gesellschaft der gesamte Bildungsbereich auf wesentliche Wahrheiten des christlichen Menschenbildes und der christlichen Ethik hin offen ist.
Der kritische Beitrag der Christen zu einem Bildungswesen, das dem wahren Bild vom Menschen entspricht, besteht darin, daß die Wahrung der Grundrechte eingefordert und vor einseitigen Tendenzen gewarnt wird.
- Der Staat kann von sich aus nicht alle Inhalte und Ziele der Bildung festlegen, denn er besitzt nicht die ganze Wahrheit über den Menschen. Ein staatliches Bildungsmonopol steht im Widerspruch zum Recht auf Mitwirkung jener gesellschaftlichen Kräfte, die in der Suche nach Wahrheit über den Menschen Werte und Normen begründen, welche für das Zusammenleben unerläßlich sind.
- Das Bildungswesen darf die je eigengeartete Zuständigkeit der Eltern, der gesellschaftlichen Einrichtungen und des Staates im Bereich von Erziehung und Bildung nicht unterhöhlen und ihre jeweiligen Rechte und Pflichten nicht unzulässig beschneiden.
- In Erziehung und Bildung darf nicht nur der Verstand angesprochen, sondern auch kein übermäßiger Leistungsdruck verursacht und keine ideologische Beeinflussung ausgeübt werden.
- In den einzelnen Bildungsvorgängen dürfen Toleranz und Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit nicht herabgemindert werden.
- In der modernen Leistungsgesellschaft dürfen Behinderte, Minderheiten und Einwanderer nicht ausgegrenzt und nicht vernachlässigt werden. Am Maß der Sorge für sie läßt sich das Maß an wahrer Humanität einer Gesellschaft erkennen.
Der konstruktive Beitrag der Christen zu wahrhaft humaner Gestaltung des Bildungswesens besteht vornehmlich darin, dafür Sorge zu tragen, daß in den Bereich von Erziehung und Bildung auch Glaubenserziehung und religiöse Bildung eingebracht werden. Dies geschieht durch die Verkündigung der Wahrheit des Evangeliums und durch die Bezeugung des Glaubens im Leben. Die Wahrheit des Evangeliums umfaßt viele Fragen, vor denen das menschliche Wissen verstummt: nach dem Woher und Wohin, nach Leid und Tod, nach Schicksal und Sünde.
Religiöse Bildung ist nicht eine fromme Zugabe zu der im sonstigen Bildungswesen vermittelten Erziehung und Bildung, sondern sie ist die Bemühung, vom Glauben her den Menschen ganzheitlich zu formen. Sie erschließt Sinn und Wert des Menschen und der Welt von Gott her und auf Gott hin und vermittelt jene Werte, die den Menschen helfen, für ihr Leben Orientierung zu finden.
Religiöse Bildung lenkt den Blick von Gott her auf die Liebe zum Nächsten hin. Diese soll das soziale Leben durchtränken und in der von Macht und Recht, von Streit und Haß, von Schuld und Sünde bestimmten Wirklichkeit zum Leben in Liebe führen, die keinen Menschen, auch den Feind nicht, von der Liebe ausschließt.
Religiöse Bildung vermittelt in besonderer Weise Solidarität mit den Benachteiligten und Behinderten, die kaum eine Chance sehen, sich aus ihren sozialen Verhältnissen zu befreien. Religiöse Bildung öffnet auch den Blick für die Nöte der Menschen.
Religiöse Bildung macht kritisch gegen die Manipulation der Wertwelt durch Massenmedien und den dadurch verstärkten Konformitätsdruck der Gesellschaft. Sie befähigt zu eigenständiger Stellungnahme und zu einem gebildeten Gewissen.
Aus alldem wird deutlich, daß die Frage nach Wissen und Bildung zutiefst eine Frage nach der Wahrheit über den Menschen, über seine Herkunft und sein Ziel, über seine Rechte und Pflichten und über seine wahre Orientierung vor Gott, in der Gemeinschaft der Menschen und in der Lebenswelt der Schöpfung ist.
5.3. Dienst an der Wahrheit in Wissenschaft und Technik
In der Entwicklung der heutigen Gesellschaft und ihrer Kultur ist von besonderem Belang der Beitrag der Naturwissenschaften. Ihr Ziel ist die Beschreibung der Natur und ihrer Eigenschaften sowie die Erkenntnis der Naturgesetze. Wissenschaft will aber nicht nur wissen, sie will Wissen auch anwenden: auf die Natur, auf die Wirtschaft, auf die Gesellschaft und auf den Menschen selbst. Wissenschaft und Forschung - und dies gilt nicht allein im Blick auf die Naturwissenschaften - leben somit nicht in einem "elfenbeinernen Turm", sondern stehen immer schon in Beziehung zur Praxis: Sie sind erkenntnis- und handlungsorientiert zugleich.
Damit stellt sich aber für die Wissenschaft und Forschung die Frage nach der Verantwortung für das, was sie als Ziel anstreben und was sie als mögliche - gute oder schlechte - Folge voraussehen. Der Wissenschaft und Forschung kann es deshalb nicht nur um das gehen, was ist, sondern um das, was in wahrem Sinne gut und richtig ist. Darum sind Wissenschaftler und Forscher verpflichtet, ihre Ziele und Methoden offenzulegen und sie vor der Gemeinschaft der Menschen zu verantworten.
Wissenschaft und Forschung haben zu Ergebnissen geführt, die für die Menschheit von großem Nutzen sind. Mehr und mehr stellen wir heute aber die Frage, ob der Mensch in seinem Erkenntnisdrang nicht Schwellen überschritten hat, die tödlich sein können. Man erinnert in diesem Zusammenhang an die Uranspaltung, die das Atomzeitalter mit allen seinen Konsequenzen eröffnete; man verweist auf die moderne Biotechnik, die mit den kleinsten Bausteinen des Lebens operiert und in der Lage sein wird, das Leben auf der Erde zu manipulieren; und man stellt die vielen Eingriffe in die Natur vor Augen, die den kommenden Generationen vielleicht untragbare Lasten aufbürden oder gar ihre weitere Lebensgrundlage zerstören. Das alles läßt uns fragen, ob es nicht Grenzen gibt, die der Mensch einhalten muß.
Innerhalb der Wirklichkeit der Welt gibt es keine Sperrbezirke und keine Tabuzonen, die dem menschlichen Geist endgültige Schranken entgegenstellen. Zuwachs an Wissen und Erkenntnis ist ethisch positiv zu bewerten. Es entspricht dem Menschen und seinem forschenden Geist, daß er den Ursachen der Dinge auf den Grund zu kommen versucht. Es ist ein Urbedürfnis, den Zusammenhang aller Wirklichkeiten der Welt zu erklären und zu deuten. Eine Begrenzung wird kaum mit dem Grundrecht der Freiheit der Forschung zu vereinbaren sein. Sie würde auch nicht der Weltsicht entsprechen, die uns der Glaube vermittelt.
Die Freiheit der Forschung darf von keiner Macht in dem Sinne eingeschränkt werden, daß dem Suchen nach Erkenntnis und Wahrheit vorgeschrieben würde, was als wahr zu gelten hat. Die Freiheit, wissenschaftlich nach Erkenntnis zu suchen, hat im Rahmen der Menschenrechte den gleichen Rang wie die Glaubens-, Bekenntnis- und Gewissensfreiheit. Deshalb haben rechtsstaatliche Verfassungen dieses Recht auch als Grundrecht garantiert (vgl. Art. 5, Abs. 3 GG).
Damit ist aber die Frage nach der Verantwortbarkeit der praktischen Anwendung von Wissenschaft und Forschung nicht erledigt. Es wäre ein Mißverständnis, anzunehmen, daß sich aus der Freiheit der Wissenschaft unvermittelt die Freiheit ihrer Anwendung ergäbe. Jede praktische Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse bedarf der Rechtfertigung durch sittlich vertretbare Gründe. Ob eine wissenschaftliche Erkenntnis in die Praxis umgesetzt werden darf, hängt davon ab, ob und wie sich ihre Methoden, ihre Ziele und ihre Folgen sittlich rechtfertigen lassen.
Es besteht kein Anlaß, unsere technisch-wissenschaftliche Kultur als gegensätzlich zur Schöpfungswelt Gottes zu sehen. Technische, auf Weltveränderung gerichtete Wissenschaft rechtfertigt sich durch ihren Dienst am Menschen und an der Menschheit.
Von daher ergeben sich bezüglich der Methoden, Ziele und Folgen der Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse wichtige Konsequenzen:
- Bei den Methoden der Forschung ist Rücksicht zu nehmen auf die Sicherheit der Menschen, die an der Forschung beteiligt sind. So dürfen zum Beispiel keine verbrauchenden Experimente an menschlichen Embryonen vorgenommen werden. Die Freiheit der Forschung berechtigt auch nicht dazu, leidensfähigen Tieren ohne schwerwiegenden Grund Schmerzen zuzufügen. Methoden und Mittel sind nicht immer wertneutral. Die Erlaubtheit ihrer Anwendung ist vom Ziel, das erreicht werden soll, aber auch von den Folgen, die unabhängig vom Ziel durch Methoden und Mittel bewirkt werden, mitbestimmt.
- Ziel der handlungsorientierten Forschung müssen der Mensch und seine Lebenswelt sein. Ihre Freiheit hat eine unaufhebbare Grenze an der Würde und Selbstbestimmung des Menschen. Kein noch so wünschenswertes oder nützliches Ziel kann rechtfertigen, daß der Mensch gegen seinen Willen und gegen sein Lebensrecht als bloßes Forschungsobjekt benutzt wird. Die Wissenschaft hat kein Recht, über Menschen zu verfügen. Bittere Erfahrungen machen uns skeptisch gegenüber der Behauptung, es gehe um nichts anderes als um reine Forschung. Wissenschaft und Forschung sind oft auch interessegeleitet und deshalb korrumpierbar.
- Von den Folgen her ist eine absolute Grenze der Wissensfreiheit gegeben, wo ihre mögliche Anwendung zur Zerstörung der Lebensgrundlage der heutigen oder der künftigen Generation führt. Wissenschaft ist nur dann "wahre" Wissenschaft, wenn die Verantwortlichen die absehbaren Folgen ihres Handelns kritisch prüfen.
Wissenschaft und Forschung sind zu messen an ihrem Beitrag zur Humanisierung der Lebenswelt. Deshalb können Methoden, Ziele und Folgen mancher wissenschaftlicher Erkenntnisse nicht von den Wissenschaftlern allein festgelegt werden. So haben zum Beispiel Forscher, die mit Gentechnologie befaßt sind, ihre Forschungsvorhaben zu rechtfertigen, denn nicht der einzelne Forscher, ein Forschungsteam oder gar die Techniker und Manager haben die Ziele zu bestimmen, sondern die Gesellschaft. Parteien, Parlamente, Regierungen, Experten aus anderen Wissenschaften und Ethik-Kommissionen haben die ethische Rechtfertigung von wissenschaftlichen Vorhaben an Wertvorstellungen zu messen, die als Gemeingut der Menschheit gelten. Dieser Grundsatz wird allerdings problematisch, wenn kein Wertekonsens besteht. Es ist notwendig, daß Wissenschaft und Forschung über ihre Vorhaben redlich informieren. Das gilt bereits für die Grundlagenforschung, die heute zum größten Teil anwendungsorientierte und experimentelle Wissenschaft ist.
5.4. Wahrhaftigkeit im politischen Leben
Die Politik hat ein besonders nahes Verhältnis zum öffentlichen Informations- und Meinungsbildungsprozeß. Sie ist darauf angewiesen, sich dem Bürger verständlich zu machen und seine Zustimmung zu finden. Sie hat sich in einem demokratischen Staat zu rechtfertigen und der Kritik der Bürger zu stellen. Sie hat zu informieren, muß aber auch qualifizierte Stellungnahmen der Gesellschaft zur Kenntnis nehmen und sich gegebenenfalls daran orientieren.
Der Politiker schuldet der Öffentlichkeit Wahrhaftigkeit und Treue zum gegebenen Wort. Die Glaubwürdigkeit des Politikers erweist sich daran, wieweit sein Wort und seine Rede wahr sind und wieweit er zu seinem Wort steht. Kurzfristig mag ein Verschleiern oder ein Abweichen von der Wahrheit Vorteile bringen, längerfristig kann es der Sache selbst, dem eigenen Ruf und dem Zusammenwirken mit anderen nur schaden.
Für die Wahrung der Wahrhaftigkeit im öffentlichen Leben spielt immer auch die kritische und unkritische Haltung der Gesellschaft eine Rolle. Wer leichtfertig übertriebenen Wahlversprechen Vertrauen schenkt und dem entsprechenden Politiker seine Stimme gibt, trägt dazu bei, daß auch künftig Menschen getäuscht werden. Die Reaktion der Öffentlichkeit bestimmt auch immer mit, was in den Medien an das Volk herangetragen wird.
Politiker sind oft gezwungen, ihren Standpunkt und ihre Einsichten in einer stark vereinfachten Form vorzutragen. Schwierige Zusammenhänge werden mit Schlagworten wiedergegeben, politische Werbung verkürzt sich zu Parolen. Oft wird diese Tendenz durch die Medien noch verstärkt. Das kann unter Umständen zu politischer Entmündigung der Bürger führen. Deshalb ist es notwendig, daß wichtige politische Standpunkte in öffentlichen Diskussionen erläutert werden. Darüber hinaus verlangt die politische Mitverantwortung der Bürger eine weitgehende Information über umstrittene Sachprobleme.
Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit des Politikers sind durch Einflußnahme verschiedener Gruppen und Verbände, die ihre Interessen durchsetzen wollen, gefährdet. Hier kommt es für den Politiker darauf an, unparteiisch zu bleiben und den berechtigten Ansprüchen aller Bürger Rechnung zu tragen. Gegenüber allen versteckten und offenen Formen von Bestechung muß ein Verantwortlicher in der Gesellschaft wachsam und unabhängig sein und Standhaftigkeit zeigen.
5.5. Rede- und Pressefreiheit, Freiheit der Kunst
Wie es einem Menschen erlaubt ist, sich ein eigenes Gewissensurteil zu bilden, so gibt es auch das Recht, anderen mitzuteilen, was er für richtig und notwendig hält. Das gehört zu einem demokratischen Gemeinwesen. Es hat in der neuzeitlichen Freiheitsgeschichte immer nachdrücklicher zur Rede- und Pressefreiheit und zur Freiheit der Kunst geführt. Rede- und Pressefreiheit sind ein notwendiger Teilaspekt der Freiheit in der Gesellschaft. Wo dieses Recht nicht gewährleistet ist, besteht die Gefahr, daß Überzeugungen und Gewissensentscheidungen mißachtet und Zwangsmaßnahmen auferlegt werden, die in Widerspruch zum Recht auf Gewissensfreiheit stehen. Es ist deshalb unerläßlich, daß die Medien einen angemessenen Raum für die Vermittlung unterschiedlicher Meinungen und Standpunkte haben. Problematisch sind Medien, die eine Monopolstellung haben, wie auch solche, die ganz vom Staat kontrolliert und zensiert werden.
- "Im Einklang mit diesen Grundsätzen sind Freiheit der Kommunikation und Recht auf Information durch Gesetze zu schützen und ihr ungehinderter Gebrauch gegen Gewalt sowie gegen jeden wirtschaftlichen, politischen und ideologischen Druck ausreichend abzusichern. Den Staatsbürgern muß durch ein Gesetz eine volle Kontrollmöglichkeit der gesamten Verwaltung von Kommunikationsmitteln garantiert werden, besonders dann, wenn ein Monopol, und erst recht, wenn ein staatliches besteht. Es unterliegt heute keinem Zweifel, daß eine Kommunikationsgesetzgebung erforderlich ist. Sie muß eine ausreichende Vielfalt in den Medien wirksam schützen vor dem Druck wirtschaftlicher Marktgesetze, der eine übermäßige Konzentration zu erzwingen droht. Ebenso muß sie den guten Ruf der einzelnen und der Gruppen sowie die Werte der Kultur verteidigen und schließlich Voraussetzungen dafür schaffen, daß die Ausübung der Religionsfreiheit auch in den Medien gewährleistet ist" (Päpstlicher Rat für die sozialen Kommunikationsmittel, Pastoralinstruktion "Communio et progressio" über die Instrumente der sozialen Kommunikation, 87).
Rede- und Pressefreiheit sollen sicherstellen, daß der Bürger verantwortlich an der Gestaltung des gemeinschaftlichen Lebens mitwirken und darauf Einfluß nehmen kann.
Die Freiheit der Medien hat aber auch Grenzen. Journalisten tragen in der Ermittlung von Fakten und in der Veröffentlichung von Kenntnissen eine große Verantwortung. Ihre Freiheit darf nicht so weit gehen, daß sie ohne zwingenden Grund in die Privatsphäre des einzelnen eindringen. Das private Leben des Bürgers ist nur so weit einer öffentlichen Verantwortung unterworfen, als es für das Gemeinwohl wichtig ist. Bloße Neugierde der Öffentlichkeit rechtfertigt nicht den Einbruch in die Privatsphäre des einzelnen.
Die Freiheit der Presse und der anderen Medien hat ferner dort Grenzen, wo die Gefahr der Preisgabe von Staatsgeheimnissen besteht. Ebenso liegt ein Mißbrauch vor, wenn Verdächtige oder Angeklagte bereits vor dem Gerichtsurteil als Schuldige vorverurteilt werden. Die Grenzen der Pressefreiheit sind auch dort überschritten, wo versucht wird, für staatsgefährdende Ideologien zu werben. Die Eingrenzungen dürfen aber nicht zu eng gesetzt werden, weil es sonst leicht zu Reglementierungen kommen kann, die das Gut der Freiheit in unzulässiger Weise einschränken.
Die katholische Kirche bekennt sich nach Zeiten großer Unsicherheit heute eindeutig zur Pressefreiheit:
- "In Anerkennung der berechtigten Freiheit bejaht die Kirche die rechtmäßige Eigengesetzlichkeit der Kultur und vor allem der Wissenschaften. Damit ist auch gefordert, daß der Mensch unter Wahrung der sittlichen Ordnung und des Gemeinnutzes frei nach der Wahrheit forschen, seine Meinung äußern und verbreiten und die Kunst nach seiner Wahl pflegen kann; schließlich, daß er wahrheitsgemäß über öffentliche Vorgänge unterrichtet werde" (GS 59).
Auch die Freiheit der Kunst ist ein hohes Gut. Auch in ihr geht es um die Wahrheit des Menschen. Die Kunst bringt oft in besonders feinfühliger Weise zum Ausdruck, was die Menschen bewegt. Das geschieht in der abbildenden (Malerei, Plastik) und in der darstellenden Kunst (Theater, Film) wie in der Literatur (Gedichte, Romane, Erzählungen) und in der Musik. Sie sind für das Verstehen der Gegenwart und des Menschen von großer Wichtigkeit. Die Einschränkung der Freiheit der Kunst ist bezeichnend für Diktaturen. Sie sind bestrebt, die Künstler zu bevormunden und sie nicht zu freier Entfaltung kommen zu lassen.
Die Freiheit der Kunst hat aber auch Grenzen. Darstellungen, die durch Hetze den Frieden von Völkern und Volksgruppen gefährden, Gewalt als Mittel von Konfliktlösungen propagieren oder das Schamgefühl und das religiöse Bewußtsein verletzen, überschreiten die Grenzen des sittlich Zulässigen.
Im Umgang mit der Kunst haben viele Menschen Verständnisschwierigkeiten. Nicht selten sind Künstler ihrer Zeit voraus oder finden in ihr noch keine Anerkennung. Weder das allgemeine Empfinden einer Zeit noch der Geschmack und das ästhetische Gefühl einzelner können Kriterien der Kunst sein. Hier bedarf es der Toleranz des Publikums wie der Künstler.
"Soweit sich die Kunst von der Wahrheit der Geschöpfe und der Liebe zu ihnen inspirieren läßt, weist sie eine gewisse Ähnlichkeit mit der Tätigkeit Gottes in der Schöpfung auf. Wie jede andere menschliche Tätigkeit hat die Kunst ihr absolutes Ziel nicht in sich selbst, sondern empfängt ihre Ordnung vom letzten Ziel des Menschen und wird durch dieses veredelt" (KKK 2501).
5.6. Reklame und Werbung
In unseren modernen Gesellschaften begegnen wir einer Flut von Reklame und Werbung. Sie sind Instrumente der Unternehmen, die in freiem Wettbewerb ihre Produkte auf den Markt bringen; sie stellen deren Wert und Vorzüge heraus. Werbung ist nahezu allgegenwärtig in der modernen Gesellschaft; sie präsentiert Wünschenswertes für viele, ganz unabhängig davon, ob auch alle, die davon erreicht werden, eine Chance haben, sich diesen und jenen Wunsch zu erfüllen. Dadurch wirkt sie häufig deprimierend, ja zynisch. Ihrer Eigengesetzlichkeit gemäß stellt sie die Welt geschönt dar und engt den Sinn menschlicher Lebenserfüllung auf den Konsum ein. Die Versuchung, um des Verkaufsinteresses willen nur Teilwahrheiten einzusetzen und dadurch Verzerrungen im Urteil möglicher Kunden hervorzurufen, ist groß.
In modernen Gesellschaften werden für die Wirtschaftswerbung große Summen ausgegeben. Das "Unternehmen Werbung" mit Werbeagenturen, Werbeberatern und Marketing ist ein Wirtschaftszweig, der in hohem Maß den Absatz reguliert und den Markt gestaltet. Wettbewerb und Werbung haben in der modernen Gesellschaft einen so hohen Rang erworben, daß sich der Gesetzgeber veranlaßt sieht, durch seine eigene Gesetzgebung unlauteren Wettbewerb auszuschließen und die Verbraucher vor Mißbräuchen der Werbung zu schützen. Dazu sind eigens Verbraucherschutzzentralen eingerichtet worden.
Die rechtliche Regelung bietet zwar einen gewissen Schutz für den Konsumenten, zieht aber kaum die ethische Verantwortung bei der Gestaltung der Werbung in Betracht. Diese ist aber von großer sozialethischer Bedeutung, denn der Zweck der Werbung, die Ware an den Käufer zu bringen, kann leicht dazu führen, daß Menschen verführt werden. Nicht Manipulation darf ihre Aufgabe sein, sondern sachliche Information, die zu einer verantworteten Kaufentscheidung beitragen kann.
Es ist nicht unberechtigt, daß sich heute viele Menschen gegen die Überflutung durch Reklame und Werbung wehren, denn vielfach gehen Werbung und Reklame über das ethisch Vertretbare hinaus. Sie propagieren Glücksverheißungen, die von den angepriesenen Produkten nicht erfüllt werden können; sie schaffen künstliche Bedürfnisse, die einem humanen Lebensstil wenig entsprechen; sie erzeugen eine Kultur des übermäßigen Konsumierens; sie verführen zu einseitig materiellen Lebenseinstellungen; und sie lenken den Blick auf Scheinwerte und auf eine Scheinwelt, die der Realität nicht standhält.
Oberster sittlicher Grundsatz der Werbung muß sein: Wahrhaftigkeit in der Aussage. Die Werbung für ein Produkt muß redlich sein; der versprochene Nutzen muß zu den Kosten in einem angemessenen Verhältnis stehen; und der durch das erworbene Produkt gewonnene Wert muß mit anderen humanen Werten in Einklang gebracht werden können. Werbung muß auch Vertrauen zu den produzierten Gütern schaffen und rechtfertigen. Wahrhaftigkeit in der Werbung achtet die Würde des Menschen und verhindert, daß Wirtschaft, Produktion und Konsum zum Selbstzweck werden.
5.7. Datenerfassung und Datenschutz
Jeder Mensch braucht eine Privatsphäre, in die nicht jedermann nach Belieben eindringen darf. Freiheit und Würde der Person verbieten, daß man unbeschränkt der Beobachtung und Kontrolle von außen ausgesetzt ist. Um dieses Problem geht es beim Datenschutz. Auf Grund moderner Methoden der Datenverarbeitung und der personbezogenen Datenerfassung wird dieses Problem als besonders gewichtig empfunden.
Viele fühlen sich durch die fortschreitende Datenerfassung in ihrem Recht auf Wahrung der Privatsphäre bedroht. Manche befürchten eine Benachteiligung zum Beispiel bei der Bewerbung um eine Arbeitsstelle, wenn der Arbeitgeber Zugang zu persönlichen Daten über Kontobewegungen, Krankheiten und Gesundheitszustand eines Bewerbers oder einer Bewerberin hat.
Moderne Datenverarbeitung (EDV) erleichtert zwar viele Aufgaben in Wirtschaft, Technik und Verwaltung, in der Verfolgung Krimineller ("Rasterfahndung") oder in der Aufdeckung von Steuervergehen, aber sie kann auch, besonders im Gesundheits- und Sozialwesen, zu einer unerträglichen Überwachung und Manipulation führen, die den Menschen zum bloßen Objekt macht und ihm keinen Raum für eine freie Entfaltung läßt. Datenspeicherung ist deshalb nur dann zu vertreten, wenn ein höheres und überprüfbares öffentliches Interesse vorliegt. Ein besonderer Schutz ist personenbezogenen Daten zu gewähren.
Die Notwendigkeit des Datenschutzes ist für die einzelnen Bereiche unterschiedlich. Es gibt Werte, die dringlicher sind als der Schutz der Privatsphäre. Das gilt besonders bezüglich der äußeren oder inneren Sicherheit des Staates. Es wäre aber eine schwere Verletzung der Würde der Person, wenn auf Grund des Verbundes (Online-Verbund) zwischen verschiedenen Computern die zentral gespeicherten personenbezogenen Daten abgerufen werden und sich Unbefugte Einblick in die persönlichen Daten verschaffen könnten.
Informationen, die aus der Datenspeicherung gewonnen werden, ergeben eine gewisse Macht über Personen und Gruppen, ermöglichen Machtmißbrauch und können zu einer Verfügbarkeit führen, der sich der einzelne nicht entziehen kann. Die Kenntnis von Daten über die Vergangenheit eines Menschen birgt die Gefahr in sich, daß er nach seinen früheren Verhaltensweisen beurteilt wird. Man begegnet einem Straffälligen, um dessen früheres Vergehen man weiß, eher mit Mißtrauen und gibt ihm nicht leicht eine Chance zu einem neuen Anfang. Auch Kranke, deren Verfassung man kennt, können dadurch benachteiligt sein.
Der Mensch hat ein Recht darauf, von anderen nicht völlig durchschaut und registriert zu werden. Er fürchtet sich mit Recht vor der Allmacht des "Großen Bruders" (George Orwell, "1984"), des Tyrannen, der alles sieht, weiß und bestimmt, und vor der Allgegenwart eines Computerstaates, dem auf Knopfdruck alle Informationen über seine Bürger verfügbar sind.
Die Achtung der Personwürde verlangt, daß der Mensch nicht zum "gläsernen Menschen" wird, der von allen Seiten durchschaubar ist. Jeder Mensch hat Anspruch darauf, er selbst bleiben zu können. Niemand darf ihn restlos verplanen. Ausreichender Datenschutz ist daher sittlich wie rechtlich gefordert. Rechtliche Regelungen durch den Staat sollten der Datenerfassung äußerst enge Grenzen setzen. Kommunikation ist nur möglich, wenn ein Menschenbild bejaht wird, das in Selbstbestimmung, Verantwortung und Vertrauen gründet.
== Schluß: Am größten ist die Liebe - Bleiben in der Liebe ))
Mitte und Einheitsgrund des christlichen Lebens ist die Liebe. Ob es um die Beziehung zu Gott, zu den Mitmenschen, zu gesellschaftlichen Institutionen oder zur Schöpfung geht, immer ist es die Liebe, die alles trägt und bewegt. Von ihr strahlt alle Kraft aus; sie durchdringt jede gute Gesinnung und jede rechte Tat; sie ist Gabe und Aufgabe unseres Lebens. Die christliche Liebe ist in der Liebe Gottes verankert, die uns in Jesus Christus erschlossen ist, durch ihn vermittelt und durch ihn aufgetragen wird. Darum sagt Jesus: "Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe!" (Joh 14,9).
Wer bereit ist, sich vom Geschenk der Liebe ergreifen zu lassen und in der Liebe zu bleiben, lebt aus einem Ethos gelingenden Menschseins, in dem er seine individuelle Identität und seine gesellschaftliche Position gefunden hat. Die Liebe ist ein Ethos, das den Menschen befreit und froh macht. In ihr geht er seinen Weg, der ihm Orientierung auf das Ziel seines Lebens hin ist. Sie ist ein Anruf zu freier Selbstentscheidung für das Gute, eine Herausforderung unseres Autonomiestrebens, eine ständige Anfrage an unser Gewissen.
Dabei stoßen wir auf Widerstände und Hemmnisse. Es gibt ein Zurückbleiben und Versagen, aber auch ein Wachsen in der Erkenntnis, eine Umkehr aus Verirrungen und ein Reifen in der Liebe auf die Vollendung hin, auf die endgültige Begegnung mit Gott.
Im Brief an die Gemeinde von Rom schreibt der Apostel Paulus: "Bleibt niemand etwas schuldig; nur die Liebe schuldet ihr einander immer. Wer den andern liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote: Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren!, und alle anderen Gebote sind in dem einen Satz zusammengefaßt: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst" (Röm 13,8f).
In diesen Worten werden die Gebote der zweiten Tafel des Dekalogs auf einen Nenner gebracht. Der Blick richtet sich hier ganz auf das Zusammenleben der Menschen. Die Aufgaben in der Gemeinschaft erhalten einen bevorzugten Platz. Gleichwohl denkt Paulus von Gott her, dem alle Christen den gebührenden Gottesdienst schulden. Am Anfang seiner sittlichen Mahnrede schreibt er: "Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt; das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst" (Röm 12,1). Wahrer Gottesdienst soll sich im "Alltag der Welt" erfüllen.
Damit steht der Apostel im Einklang mit dem von Jesus gelehrten Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe. Die Zusammenbindung der beiden Gebote hat den Sinn, die Liebe unter den Menschen auf die Liebe zu Gott zu gründen und sie als Erweis und Bewährung der Gottesliebe zu sehen. Es gibt keine Gottesliebe ohne Nächstenliebe (vgl. Joh 3,17; 4,12.19-21).
Die Liebe zu Gott schärfen Paulus und das frühe Christentum weniger durch Forderungen ein als dadurch, daß sie ihr durch Lobpreisungen, Lieder und Hymnen Rechnung tragen. "Wir haben nur einen Gott, den Vater. Von ihm stammt alles, und wir leben auf ihn hin" (1 Kor 8,6). Die Liebe zu Gott bedarf keiner ausdrücklichen Erwähnung; sie spiegelt sich in Lob und Dank als Antwort auf die von Gott erfahrene Liebe wider. Im Gotteslob besinnt sich die christliche Gemeinde auf ihre Verpflichtung vor Gott und den Menschen und wird ermutigt, immer neu die Liebe zu wagen.
Was Liebe im christlichen Sinn ist, kommt nirgends schöner und kräftiger zum Ausdruck als im "Hohenlied der Liebe" (1 Kor 13). Hier ist zunächst nicht von der Nächstenliebe die Rede. Am Anfang steht die religiöse Blickrichtung. "Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke" (V. 1). Unser Verhalten zu Gott stützt sich nicht auf außergewöhnliche Gaben, nicht auf Prophetie, Erkenntnis göttlicher Geheimnisse oder bergeversetzenden Glauben (V. 2), sondern auf die Liebe. Ohne sie ist der Mensch ein "Nichts" (V. 2). Letzte Entsagung, Verzicht auf die ganze Habe und Opfer des Lebens (V. 3) nützen nichts, wenn nicht die Liebe dabei ist. Erst sie gibt allem Tun seinen Wert. Dahinter steht das Wissen um den Gott der Liebe und um Jesus Christus, der sich aus Liebe für uns dahingegeben hat (Gal 2,20; vgl. Eph 5,2).
Nach diesem Loblied auf die Gottesliebe preist Paulus die Liebe, wie sie sich im menschlichen Miteinander zeigt und entfaltet: "Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren eigenen Vorteil, läßt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach" (V. 4). In dieser Darstellung, die eine Art Selbstvorstellung der Liebe ist, werden falsche Verhaltensweisen zurückgewiesen: Prahlen, Sich-Aufblähen, ungehöriges Benehmen, Vorteil-Suchen, Zorn, Nachtragen des Bösen. Die Liebe überwindet alle eigensüchtigen und verderblichen Strebungen, saugt gleichsam das Böse im Menschen auf und verändert den Menschen. Sie verleiht Langmut und Güte (V. 4), schenkt Freude an der Wahrheit (V. 6), erträgt Belastungen und hält in Enttäuschungen stand (V. 7). Paulus redet hier in einer poetischen Sprache, aus der seine Ergriffenheit und Begeisterung herauszuhören ist. Er selbst hat erfahren, was Liebe ist und was Liebe bewirken kann.
Die Theologie des Mittelalters bezeichnet die Liebe als "Form", das heißt als gestaltgebendes und wertschaffendes Prinzip aller Tugenden. Sie gibt damit der christlichen Ethik einen Impuls, der bis heute in ihr lebendig ist. Was wäre die Sorge der Eltern für die Kinder und die der Kinder für die Eltern ohne die innige Liebe, die Eltern und Kinder verbindet? Was wäre eheliche Gemeinschaft ohne Liebe, die in guten und in schlechten Tagen treu am anderen festhält und sich auch in Geduld, Nachsicht und Verzeihen erweist? Was wäre aller sozialer Einsatz ohne solidarische Liebe, die im andern den Mitmenschen, die Schwester, den Bruder sieht? Was wäre Gerechtigkeit ohne Liebe und Barmherzigkeit? Alle Überlegungen darüber, wie das christliche Ethos in den wechselnden Verhältnissen und Umständen des Lebens verwirklicht werden soll, sind erst dann wahrhaft humane Überlegungen, wenn sie von der Liebe begleitet sind. Wer mit den Augen des Herzens sieht, darf darauf vertrauen, daß er humane Antworten findet.
In seinen Predigten zum ersten Johannesbrief sagt der heilige Augustinus: "Ein für allemal schreib dir darum ein kurzes Gebot vor: Liebe und tu, was du willst! Schweigst du, so schweig aus Liebe; redest du, so rede aus Liebe; rügst du, rüge aus Liebe; schonst du, so schone aus Liebe. Die Wurzel der Liebe sei in deinem Herzen. Aus dieser Wurzel kann nur Gutes erblühen" (Traktat 7,8). Dieses Wort "Liebe und tu, was du willst" darf nicht als Beliebigkeit mißverstanden werden; vielmehr ist damit gemeint, daß die guten Taten, die wir tun, erst durch die Liebe ihren wahren Wert erhalten.
Weil die Liebe das menschliche Leben von seinem Anfang bis zu seinem Ende trägt und es in das Leben bei Gott hinüberträgt, richtet Paulus im letzten Teil des "Hohenliedes der Liebe" den Blick auf den ganzen Lebensweg des Menschen und auf seine letzte Erfüllung bei Gott. Der Mensch reift vom Kind zum Mann, schaut aber immer wie in einen Spiegel und sieht nur rätselhafte Umrisse (1 Kor 13,11f). Letzte Erkenntnis und Klarheit ist nur bei Gott zu erreichen, der den Menschen zuvor erkannt hat. Gottes erwählende Liebe kann nur durch Liebe erwidert werden. Darum treten selbst Glaube und Hoffnung als Grundhaltungen des Christen in dieser Welt hinter der Liebe zurück: "Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; doch am größten unter ihnen ist die Liebe" (V. 13).
Dieses Wort ist der Leitstern allen sittlichen Bemühens. Die Liebe ist Gabe und Aufgabe in einem. Sie trägt alle Verheißungen in sich und ruft zum Bleiben in der Liebe auf. Je mehr wir bei allem, was wir denken und tun, aus der Kraft und dem Motiv der Liebe leben, um so näher kommen wir Gott, auf den unser Leben ausgerichtet ist.
Christliche Liebe ist nicht leicht zu verwirklichen. Sie verlangt Einordnung in die menschliche Gemeinschaft und Bewährung in den Wechselfällen des Lebens. Unsere heutige Gesellschaft ist weithin von Profitstreben, Durchsetzung eigener Interessen, Mißachtung anderer Menschen beherrscht. Die Gebote der Bergpredigt werden als nicht erfüllbar bzw. utopisch angesehen. Versöhnung und Feindesliebe bleiben oft auf der Strecke. Das Teilen der irdischen Güter, Nachlaß der Schulden, soziale Verantwortung stoßen auf Widerstand. Diesem Sog einer säkularisierten Gesellschaft sieht sich der Christ ausgesetzt. Auch ihm erscheinen die extremen Forderungen Jesu kaum erfüllbar. Und doch weiß er: Nur die Liebe, die von der Freundesliebe über die Nächstenliebe bis zur Feindesliebe reicht, vermag zu heilen, zu befreien, zu beglücken. Im restlosen Vertrauen auf Gott den Vater kann er das menschlich unmöglich Erscheinende vollbringen. "Alles kann, wer glaubt" (Mk 9,23).
Von Gott, der uns zuerst geliebt hat (1 Joh 4,10), kommt alle Liebe; aber sie erreicht uns durch die Vermittlung von Menschen. Darum ist es wichtig, daß wir schon in frühester Kindheit Liebe von Menschen erfahren, seien es die Eltern oder andere Personen, die uns ihre Liebe und Sorge zuwenden. Ein Kind, das sich angenommen und geliebt weiß, kann ein Urvertrauen zu sich selbst, zu den Menschen und zur Welt gewinnen und seinen Lebensweg als Weg der Liebe gehen. Nur wer Liebe erfahren hat, kann auch Liebe weitergeben.
In der Jugend tritt der Heranwachsende aus der Geborgenheit des Kindesalters hinaus in die Zeit der Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung des Erwachsenen. Dabei kommt es auch zu Konflikten mit den Ansprüchen von Eltern und Erziehern. Werden dem Jugendlichen Dinge vorgeschrieben, die er nicht einsieht, kommt es zu Widerspruch und Auflehnung. Da sind einfühlendes Verständnis, Geduld und Nachsicht der Erwachsenen nötig. Erziehen muß immer vom Geist der Liebe getragen sein. Nur so kann Kindern und Heranwachsenden Ehrfurcht, Rücksichtnahme und Verträglichkeit nahegebracht werden. Wo unter Gleichaltrigen Eifersucht und Streit, Ablehnung und Gehässigkeit herrschen, muß ihnen am Wert des anderen aufgehen, daß niemand von der Liebe ausgeschlossen werden darf.
Liebe zu allen Menschen und soziale Verantwortung können schon frühzeitig geweckt werden, besonders für Arme und Hungernde, für Behinderte und Kranke. Junge Menschen sind für Not und Elend in der Welt aufgeschlossen. Wenn sie im Evangelium hören, daß Jesus gekommen ist, die Kranken zu heilen, die Gefangenen zu befreien, die Gefolterten zu erlösen (Lk 4,18), kann ihnen das die Augen öffnen für die Liebe, die Jesus verkündet. Das Beispiel Jesu und jener Christen, die sich aufopferungsvoll der Armen und Notleidenden in der Welt annehmen, bewegt die Herzen mehr als viele Worte und Ermahnungen. Am Vorbild anderer können junge Menschen in eine Haltung hineinwachsen, die nicht nur das eigene Wohl, sondern auch das der anderen sucht. Sie können begreifen, daß sie in der Liebe zu den Menschen Gott begegnen, aus dessen Liebe die Liebe zu den Menschen erwächst.
An die Erwachsenen treten die Probleme des beruflichen und öffentlichen Lebens, der rechten Gestaltung von Arbeit und Freizeit und von ehelichem und familiärem Leben heran. Die Beziehung der Geschlechter mit Partnersuche, engerer Bindung an den Partner oder die Partnerin, besonders in der Ehe, das alles tritt unter dem Zauberwort "Liebe" an den Menschen heran und übt eine tiefe Anziehungskraft auf ihn aus. Für Christen stellt sich hier die Aufgabe, die Liebe zwischen Mann und Frau in jener Ordnung der Liebe zu leben, die ihrer christlichen Berufung entspricht.
Die christliche Liebe schließt die natürliche Liebe von Mann und Frau ein. Diese soll sich nach dem Bild vom Menschen verwirklichen, das an der Gottebenbildlichkeit von Mann und Frau (Gen 1,27; 2,14) und an der Beziehung von Christus und Kirche (Eph 5,22-33) orientiert ist. Diese Liebe schließt die gegenseitige Achtung der Personen und die bleibende Treue zueinander ein. Jesu Ablehnung der Ehescheidung will die eheliche Gemeinschaft schützen. Die Ehe selbst ist für die Ehegatten in der Förderung des gegenseitigen geistig-leiblichen Wohls eine ständige Schule der Liebe. Nicht immer gelingt es den Ehegatten, Schwierigkeiten durch Aussprache, Streit, Verzeihung und Ertragen zu überwinden. Auch wenn es zur Trennung kommt, bleibt für die Getrennten der Anruf der Liebe bestehen, füreinander und für die Kinder, die aus der Ehe hervorgegangen sind, zu sorgen. Aus der Liebe wird so eine bleibende Verantwortung füreinander.
Im Alter stellen sich neue Aufgaben für die Liebe. Oft sind alte Menschen durch Schicksalsschläge und Enttäuschungen verbittert und isoliert. Sie sehnen sich nach Begegnungen, in denen ihnen neue Brücken zur Gemeinschaft gebaut werden. Wenn die psychischen und geistigen Kräfte nachlassen oder Krankheiten auftauchen, können neben ärztlicher Hilfe persönliche Kontakte, Freundlichkeit und Güte neuen Lebensmut geben. Vor allem Schwerkranke und Sterbende brauchen Zuwendung. Christliche Liebe wird sich um seelische Aufrichtung und Stärkung bemühen. Ältere Menschen, die allein leben, brauchen Hilfe für ihre täglichen Bedürfnisse; in Altenheimen Lebende freuen sich über Besuche.
Aber auch an die alten Menschen selbst ergeht der Ruf der Liebe, sei es in der Sorge für den Ehepartner oder für die Verwandten und die Enkelkinder. Hier können Großeltern viel Gutes tun. Nicht selten werden sie in der Betreuung der Kinder einspringen, wenn sich die Eltern durch Beruf oder andere Pflichten nicht genügend um die Kinder kümmern können. Auch die Teilnahme an Altenklubs, Ferienreisen und Gemeinschaftsveranstaltungen kann ein Dienst sein. Immer kommt es darauf an, Gemeinschaft zu stiften.
Das Leben ist so vielgestaltig, daß sich für die Liebe keine festen Regeln aufstellen lassen. Liebe ist erfinderisch und findet immer neue Möglichkeiten der Betätigung. In jedem Lebensalter sind Gebet und gemeinsamer Gottesdienst Kraftquellen und Ausdrucksformen christlicher Liebe. In der Urkirche war die Gemeinde der Ort, wo die Gläubigen die Gemeinsamkeit des Strebens und die Verbundenheit in der Liebe erfuhren. Alle wollten "ein Herz und eine Seele" sein (Apg 4,32). Die Bindung an die Glaubensgemeinde, in der alle dem Evangelium folgen wollen, ist eine starke Stütze für den Impuls zur Liebe. Der Gemeinde der Brüder und Schwestern ist das Wirkungsfeld der Liebe besonders zugewiesen. "Tut Gutes allen Menschen, besonders denen, die mit uns im Glauben verbunden sind" (Gal 6,10). Neben die leiblichen Werke der Barmherzigkeit treten die geistigen Werke der Barmherzigkeit wie Rat für Unschlüssige, Trost für Betrübte, Gebet für Bedrängte, brüderlich-schwesterliche Zurechtweisung. In alledem ist die Liebe die treibende Kraft auf dem Weg zum eigenen Heil und zum Heil der Mitmenschen.
Das Größte, aber auch das Schwerste auf unserem Lebensweg ist die Liebe. Wer den Weg der Liebe geht, erlebt Höhen und Tiefen, Entbehrungen und Enttäuschungen, Versagen und Schuld. Aber er wird auch ständig ermutigt, die Liebe nicht aufzugeben. "Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt sie" (1 Joh 4,18). Wer in der Liebe verwurzelt und festgegründet ist, wird mehr und mehr von der Fülle Gottes erfüllt werden (Eph 3,17.19). Denn Gott selbst ist die Liebe (1 Joh 4,8).
Abkürzungsverzeichnis
AA = Dekret über das Laienapostolat "Apostolicam actuositatem" (1965)
AG = Dekret über die Missionstätigkeit der Kirche "Ad gentes" (1965)
Apol = Apologie des Augsburger Bekenntnisses (1530)
BB = Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland, Beschluß: Schwerpunkte kirchlicher Verantwortung im Bildungsbereich
CA (Band I) = Confessio Augustana (Augsburger Bekenntnis) (1530)
CA (Band II) = Enzyklika von Papst Johannes Paul II. zum 100. Jahresgedächtnis der Enzyklika "Rerum novarum" "Centesimus annus" (1991)
CD = Dekret über die Hirtenaufgabe der Bischöfe in der Kirche "Christus Dominus" (1965)
CIC = Codex iuris canonici (Codex des kanonischen Rechtes) (1983)
CP = Päpstlicher Rat für die sozialen Kommunikationsmittel, Pastoralinstruktion "Communio et progressio" über die Instrumente der sozialen Kommunikation (1971)
DH = Erklärung über die Religionsfreiheit "Dignitatis humanae" (1965)
Did= Didache (Apostellehre)
DS = H. Denzinger/A. Schönmetzer, Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Barcelona-Freiburg-Rom, 36. Aufl. 1979 und 37. Auflage 1991
DV = Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung "Dei Verbum" (1965)
EF = Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland, Beschluß: Christlich gelebte Ehe und Familie
EN = Apostolisches Schreiben von Papst Paul VI. über die Evangelisierung in der Welt von heute "Evangelii nuntiandi" (1975)
FC = Apostolisches Schreiben von Papst Johannes Paul II. über die Aufgaben der christlichen Familie in der Welt von heute "Familiaris consortio" (1981)
GE = Erklärung über die christliche Erziehung "Gravissimum educationis" (1965)
GF = Gerechtigkeit schafft Frieden. Wort der Deutschen Bischofskonferenz zum Frieden (1983)
GG = Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
GL = Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch (1975)
GS = Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute "Gaudium et spes" (1965)
HV = Enzyklika von Papst Paul VI. über die Geburtenregelung "Humanae vitae" (1968)
IM = Dekret über die sozialen Kommunikationsmittel "Inter mirifica" (1963)
KEK 1 = Katholischer Erwachsenen-Katechismus, Erster Band: Das Glaubensbekenntnis der Kirche, hrsg. von der Deutschen Bischofskonferenz (1985)
KKK = Katechismus der Katholischen Kirche, Vatikanstadt-München u.a. 1993
LE = Enzyklika von Papst Johannes Paul II. über die menschliche Arbeit "Laborem exercens" (1981)
LG = Dogmatische Konstitution über die Kirche "Lumen gentium" (1964)
MM = Enzyklika von Papst Johannes XXIII. über die jüngsten Entwicklungen des gesellschaftlichen Lebens und seine Gestaltung im Licht der christlichen Lehre "Mater et magistra" (1961)
Mysterium ecclesiae = Erklärung der Kongregation für die Glaubenslehre "Mysterium ecclesiae" (1975)
NA = Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen "Nostra aetate" (1965)
NR = J. Neuner/H. Roos, Der Glaube der Kirche in den Urkunden der Lehrverkündigung. Neu bearbeitet v. K. Rahner, K. H. Weger, Regensburg, 11. Aufl. 1983
OA = Apostolisches Schreiben von Papst Paul VI. zum 80. Jahresgedächtnis der Enzyklika "Rerum novarum" "Octogesima adveniens" (1971)
ÖD = Ökumenisches Direktorium (1993)
OE = Dekret über die katholischen Ostkirchen "Orientalium Ecclesiarum" (1964)
OP = Ordo poenitentiae (1974; 1991)
PC = Dekret über die zeitgemäße Erneuerung des Ordenslebens "Perfectae caritatis" (1965)
PO = Dekret über Dienst und Leben der Priester "Presbyterorum ordinis" (1965)
PP = Enzyklika von Papst Paul VI. über die Entwicklung der Völker "Populorum progressio" (1967)
PT = Enzyklika von Papst Johannes XXIII. über den Frieden unter den Völkern "Pacem in terris" (1963)
QA = Enzyklika von Papst Pius XI. zum 40. Jahresgedächtnis der Enzyklika "Rerum novarum" "Quadragesimo anno" (1931)
RH = Enzyklika von Papst Johannes Paul II. "Redemptor hominis" (1979)
RN = Enzyklika von Papst Leo XIII. über die Arbeiterfrage "Rerum novarum" (1891)
RP = Apostolisches Schreiben von Papst Johannes Paul II. über Versöhnung und Buße in der Kirche "Reconciliatio et paenitentia" (1984)
SC = Konstitution über die heilige Liturgie "Sacrosanctum Concilium" (1963)
SRS = Enzyklika von Papst Johannes Paul II. über die soziale Sorge der Kirche "Sollicitudo rei socialis" (1987)
UG = Aufbau und Entfaltung des gesellschaftlichen Lebens. Soziale Summe Papst Pius' XII., hrsg. von A.-F. Utz/J.-F. Groner, Bd. 1-3, Freiburg/Schw. 1954ff
UH = Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland, Beschluß: Unsere Hoffnung
UR = Dekret über den Ökumenismus "Unitatis redintegratio" (1994)
VS = Enzyklika von Papst Johannes Paul II. "Veritatis splendor" (1993)
Weblinks
- Online Version des KEK mit Suchfunktion (der Seitenzahl)